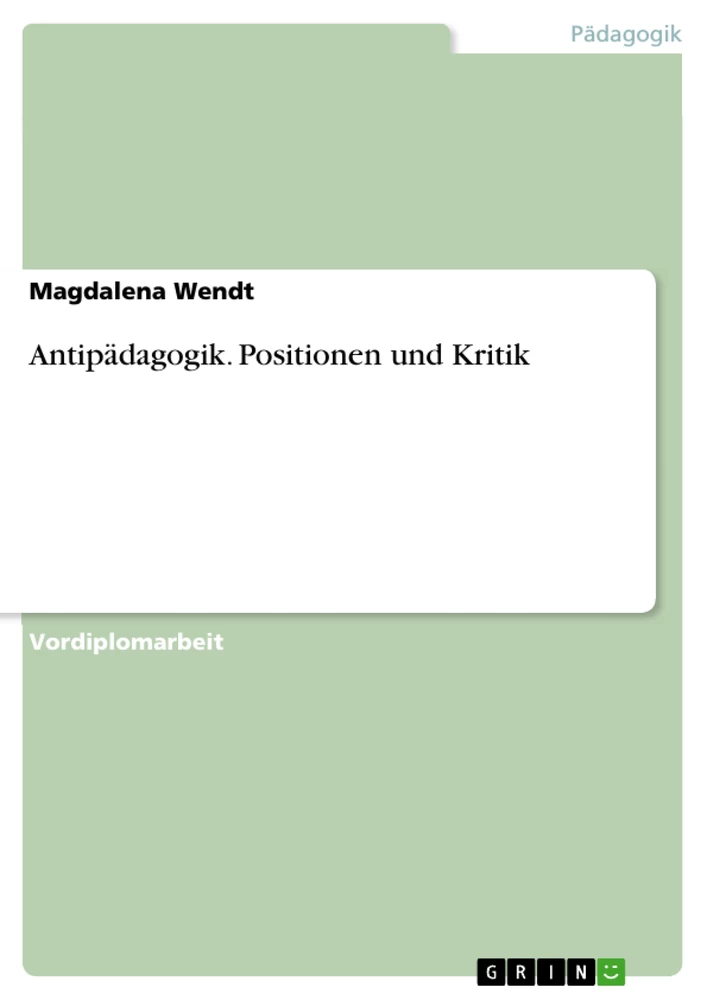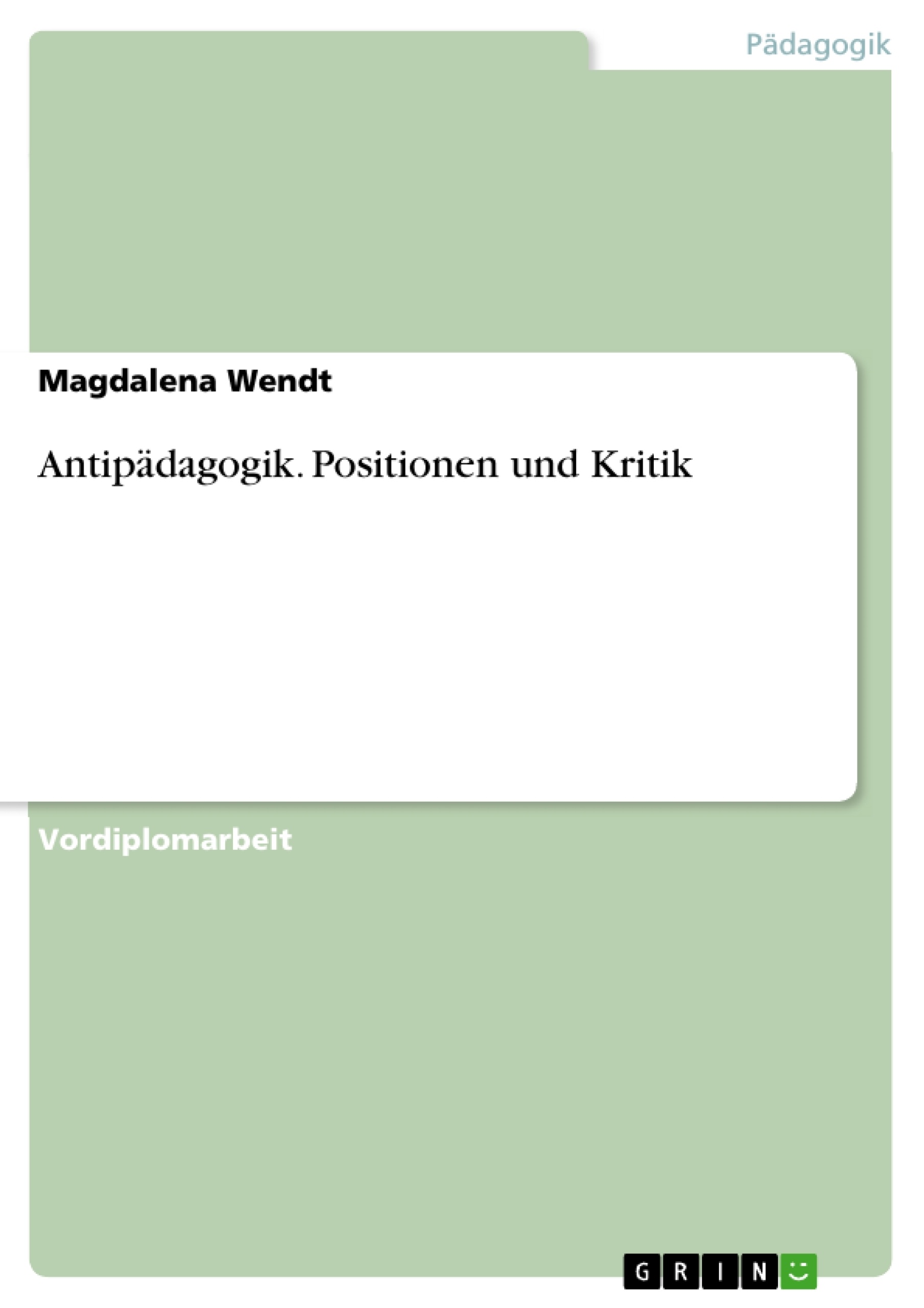Kritische Meinungen über Erziehungstheorien und Erziehungspraktiken gab es schon immer. Es wird sie auch immer geben und das ist auch gut so. Durch die Kritik wird Erziehung immer wieder neu betrachtet und gewertet und ist somit gezwungen sich umzugestalten.
Pädagogen streiten sich seit der Begründung der Pädagogik als Wissenschaft um Zielsetzung, Methoden und Formen/Stile von Erziehung. Die Unstimmigkeiten beziehen sich dabei sowohl auf Theorien, als auch auf die Erziehungspraxis. Ziel der Bemühungen ist es, eine ständige Verbesserung der Erziehung zu erreichen. Trotz der Streitigkeiten steht jedoch fest, dass Kinder und Jugendliche erzogen werden müssen.
In den 70er Jahren entstand jedoch die Antipädagogik, eine Bewegung, die sich nicht mehr für eine Veränderung der Erziehung einsetzte, sondern die totale Aufhebung und Abschaffung von Erziehung forderte.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Strömung „Antipädagogik“. Sie geht auf verschiedene Positionen ein, befasst sich aber auch mit der Kritik an diesen.
Zu Beginn meiner Ausführungen werde ich kurz auf den Erziehungsbegriff und auf verschiedene Erziehungsstile eingehen. Dies soll die Grundlage für die Auseinandersetzung mit der Antipädagogik sein.
Im nächsten Punkt werde ich eine Definition von Antipädagogik geben und auf Geschichte und Ursprung eingehen. Ich möchte dann kurz die antipädagogische und die pädagogische Grundposition zur Erziehung nennen. Danach werde ich das pädagogische, sowie das antipädagogische Menschenbild erläutern. Im nächsten Abschnitt sollen die Positionen einflußreicher Vertreter der Antipädagogik etwas ausführlicher herausgearbeitet werden. Zu diesen Überzeugungen werden dann die Pädagogen ihre Meinung darlegen. Anschließend wird das Pädagogische an der Antipädagogik erörtert und es stellt sich die Frage, ob es lohnenswert ist, sich mit der Antipädagogik auseinanderzusetzen. Im letzten Teil möchte ich meine persönliche Meinung zu dem Thema äußern.
Die antipädagogische Seite wird von EKKEHARD VON BRAUNMÜHL, ALICE MILLER und HUBERTUS VON SCHOENEBECK vertreten. Vertreter der Pädagogen sind ANDREAS FLITNER, JÜRGEN OELKERS und THOMAS LEHMANN.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Erziehung - Was heißt das?
- 2. Antipädagogik – Ursprung und Verlauf
- 2.1. Definition des Begriffes Antipädagogik
- 2.2. Geschichte der Antipädagogik
- 2.3. Ursprung der Antipädagogik: ROUSSEAU
- 3. Positionen zur Erziehung
- 3.1. Die antipädagogische Grundposition
- 3.2. Die pädagogische Einstellung
- 4. Unterschiede in der Menschenbildauffassung
- 4.1. Das Menschenbild der Pädagogik
- 4.2. Das Menschenbild der Antipädagogik
- 4.3. Kritik am antipädagogischen Menschenbild
- 5. Die antipädagogische Einstellung
- 5.1. Position von EKKEHARD v. BRAUNMÜHL
- 5.2. Position von ALICE MILLER
- 5.3. Position von HUBERTUS v. SCHOENEBECK
- 6. Kritik der Pädagogen
- 6.1. ANDREAS FLITNER: Mut zur Erziehung
- 6.2. OELKERS/LEHMANN: Müssen wir erziehen?
- 7. Das Pädagogische an der Antipädagogik
- 8. Lohnt sich die Auseinandersetzung mit der Antipädagogik?
- 9. Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beleuchtet die Strömung „Antipädagogik“ und untersucht verschiedene Positionen und Kritikpunkte innerhalb dieser Bewegung. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Antipädagogik zu entwickeln, indem die Geschichte, die zentralen Argumente und die wichtigsten Vertreter der Antipädagogik beleuchtet werden.
- Definition und Geschichte der Antipädagogik
- Kontrast zwischen pädagogischem und antipädagogischem Menschenbild
- Kritik an der Antipädagogik aus pädagogischer Sicht
- Das Pädagogische in der Antipädagogik
- Relevanz der Auseinandersetzung mit der Antipädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Text stellt die unterschiedlichen Auffassungen von Erziehung anhand von Zitaten von Kant, Rousseau und Flitner dar. Er erläutert die Relevanz der Auseinandersetzung mit kritischen Stimmen und die Notwendigkeit der stetigen Weiterentwicklung von Erziehung.
- Erziehung - Was heißt das?: Das Kapitel beleuchtet den Erziehungsbegriff und seine vielschichtigen Auslegungen. Es werden verschiedene Definitionen von Erziehung aus der Erziehungswissenschaft vorgestellt, insbesondere im Zusammenhang mit Sozialisation.
- Antipädagogik – Ursprung und Verlauf: Dieser Abschnitt liefert eine Definition des Begriffs „Antipädagogik“ und beleuchtet die historische Entwicklung der Antipädagogik. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Einfluss von Rousseau auf die antipädagogische Bewegung.
- Positionen zur Erziehung: Das Kapitel stellt die antipädagogische Grundposition und die pädagogische Einstellung zur Erziehung gegenüber. Es verdeutlicht die grundlegenden Unterschiede in der Sichtweise auf Erziehung.
- Unterschiede in der Menschenbildauffassung: Dieser Abschnitt erläutert die unterschiedlichen Menschenbilder der Pädagogik und der Antipädagogik. Er analysiert die Kritik am antipädagogischen Menschenbild.
- Die antipädagogische Einstellung: In diesem Kapitel werden die Positionen wichtiger Vertreter der Antipädagogik, wie EKKEHARD v. BRAUNMÜHL, ALICE MILLER und HUBERTUS v. SCHOENEBECK, ausführlich beleuchtet.
- Kritik der Pädagogen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Kritik an der Antipädagogik aus pädagogischer Sicht. Die Ansichten von ANDREAS FLITNER, JÜRGEN OELKERS und THOMAS LEHMANN werden vorgestellt.
- Das Pädagogische an der Antipädagogik: Dieser Abschnitt untersucht, welche pädagogischen Aspekte in der Antipädagogik vorhanden sind und welche Rolle sie für die pädagogische Diskussion spielen können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Antipädagogik, Erziehung, Menschenbild, Kritik, Pädagogik, Sozialisation, Rousseau, Braunmühl, Miller, Schoenebeck, Flitner, Oelkers, Lehmann. Zentraler Forschungsgegenstand sind die Positionen und Argumente der Antipädagogik und ihre Auswirkungen auf die pädagogische Theorie und Praxis.
- Arbeit zitieren
- Magdalena Wendt (Autor:in), 1999, Antipädagogik. Positionen und Kritik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71153