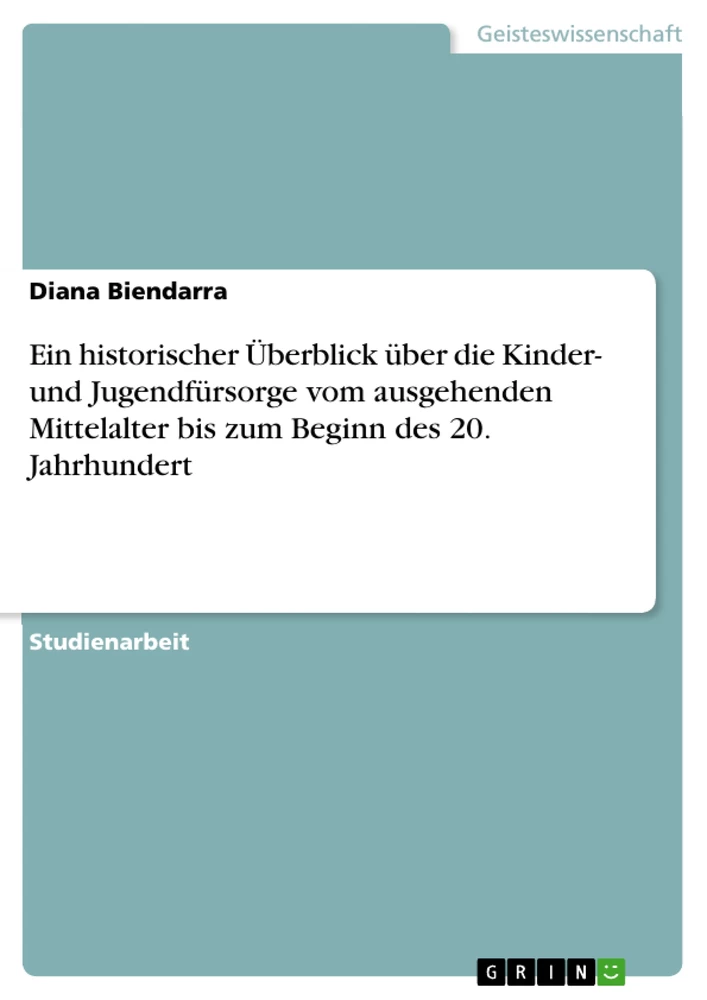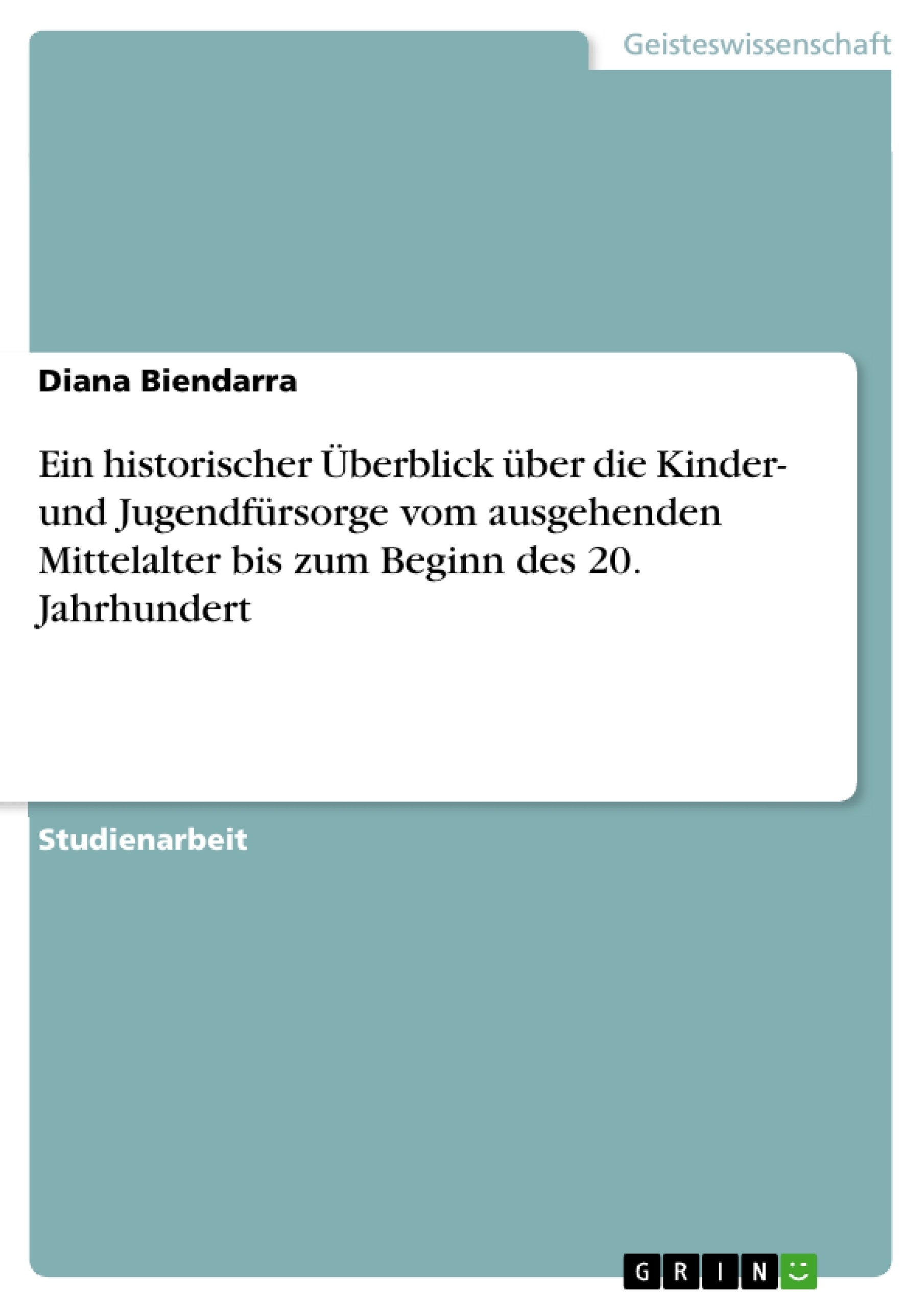(...) Die umstrittene Geschichte der Sozialen Arbeit, speziell der Jugendfürsorge, lässt sich geschichtlich jedoch weiter zurückverfolgen. Schon im Mittelalter erkannte man, dass familiäre und dörfliche Pflege und Hilfe nicht mehr ausreichten um der Armut entgegen zu wirken. Öffentliche Fürsorge wurde notwendig. Um auch die früheren Anfänge in der Fürsorge, aufzuzeigen, beginnt die folgende Arbeit mit dem 15. und 16. Jahrhundert, wo die ersten Findel- und Waisenhäuser zur Versorgung von Kindern und Jugendlichen aus den damaligen Hospitals, der bis dahin universellen Fürsorgeeinrichtung unter anderem auch für Alte und Kranke, hervorgingen.
Danach folgen das 18. und 19. Jahrhundert mit dem Pietismus, der Aufklärung und der Entstehung von Rettungshäusern. Mit dem Deutschen Reich und der Einführung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes schließt der Text ab, da die folgenden Jahrzehnte zur relativ jungen Geschichte zählen und deren Ideen und Gesetze teilweise heute noch von Bestand sind.(...)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgehendes Mittelalter und der Beginn der Neuzeit (ca. 1400 – 1650)
- Pietismus und Aufklärung (ca. 1650 – 1820)
- Rückzug des Staates und Entstehung der Rettungshäuser (1820 - 1870)
- Wiedererstarken der öffentlichen Fürsorge mit der Gründung des Deutschen Reiches (1870-1915)
- Einführung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes (RJWG) (1915 - 1925)
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen historischen Überblick über die Kinder- und Jugendfürsorge vom ausgehenden Mittelalter bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie untersucht die Entwicklung der Fürsorgeeinrichtungen und -methoden im Wandel der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse. Aufgrund des begrenzten Umfangs ist die Abhandlung einführend und oberflächlich, und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
- Entwicklung der Kinder- und Jugendfürsorge vom Mittelalter bis zur Weimarer Republik
- Wandel der Fürsorgeeinrichtungen (z.B. Hospitäler, Findelhäuser, Rettungshäuser)
- Einfluss von religiösen und philosophischen Strömungen (Pietismus, Aufklärung)
- Rolle des Staates in der Kinder- und Jugendfürsorge
- Arbeitserziehung und soziale Integration
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung definiert Jugendfürsorge als organisierte gesellschaftliche Hilfeleistung für gefährdete Kinder und Jugendliche und erläutert den zeitlichen und inhaltlichen Rahmen der Arbeit (ca. 1500-1925). Sie betont den einführenden Charakter der Arbeit und verweist auf die Notwendigkeit weiterer Forschung. Die Autorin hebt die Notwendigkeit öffentlicher Fürsorge hervor, da familiäre und dörfliche Hilfe nicht mehr ausreichte, und verortet die Anfänge in den Findel- und Waisenhäusern des 15. und 16. Jahrhunderts, die aus den mittelalterlichen Hospitälern hervorgingen.
2. Ausgehendes Mittelalter und der Beginn der Neuzeit (ca. 1400-1650): Dieses Kapitel beschreibt die Fürsorge für hilfsbedürftige Kinder im Mittelalter. Waisen und Findelkinder wurden in Hospitälern zusammen mit alten und kranken Menschen untergebracht. Mit dem Aufkommen gesonderter Krankenanstalten entstanden Findel- und Waisenhäuser, die eine kindgerechtere Versorgung, jedoch auch körperliche Züchtigung boten. Adoptionen und Pflegefamilien waren aufgrund finanzieller Erwägungen vorrangig. Das Bettelwesen und die ersten Bettelordnungen werden als ein wichtiges Element der damaligen sozialen Organisation beschrieben. Die Häuser dienten primär der Versorgung, nicht der Erziehung, was zu einem Teufelskreis der Armut führte.
3. Pietismus und Aufklärung (ca. 1650 - 1820): Dieses Kapitel beleuchtet den Einfluss des Pietismus und der Aufklärung auf die Kinder- und Jugendfürsorge. Der Pietismus betonte religiöse Erziehung und Gehorsam, wie in den Halleschen Anstalten August Hermann Franckes. Kinderarbeit war üblich und wirtschaftliche Aspekte dominierten oft die Erziehung. Die Aufklärung brachte Kritik an den bestehenden Waisenhäusern hervor, mit Forderungen nach Hygiene, besserer Behandlung und weniger religiöser Erziehung. Der sogenannte "Waisenhausstreit" führte zu Schließungen von Einrichtungen und zur verstärkten Unterbringung von Kindern in Familienpflege.
Schlüsselwörter
Kinder- und Jugendfürsorge, Geschichte, Mittelalter, Neuzeit, Pietismus, Aufklärung, Findelhäuser, Waisenhäuser, Rettungshäuser, Armenpflege, Arbeitserziehung, Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG), soziale Arbeit, Bettelwesen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Geschichte der Kinder- und Jugendfürsorge
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen historischen Überblick über die Kinder- und Jugendfürsorge vom ausgehenden Mittelalter bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts (ca. 1400-1925). Er behandelt die Entwicklung der Fürsorgeeinrichtungen und -methoden im Kontext gesellschaftlicher und politischer Veränderungen, inklusive des Einflusses von Pietismus und Aufklärung. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Institutionen wie Hospitälern, Findel- und Waisenhäusern sowie Rettungshäusern und der Rolle des Staates in der Kinder- und Jugendfürsorge. Der Text ist einführend und oberflächlich und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Welche Epochen werden behandelt?
Der Text umfasst die folgenden Epochen: Ausgehendes Mittelalter und der Beginn der Neuzeit (ca. 1400 – 1650), Pietismus und Aufklärung (ca. 1650 – 1820), Rückzug des Staates und Entstehung der Rettungshäuser (1820 - 1870), Wiedererstarken der öffentlichen Fürsorge mit der Gründung des Deutschen Reiches (1870-1915), und die Einführung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes (RJWG) (1915 - 1925).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die wichtigsten Themen sind: die Entwicklung der Kinder- und Jugendfürsorge vom Mittelalter bis zur Weimarer Republik; der Wandel der Fürsorgeeinrichtungen (Hospitäler, Findelhäuser, Rettungshäuser); der Einfluss religiöser und philosophischer Strömungen (Pietismus, Aufklärung); die Rolle des Staates in der Kinder- und Jugendfürsorge; und die Arbeitserziehung und soziale Integration.
Wie werden die einzelnen Kapitel zusammengefasst?
Die Zusammenfassung der Kapitel beschreibt die Entwicklung der Fürsorge von mittelalterlichen Hospitälern über spezialisierte Findel- und Waisenhäuser bis hin zu den Auswirkungen des Pietismus und der Aufklärung auf die Einrichtungen und Methoden. Es wird der Wandel von der hauptsächlich religiös geprägten Erziehung hin zu Forderungen nach Hygiene und besserer Behandlung beleuchtet. Die Kapitel zeigen die Herausforderungen und den langsamen Fortschritt in der Kinder- und Jugendfürsorge auf.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Kinder- und Jugendfürsorge, Geschichte, Mittelalter, Neuzeit, Pietismus, Aufklärung, Findelhäuser, Waisenhäuser, Rettungshäuser, Armenpflege, Arbeitserziehung, Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG), soziale Arbeit, Bettelwesen.
Welche Art von Quellen werden verwendet?
Der Text gibt keine konkreten Quellen an. Er ist als einführender Überblick konzipiert und zielt auf eine allgemeine Darstellung der historischen Entwicklung ab, nicht auf detaillierte wissenschaftliche Analyse basierend auf spezifischen Quellen.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text richtet sich an Leser, die einen ersten Überblick über die Geschichte der Kinder- und Jugendfürsorge in Deutschland erhalten möchten. Er eignet sich beispielsweise für Studierende der Sozialen Arbeit oder der Geschichte, die sich mit diesem Thema vertraut machen wollen.
- Quote paper
- Diana Biendarra (Author), 2005, Ein historischer Überblick über die Kinder- und Jugendfürsorge vom ausgehenden Mittelalter bis zum Beginn des 20. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71056