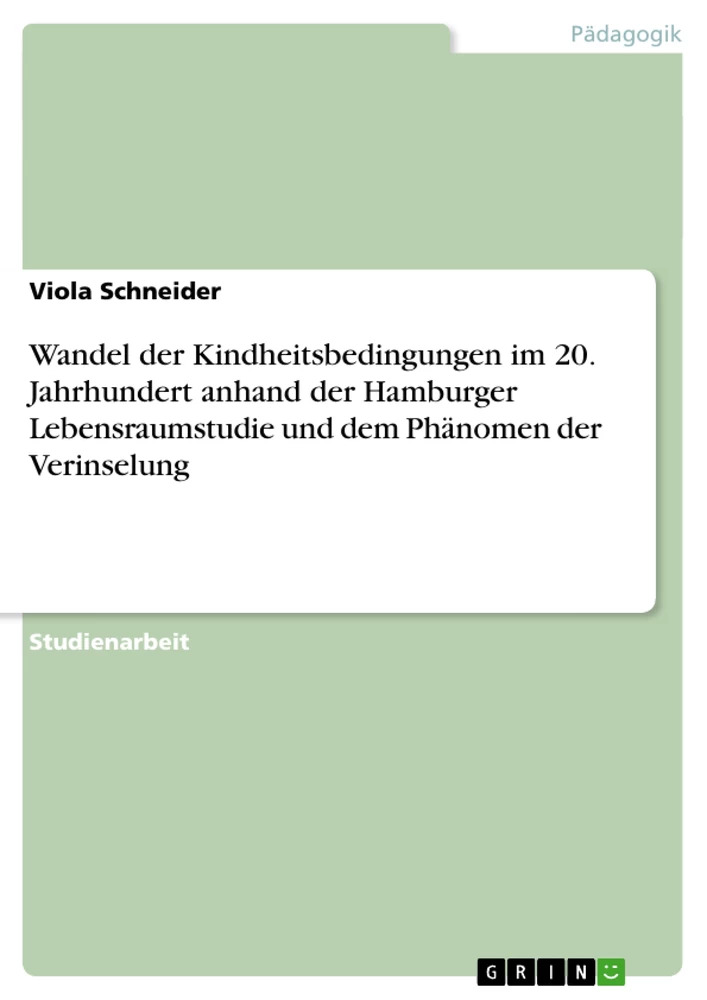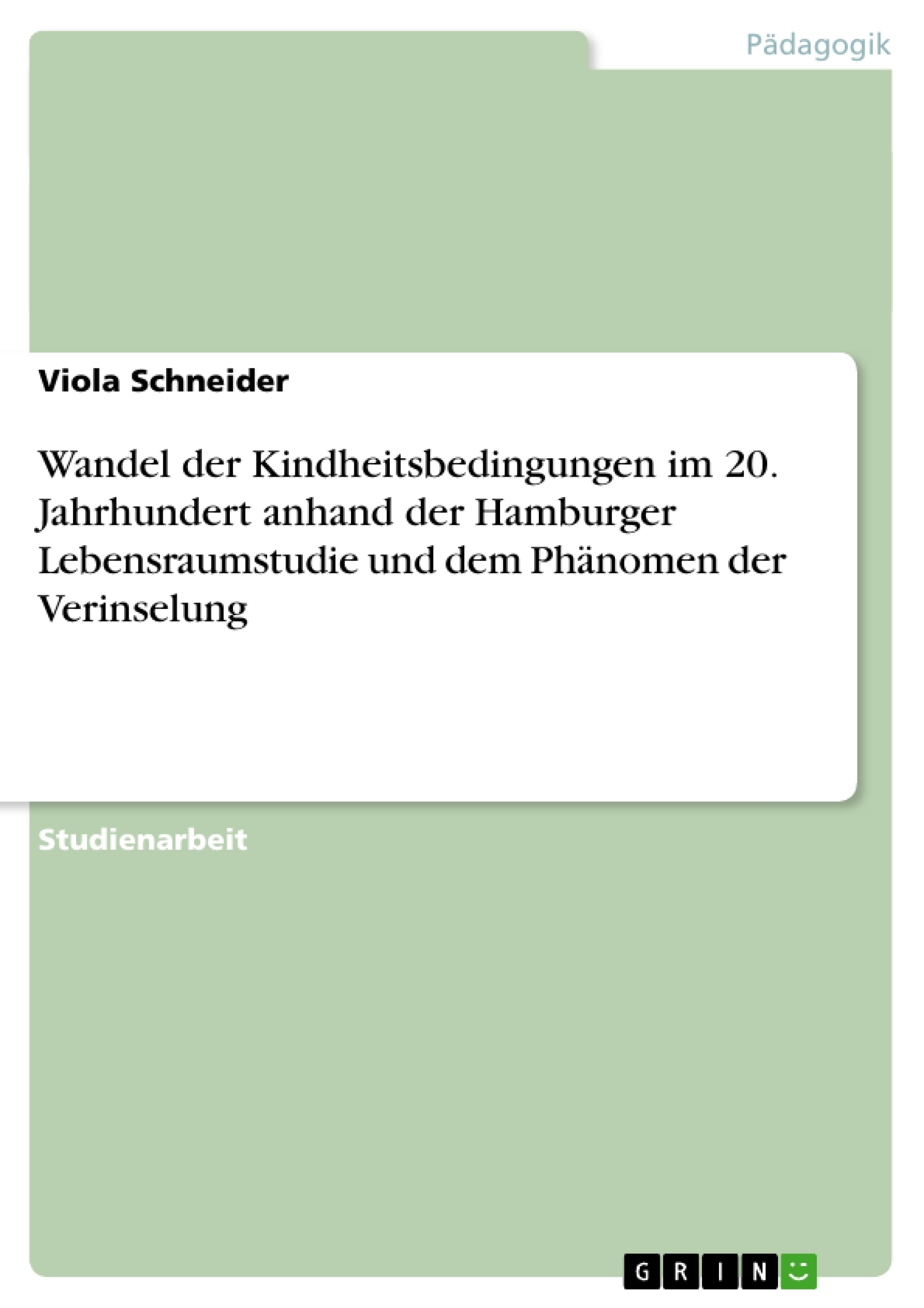Kindheit wird von der Kindheitsforschung als wechselseitige Beziehung zwischen heranwachsenden Personen und ihren sich wandelnden soziokulturellen Umwelten verstanden. Die vorliegende Arbeit greift einen Aspekt dieses Wandels heraus: Sie stellt sich die Frage, inwiefern sich Raumaneignung durch Kinder im letzten Jahrhundert verändert hat. Um dieses Themenfeld weiter zu differenzieren und einzugrenzen, soll das Hauptaugenmerk dabei auf der Aneignung des Raumes durch Großstadtkinder liegen. Wenn man davon ausgeht, dass ein Hauptinhalt der kindlichen Entwicklung darin besteht, sich die bestehende Kultur anzueignen, könnte man vermuten, dass sich die kindlichen Aneignungsmechanismen von (Lebens-) Raum und Zeit in den letzten Jahrzehnten gewandelt haben.
Um den Wandel zu verdeutlichen, sollen zwei Momentaufnahmen kindlicher Sozialisation, und damit kindlicher Raumaneignung, des letzten Jahrhunderts im Mittelpunkt stehen: Die Lebensraumstudie von Martha und Hans Heinrich Muchow beleuchtet die Aneignung des Lebensraumes von Hamburger Kindern Ende der 1920er und Anfang der 1930er Jahre. Zeiher und Zeiher prägten den Begriff der „Verinselung von Kindheitsräumen“. Dieses moderne Phänomen, das von Zeiher/Zeiher bereits zu Beginn der 90er Jahre identifiziert wurde, soll stellvertretend für die gegenwärtigen Mechanismen von Raumaneignung durch Kinder vorgestellt werden.
Um der Frage auf den Grund zu gehen, ob und inwiefern sich Kindheitsräume und die Aneignung eben dieser im 20. Jahrhundert verändert haben, erscheint es zunächst sinnvoll, einige sozialisationstheoretische Prämissen zu benennen und Begriffsbestimmungen zum Thema Sozialisation und Raum anzugeben.
Hernach soll die Lebensraumstudie Hamburger Kinder von Muchow und Muchow skizziert und die wichtigsten Ergebnisse knapp vorgestellt werden.
Um den Vergleich zur Moderne herzustellen wird anschließend der Begriff der Verinselung näher beleuchtet. Dabei soll zunächst das Phänomen der Verinselung genauer identifiziert werden, bevor auf Grundlage der Ergebnisse der vorangegangen Arbeitsabschnitte Überlegungen darüber angestellt werden welche veränderten Bedingungen zu verinselten Lebensräumen führen und welche Bedeutungen diese Veränderungen für die kindliche Sozialisation haben könnten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Zwei Beispiele
- 1.2 Kindheit im Wandel
- 1.3 Vorgehensweise
- 2. Vorbemerkungen
- 2.1 Sozialisation
- 2.2 Bedeutung des Raumes im Kontext der Sozialisationsforschung
- 3. Kindheitsräume in den 1920er Jahren: Die Lebensraumstudie Hamburger Kinder von Muchow und Muchow
- 3.1 Sozialisationstheoretische Prämissen zu Martha Muchows Forschungen
- 3.2 Die Hamburger Lebensraumstudie: Aufbau und Besonderheiten
- 3.2.1 Der Untersuchungsanlass und Untersuchungsgegenstand
- 3.2.2 Besonderheiten der Studie
- 3.2.3 Form und Methode der Lebensraumstudie
- 3.3 Ergebnisse der Studie
- 3.3.1 Der Lebensraum des Großstadtkindes
- 3.3.2 Der Raum, den das Kind erlebt
- 3.3.3 Der Raum, den das Kind lebt
- 3.4 Zusammenfassung
- 4. Verinselung von Kindheitsräumen und -Zeiten zum Ende des 20. Jahrhunderts
- 4.1 Das Phänomen der Verinselung
- 4.2 Wandel der Kindheit
- 4.2.1 Modernisierung
- 4.2.2 Individualisierung
- 4.2.3 Selbstständigkeit
- 4.2.4 Mobilisierung
- 4.3 Zusammenfassung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel der Raumaneignung von Großstadtkindern im 20. Jahrhundert. Sie vergleicht die Lebensbedingungen und -räume von Kindern in den 1920er Jahren mit denen am Ende des Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf der Veränderung der Möglichkeiten und der Art und Weise, wie Kinder ihren Lebensraum gestalten und erleben.
- Vergleich der Raumaneignung von Kindern in den 1920er und Ende des 20. Jahrhunderts
- Analyse der Lebensraumstudie von Muchow und Muchow
- Untersuchung des Phänomens der "Verinselung" von Kindheitsräumen
- Einfluss von Modernisierung, Individualisierung und Mobilisierung auf kindliche Sozialisation
- Bedeutung des Raumes für die kindliche Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung präsentiert zwei Fallbeispiele, Anne und Mona, die kontrastierende Kindheitserfahrungen in unterschiedlichen Epochen des 20. Jahrhunderts repräsentieren. Der Unterschied in ihren Tagesabläufen, der Spontaneität von Annes Leben im Gegensatz zu Monas strukturiertem Alltag, zeigt den Wandel der Kindheitsbedingungen auf. Die Einleitung formuliert die Forschungsfrage nach der Veränderung der Raumaneignung von Großstadtkindern und skizziert die Vorgehensweise der Arbeit, die die Lebensraumstudie von Muchow und Muchow mit dem Phänomen der Verinselung von Kindheitsräumen vergleicht.
2. Vorbemerkungen: Dieses Kapitel legt die sozialisationstheoretischen Grundlagen für die Untersuchung fest. Es definiert den Begriff der Sozialisation und betont die Bedeutung des Raumes in der Sozialisationsforschung. Es bildet die theoretische Basis für den Vergleich der beiden untersuchten Epochen.
3. Kindheitsräume in den 1920er Jahren: Die Lebensraumstudie Hamburger Kinder von Muchow und Muchow: Dieses Kapitel präsentiert die Hamburger Lebensraumstudie als zentrale Quelle zur Erforschung von Kindheitsräumen in den 1920er Jahren. Es beschreibt die Methodik und Ergebnisse der Studie, die den Lebensraum des Großstadtkindes, die kindliche Wahrnehmung und Gestaltung des Raumes detailliert analysiert. Die Zusammenfassung der Ergebnisse hebt die Unterschiede zum modernen Verständnis kindlicher Raumaneignung hervor.
4. Verinselung von Kindheitsräumen und -Zeiten zum Ende des 20. Jahrhunderts: Dieses Kapitel beschreibt das Phänomen der "Verinselung" von Kindheitsräumen, ein Begriff, der die zunehmende Isolation und Eingeschränktheit kindlicher Lebensräume am Ende des 20. Jahrhunderts beschreibt. Es analysiert die Faktoren, die zu dieser Entwicklung beitragen, wie Modernisierung, Individualisierung, zunehmende Selbstständigkeit und Mobilisierung. Die Kapitel untersucht die Auswirkungen dieser Veränderungen auf die Sozialisation von Kindern.
Schlüsselwörter
Kindheit, Raumaneignung, Sozialisation, Lebensraumstudie, Muchow, Verinselung, Großstadt, Modernisierung, Individualisierung, 20. Jahrhundert, Hamburger Lebensraumstudie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Wandel der Raumaneignung von Großstadtkindern im 20. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Wandel der Raumaneignung von Großstadtkindern im 20. Jahrhundert. Sie vergleicht die Lebensbedingungen und -räume von Kindern in den 1920er Jahren mit denen am Ende des Jahrhunderts und konzentriert sich auf die Veränderung der Möglichkeiten und der Art und Weise, wie Kinder ihren Lebensraum gestalten und erleben.
Welche Quellen werden verwendet?
Die zentrale Quelle ist die Lebensraumstudie Hamburger Kinder von Muchow und Muchow aus den 1920er Jahren. Diese Studie wird mit Beobachtungen und Analysen vom Ende des 20. Jahrhunderts verglichen, um den Wandel der kindlichen Raumaneignung aufzuzeigen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Vergleich der Raumaneignung von Kindern in den 1920er und Ende des 20. Jahrhunderts; Analyse der Lebensraumstudie von Muchow und Muchow; Untersuchung des Phänomens der "Verinselung" von Kindheitsräumen; Einfluss von Modernisierung, Individualisierung und Mobilisierung auf kindliche Sozialisation; Bedeutung des Raumes für die kindliche Entwicklung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (mit zwei Fallbeispielen und Forschungsfrage), Vorbemerkungen (sozialisationstheoretische Grundlagen), Analyse der Lebensraumstudie Muchow/Muchow (Methoden, Ergebnisse und Zusammenfassung), Untersuchung der "Verinselung" von Kindheitsräumen am Ende des 20. Jahrhunderts (Faktoren und Auswirkungen) und Fazit.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Lebensraumstudie Muchow/Muchow?
Die Lebensraumstudie von Muchow und Muchow analysiert detailliert den Lebensraum des Großstadtkindes in den 1920er Jahren, die kindliche Wahrnehmung und Gestaltung des Raumes. Die Ergebnisse werden im Kontext des modernen Verständnisses kindlicher Raumaneignung interpretiert und hervorgehoben.
Was bedeutet "Verinselung" von Kindheitsräumen?
Der Begriff "Verinselung" beschreibt die zunehmende Isolation und Eingeschränktheit kindlicher Lebensräume am Ende des 20. Jahrhunderts. Die Arbeit analysiert die Faktoren, die zu dieser Entwicklung beitragen, wie Modernisierung, Individualisierung, zunehmende Selbstständigkeit und Mobilisierung, und untersucht die Auswirkungen auf die kindliche Sozialisation.
Welchen Einfluss haben Modernisierung, Individualisierung und Mobilisierung auf die kindliche Sozialisation?
Die Arbeit untersucht, wie Modernisierung, Individualisierung und Mobilisierung die Raumaneignung und die Sozialisation von Kindern beeinflusst haben. Diese Faktoren werden als wesentliche Triebkräfte des Wandels im kindlichen Lebensraum betrachtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kindheit, Raumaneignung, Sozialisation, Lebensraumstudie, Muchow, Verinselung, Großstadt, Modernisierung, Individualisierung, 20. Jahrhundert, Hamburger Lebensraumstudie.
- Quote paper
- B.A. Viola Schneider (Author), 2005, Wandel der Kindheitsbedingungen im 20. Jahrhundert anhand der Hamburger Lebensraumstudie und dem Phänomen der Verinselung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70933