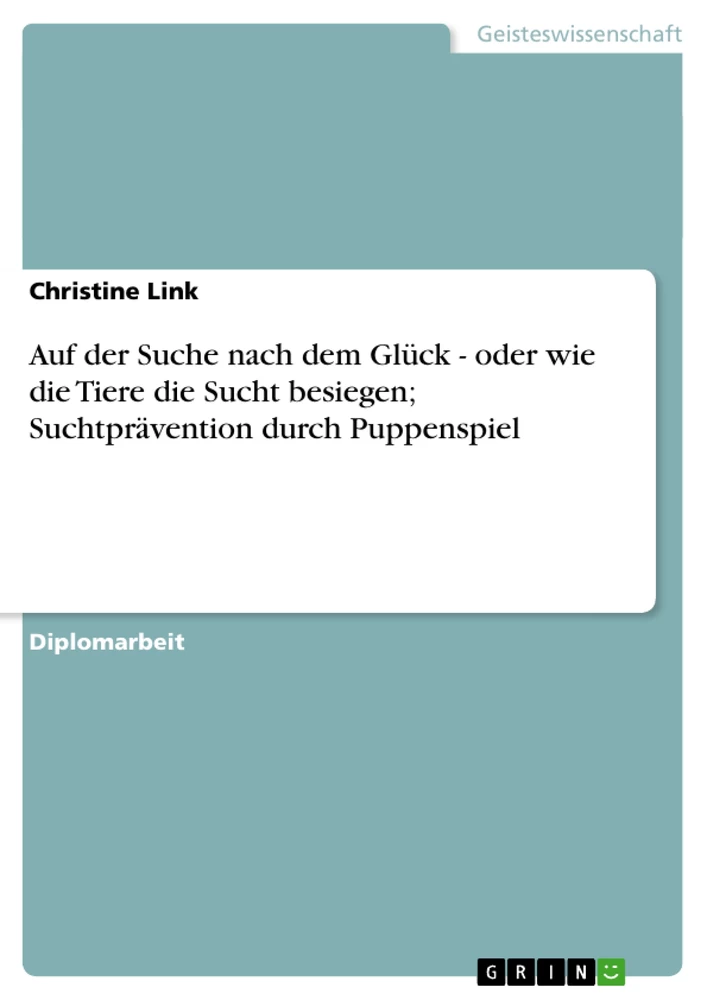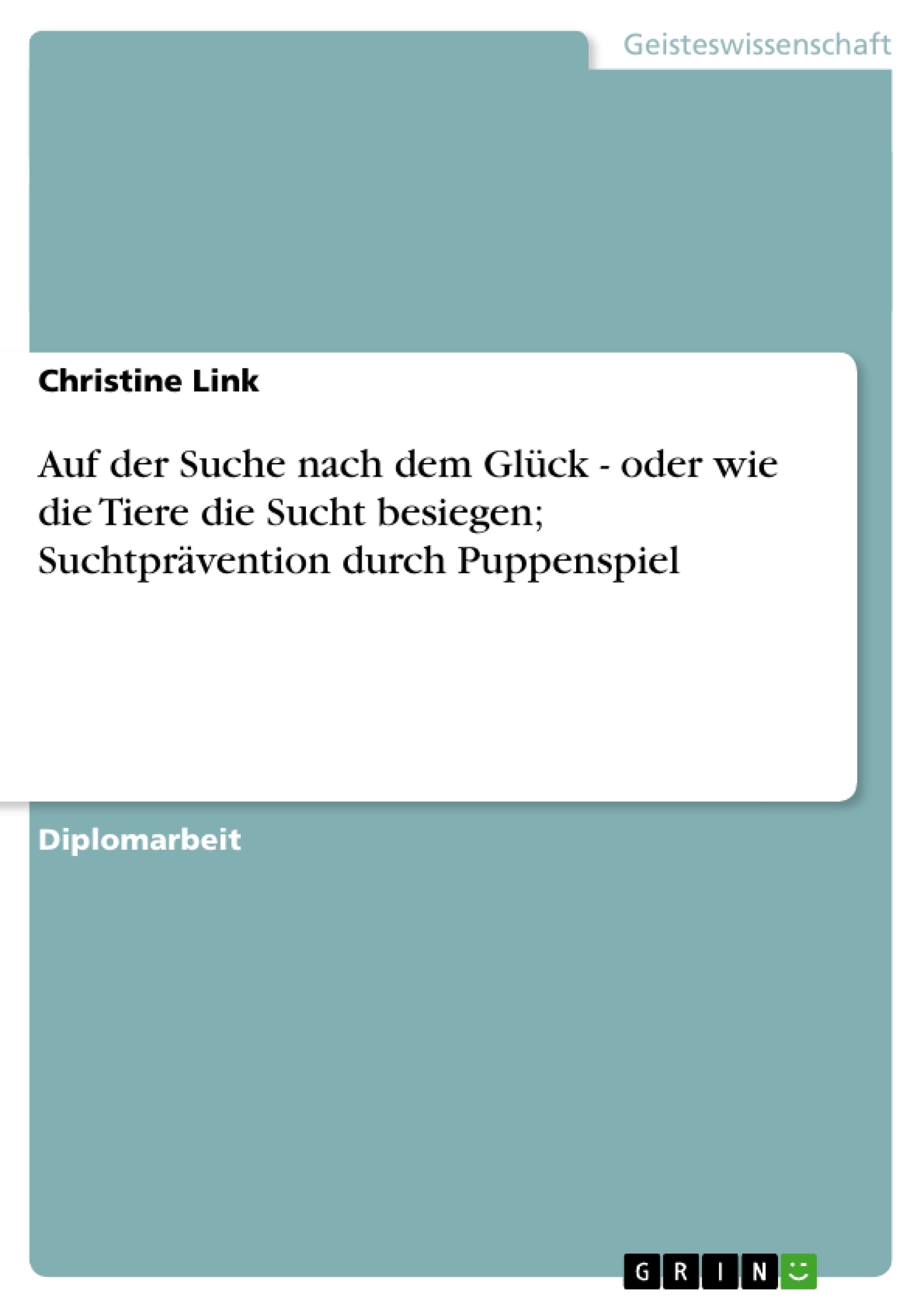In Deutschland leben schätzungsweise 120.000 bis 150.000 Opiatabhängige. Davon befinden sich knapp 60.000 in einer Substitutionsbehandlung. Weiterhin gelten rund 5 % aller Bundesbürger, inklusive Kinder und Jugendliche als suchtkrank. 250.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis ca. 25 Jahre sind stark suchtgefährdet. Berücksichtigt werden muss hier zusätzlich, die in den Angaben nicht enthaltende Dunkelziffer. Die oben erzählte Suchtgeschichte ist nur ein Beispiel für die Mannigfaltigkeit der Möglichkeiten suchtkrank zu werden. Die Gründe für Drogenkonsum und die bestehende Drogenaffinität unterliegt in den letzten 20 Jahren einer Trendwende: weg von dem Versuch aus der Gesellschaft auszusteigen, hin zu dem Wunsch an der Gesellschaft teilzuhaben, dem Leistungsdruck und den Anforderungen gerecht zu werden. „Keine macht den Drogen!“, dieser Slogan ist in aller Munde. Dahinter steckt die Absicht, eine Suchtprävention in Deutschland zu etablieren, die der fortschreitenden Entwicklung von Sucht und Abhängigkeit entgegenwirken will. Auf welchen Grundlagen dieses Vorhaben basiert, welche Gründe es für Drogenkonsum und Suchtmittelaffinität gibt, wo die Grenzen dieses Vorhabens liegen und was in Zukunft noch getan werden muss, ist Inhalt der vorliegenden Arbeit. Der in dieser Arbeit unternommene Versuch, Theorien und Strategien der Suchtprävention voneinander zu unterscheiden kann nur unzureichend gelingen, weil der Gegenstand „Sucht“ selbst eine Vielzahl von Perspektiven zulässt. Aus diesem Grund findet sich in dieser Arbeit lediglich eine Zusammenfassung der aussagekräftigsten oder verbreitetsten Modelle und Theorien in Bezug auf die Suchtentstehung und die Suchtprävention. Eingans wir die Frage nachdem was Sucht ist erläutert. Des weiteren werden bestehende Suchttheorien und Suchtursachen erläutert und nachfolgend die Konzepte zu den bekannten Suchtpräventionsschritten vorgestellt. Im Anschluss daran werden zwei Modellprojekte zur Suchtprävention bei Kindern und Jugendlichen vorgestellt und diskutiert.
Diese Arbeit befasst sich des weiteren mit den Untersuchungsergebnissen des durchgeführten Puppenspielprojekt zur Suchtprävention.
Dabei handelt es sich um ein Projekt, das von der Autorin der Arbeit konzipiert und mit insgesamt 523 Grundschülern aus Magdeburg und Umgebung durchgeführt worden ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. WAS IST SUCHT?
- 2.1. GEBRAUCH - MISSBRAUCH - ABHÄNGIGKEIT
- 2.2. SUCHTURSACHEN
- 2.3. WER WIRD SÜCHTIG?
- 2.3.1. Das 3-M-Modell
- 3. SUCHTPRÄVENTION
- 3.1. WAS IST SUCHTPRÄVENTION?
- 3.2. AUFGABEN UND ZIELE DER SUCHTPRÄVENTION
- 3.2.1. Präventionsschritte
- 3.3. MODELLE DER SUCHTPRÄVENTION IN DER JUGENDARBEIT
- 3.3.1. Modellprogramm „Mobile Drogenprävention“
- 3.3.2. „Kinder stark machen“
- 3.4. GRENZEN DER SUCHTPRÄVENTION
- 4. DAS PRÄVENTIONSPROJEKT „PUPPENSPIEL 2005“
- 5. FRAGESTELLUNG UND HYPOTHESEN
- 6. QUALITÄTSKRITERIEN FÜR EIN SUCHTPRÄVENTIONSSTÜCK
- 6.1. PROJEKTSKIZZE
- 6.1.1. Allgemeine Daten zum Projekt
- 6.1.2. Inhaltlicher Bericht
- 6.1.3. Theoretischer Hintergrund
- 7. METHODE
- 7.1. AUSWAHL UND BESCHREIBUNG DER STICHPROBE
- 7.2. FRAGEBOGEN UND UNTERSUCHUNGSABLAUF
- 7.3. AUSWERTUNG DER DATEN
- 8. ERGEBNISSE
- 8.1. WIRKUNG AUF DEN WISSENSSTAND
- 8.1.1. Mittelwertvergleich der gesamten Stichprobe
- 8.1.2. Geschlechtervergleich in Bezug auf den Wissensstand
- 8.1.3. Altersvergleich in Bezug auf den Wissensstand
- 8.2. ANTWORTVERHALTEN IN BEZUG AUF AUSGEWÄHLTE DROGEN UND SUCHTMITTEL
- 8.2.1. Suchtmittel: Koffein (Kaffee)
- 8.2.2. Suchtmittel: Alkohol
- 8.2.3. Suchtmittel: Cannabis („Kiffen“)
- 8.2.4. Suchtmittel: Nikotin (Rauchen)
- 8.2.5. Suchtmittel: Koffein (Cola)
- 8.2.6. Suchtmittel: Süßigkeiten
- 8.3. UNTERSUCHUNG DER EINSTELLUNG DES SOZIALEN UMFELDES
- 8.3.1. Suchtmittel: Koffein (Kaffee)
- 8.3.2. Suchtmittel: Alkohol
- 8.3.3. Suchtmittel: Cannabis („Kiffen“)
- 8.3.4. Suchtmittel: Nikotin (Rauchen)
- 8.3.5. Suchtmittel: Koffein (Cola)
- 8.3.6. Suchtmittel: Süßigkeiten
- 9. DISKUSSION DER VORLIEGENDEN ERGEBNISSE
- 10. HINWEISE ZU WEITERFÜHRENDEN UNTERSUCHUNGEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Wirksamkeit von Suchtprävention durch Puppenspiel. Ziel ist es, die Effektivität eines konkreten Präventionsprojekts zu evaluieren und Erkenntnisse für zukünftige Projekte zu gewinnen.
- Wirkung von Puppenspiel auf den Wissensstand zu Suchtmitteln bei Kindern und Jugendlichen
- Analyse des Antwortverhaltens bezüglich verschiedener Suchtmittel
- Untersuchung der Einstellungen des sozialen Umfelds zu Suchtmitteln
- Evaluation der Wirksamkeit des Präventionsprojekts „Puppenspiel 2005“
- Entwicklung von Qualitätskriterien für suchtpräventive Puppenstücke
Zusammenfassung der Kapitel
1. EINLEITUNG: Die Einleitung führt in das Thema Suchtprävention ein und beschreibt den Kontext der Arbeit. Sie begründet die Wahl des Puppenspiels als Präventionsmethode und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit frühzeitiger Interventionen und der Rolle von präventiven Maßnahmen in der Jugendarbeit.
2. WAS IST SUCHT?: Dieses Kapitel definiert den Begriff Sucht, differenziert zwischen Gebrauch, Missbrauch und Abhängigkeit und beleuchtet verschiedene Suchtursachen. Es wird das 3-M-Modell vorgestellt, welches die Entstehung von Sucht anhand von Faktoren wie Motivation, Gelegenheit und Möglichkeit erklärt. Die Kapitel befasst sich eingehend mit der Vielschichtigkeit des Suchtproblems und seiner komplexen Ursachen.
3. SUCHTPRÄVENTION: Hier werden Aufgaben und Ziele der Suchtprävention erläutert, verschiedene Präventionsmodelle vorgestellt (z.B. „Mobile Drogenprävention“, „Kinder stark machen“) und die Grenzen der Suchtprävention diskutiert. Es wird auf die Notwendigkeit ganzheitlicher Ansätze und die Berücksichtigung von Risikofaktoren eingegangen. Das Kapitel betont die Herausforderungen und die Bedeutung der individuellen Anpassung von Präventionsstrategien.
4. DAS PRÄVENTIONSPROJEKT „PUPPENSPIEL 2005“: Dieses Kapitel beschreibt das konkrete Puppenspielprojekt, das im Rahmen der Arbeit evaluiert wurde. Es werden die verwendeten Puppen, die Geschichte und die didaktischen Ansätze detailliert dargestellt. Die Beschreibung des Projekts legt den Grundstein für die anschließende Auswertung der Ergebnisse.
5. FRAGESTELLUNG UND HYPOTHESEN: Die Forschungsfragen und Hypothesen der Arbeit werden formuliert. Es wird klar dargelegt, welche Aspekte der Suchtprävention durch Puppenspiel untersucht werden sollen und welche Erwartungen an die Ergebnisse bestehen. Die formulierten Hypothesen liefern einen klaren Rahmen für die empirische Untersuchung.
6. QUALITÄTSKRITERIEN FÜR EIN SUCHTPRÄVENTIONSSTÜCK: In diesem Kapitel werden Kriterien für die Entwicklung eines effektiven suchtpräventiven Puppenstücks formuliert. Es werden inhaltliche, methodische und didaktische Aspekte berücksichtigt, die für den Erfolg eines solchen Projekts relevant sind. Die Kapitel bildet die methodische Grundlage für die Beurteilung des „Puppenspiel 2005“ Projektes.
7. METHODE: Die Methodik der Arbeit wird detailliert beschrieben, inklusive der Auswahl der Stichprobe, des Fragebogens und des Untersuchungsablaufs. Die gewählten Methoden werden begründet und ihre Eignung für die Forschungsfragen erläutert. Der Schwerpunkt liegt auf der Validität und Reliabilität der erhobenen Daten.
8. ERGEBNISSE: Die Ergebnisse der Untersuchung werden präsentiert. Es werden sowohl die Ergebnisse zur Wirkung des Puppenspiels auf den Wissensstand als auch die Ergebnisse zum Antwortverhalten bezüglich verschiedener Suchtmittel und die Einstellungen des sozialen Umfeldes dargestellt. Die Ergebnisse werden detailliert mit Tabellen und Grafiken belegt.
Schlüsselwörter
Suchtprävention, Puppenspiel, Kinder, Jugendliche, Drogen, Alkohol, Nikotin, Cannabis, Koffein, Evaluation, Wirksamkeit, Präventionsmodelle, Wissensstand, Einstellungen, Soziales Umfeld, Qualitätskriterien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Wirksamkeit von Suchtprävention durch Puppenspiel
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht die Wirksamkeit eines konkreten Suchtpräventionsprojekts, das mit Hilfe von Puppenspiel durchgeführt wurde. Es wird evaluiert, wie effektiv dieses Projekt den Wissensstand von Kindern und Jugendlichen zu Suchtmitteln verbessert und welche Einstellungen im sozialen Umfeld zu Suchtmitteln bestehen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition von Sucht, verschiedene Suchtursachen, Modelle der Suchtprävention, das bewertete Puppenspielprojekt ("Puppenspiel 2005"), die Entwicklung von Qualitätskriterien für suchtpräventive Puppenstücke, die Methodik der Untersuchung (inkl. Stichprobenauswahl und Fragebogen), sowie die Auswertung und Diskussion der Ergebnisse.
Welche konkreten Suchtmittel werden untersucht?
Die Untersuchung betrachtet den Konsum und die Einstellungen zu folgenden Suchtmitteln: Koffein (Kaffee und Cola), Alkohol, Cannabis, Nikotin und Süßigkeiten.
Welche Methoden wurden in der Studie angewendet?
Die Studie verwendet einen Fragebogen, um den Wissensstand, das Antwortverhalten bezüglich verschiedener Suchtmittel und die Einstellungen des sozialen Umfelds zu erfassen. Die Stichprobenauswahl und der Untersuchungsablauf werden detailliert in der Arbeit beschrieben. Die Daten werden mittels Mittelwertvergleichen und weiteren statistischen Methoden ausgewertet.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse zeigen die Wirkung des Puppenspiels auf den Wissensstand der Teilnehmer, differenziert nach Geschlecht und Alter. Darüber hinaus werden die Antwortverhalten bezüglich der verschiedenen Suchtmittel sowie die Einstellungen des sozialen Umfeldes analysiert und dargestellt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die Evaluierung der Wirksamkeit des Puppenspielprojekts "Puppenspiel 2005". Zusätzliche Ziele sind die Gewinnung von Erkenntnissen für zukünftige Suchtpräventionsprojekte und die Entwicklung von Qualitätskriterien für suchtpräventive Puppenstücke.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Was ist Sucht?, Suchtprävention, Das Präventionsprojekt „Puppenspiel 2005“, Fragestellung und Hypothesen, Qualitätskriterien für ein Suchtpräventionsstück, Methode, Ergebnisse, Diskussion der vorliegenden Ergebnisse und Hinweise zu weiterführenden Untersuchungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Suchtprävention, Puppenspiel, Kinder, Jugendliche, Drogen, Alkohol, Nikotin, Cannabis, Koffein, Evaluation, Wirksamkeit, Präventionsmodelle, Wissensstand, Einstellungen, Soziales Umfeld, Qualitätskriterien.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Fachkräfte in der Suchtprävention, Jugendarbeit, Pädagogik und für alle, die sich mit der Entwicklung und Evaluation von suchtpräventiven Maßnahmen befassen.
Wo finde ich die detaillierten Ergebnisse?
Die detaillierten Ergebnisse, inklusive Tabellen und Grafiken, sind im Kapitel "Ergebnisse" der vollständigen Diplomarbeit enthalten.
- Quote paper
- Dipl. Rehabilitationspsychologin Christine Link (Author), 2006, Auf der Suche nach dem Glück - oder wie die Tiere die Sucht besiegen; Suchtprävention durch Puppenspiel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70929