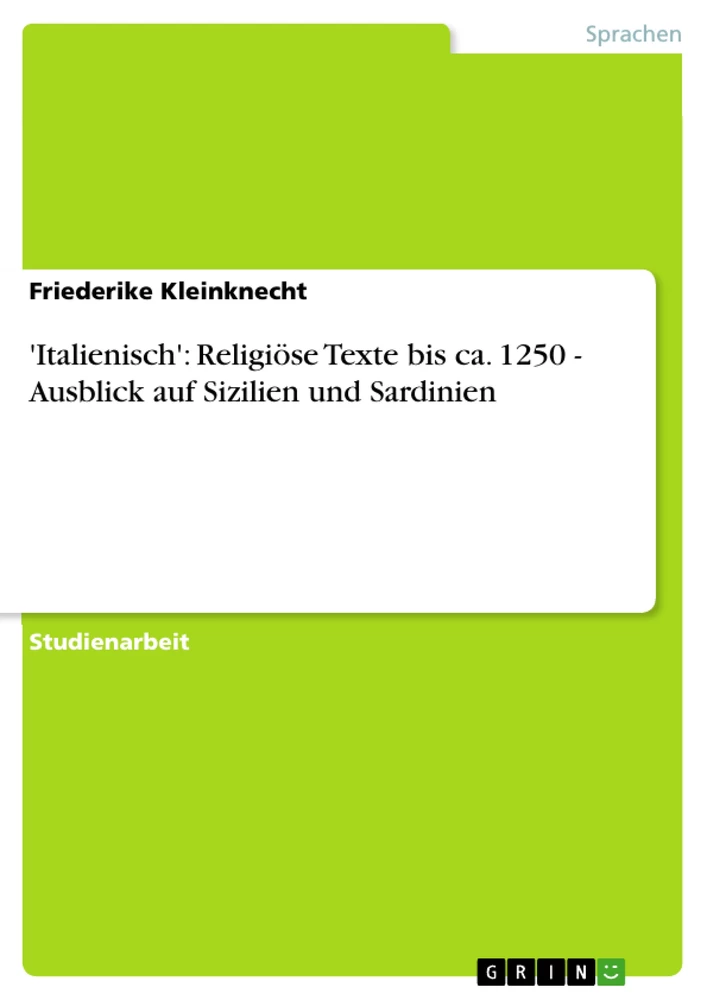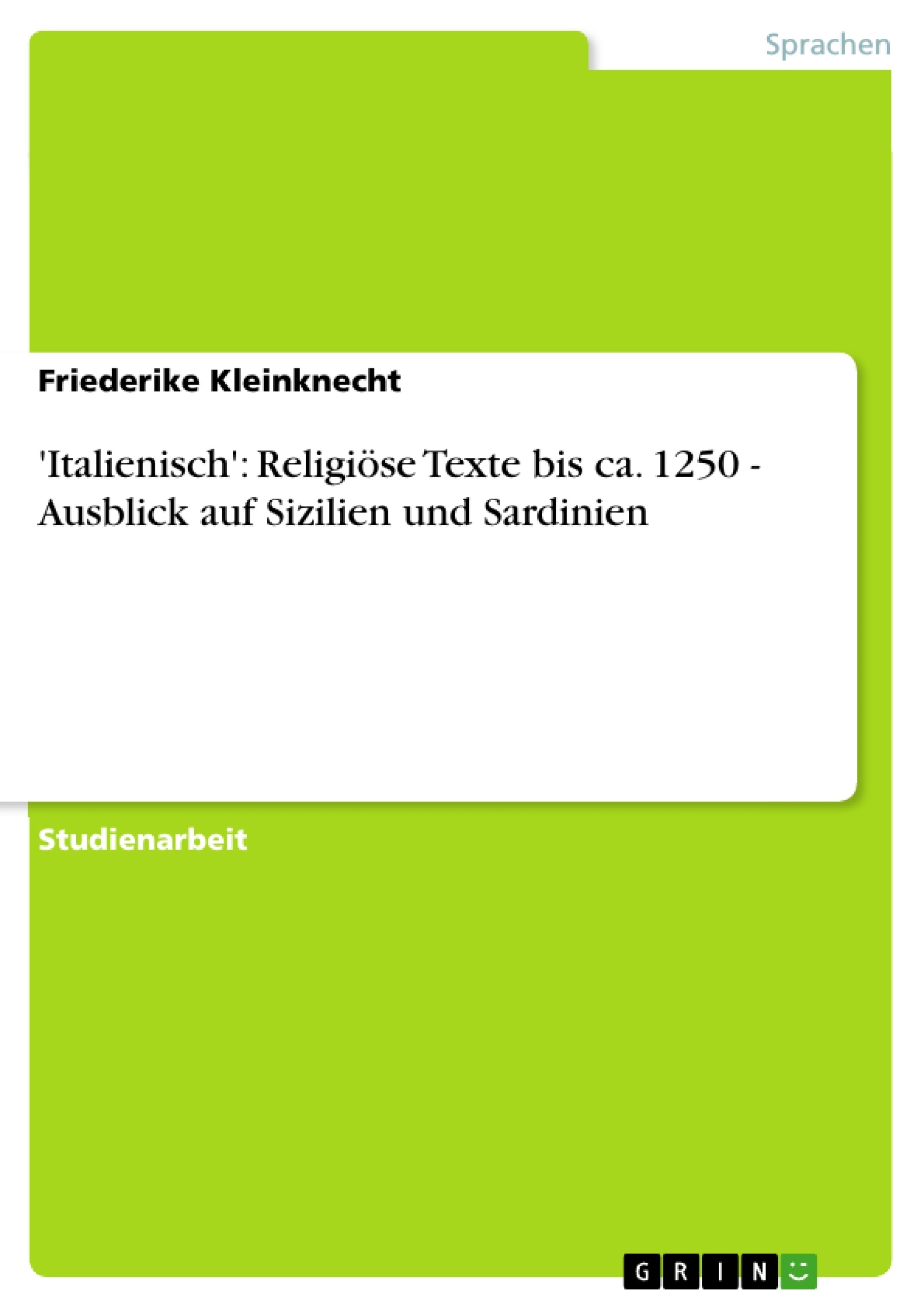In dieser Arbeit sollen vier der bekanntesten antiken „italienischen“ Texte vorgestellt werden, nämlich die Formula di confessione umbra, die Sermoni subalpini, der Ritmo cassinese sowie der Ritmo di Sant’Alessio. Der Begriff „Italienisch“ steht deswegen in Anführungszeichen, weil selbstverständlich im Mittelalter die italienische Sprache im heutigen Sinne noch nicht existierte; es gab lediglich eine Vielzahl von Dialekten auf dem Boden des heutigen Italien, die aus dem Vulgärlateinischen hervorgegangen waren und mit dem klassischen Latein in einem Diglossieverhältnis standen, wobei eine klare Funktionsteilung bestand: Das Latein, als Dachsprache fast ganz Europas, war die Sprache der Schriftlichkeit, während der Bereich der Volkssprache die Mündlichkeit war. Eben dieses Spannungsfeld zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit ist der Ansatzpunkt, der zum besseren Verständnis der hier behandelten Texte beitragen soll.
Es wird zunächst, in Anlehnung an Peter Koch (1993), auf die generelle Dynamik des Verhältnisses von Mündlichkeit und Schriftlichkeit eingegangen und einen darauf aufbauenden Klassifikationsansatz vorgestellt. Nach einem kurzen Überblick über die historische und sprachliche Situation im mittelalterlichen Italien folgt die genauere Untersuchung der oben aufgeführten Texte; anschließend wird noch ein Ausblick auf die Entwicklung der volkssprachlichen Schriftlichkeit in Sizilien und Sardinien gegeben. Im Anhang finden sich Abschriften und Faksimili der behandelten Texte sowie Karten von Italien und Sardinien.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Mediale und konzeptionelle Einordnung von Dokumenten und Sprachdenkmälern
- 2.1.1 Kategorie A: Verschriftete Mündlichkeit
- 2.1.2 Kategorie B: Listen
- 2.1.3 Kategorie C: Zum mündlichen Vortrag bestimmte Schriftlichkeit
- 2.1.4 Kategorie D: Linguistische Spannungsfelder und Kontraste
- 2.2 Historisch-linguistischer Hintergrund
- 2.2.1 Zur Geschichte
- 2.2.2 Zur Sprache
- 2.3 Formula di confessione umbra
- 2.4 Sermoni subalpini
- 2.5 Ritmo cassinese
- 2.6 Ritmo di Sant'Alessio
- 2.7 Sizilien: die Scuola Siciliana
- 2.8 Sardinien
- 2.1 Mediale und konzeptionelle Einordnung von Dokumenten und Sprachdenkmälern
- 3. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht frühe italienische Sprachdenkmäler im Spannungsfeld zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Ziel ist es, anhand ausgewählter Texte die Entwicklung der volkssprachlichen Schriftlichkeit im mittelalterlichen Italien zu beleuchten und die medialen und konzeptionellen Besonderheiten dieser Dokumente zu analysieren.
- Das Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit im mittelalterlichen Italien
- Die Klassifizierung mittelalterlicher Texte nach medial-konzeptionellen Kriterien
- Die sprachliche und historische Situation im mittelalterlichen Italien
- Analyse ausgewählter religiöser Texte (Formula di confessione umbra, Sermoni subalpini, Ritmo cassinese, Ritmo di Sant'Alessio)
- Ausblick auf die Entwicklung der volkssprachlichen Schriftlichkeit in Sizilien und Sardinien
Zusammenfassung der Kapitel
2.1 Mediale und konzeptionelle Einordnung von Dokumenten und Sprachdenkmälern: Dieses Kapitel präsentiert einen methodischen Ansatz zur Klassifizierung mittelalterlicher italienischer Texte. Es basiert auf der Arbeit von Peter Koch und unterscheidet vier Kategorien, die die Beziehung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit berücksichtigen: verschriftete Mündlichkeit, Listen, zum mündlichen Vortrag bestimmte Schriftlichkeit und linguistische Spannungsfelder. Der Ansatz berücksichtigt die Entstehungsbedingungen und kommunikativen Merkmale der Texte und geht über rein chronologische oder geographische Klassifizierungen hinaus, indem er die Diskurstraditionen und das linguistische Bewusstsein der Schreiber in den Mittelpunkt stellt. Die Schwierigkeiten, mittelalterliche Texte anhand heutiger Sprachstandards zu kategorisieren, werden ebenfalls diskutiert.
2.2 Historisch-linguistischer Hintergrund: Dieser Abschnitt liefert den notwendigen historischen und sprachlichen Kontext für die Analyse der ausgewählten Texte. Er beschreibt die Entwicklung der italienischen Sprache im Mittelalter, wobei der Diglossie zwischen Latein (Sprache der Schriftlichkeit) und den verschiedenen Vulgärlatein-Dialekten (Sprache der Mündlichkeit) im Fokus steht. Die geschichtliche Entwicklung und der sprachliche Zustand Italiens im betrachteten Zeitraum werden detailliert dargestellt, um ein fundiertes Verständnis für die Entstehung und die sprachlichen Besonderheiten der folgenden Texte zu schaffen.
2.3 Formula di confessione umbra: Hier wird die "Formula di confessione umbra" im Detail behandelt. Die Zusammenfassung würde ihre sprachliche Besonderheiten, ihren Kontext innerhalb religiöser Praktiken und ihre Bedeutung für die Entwicklung der italienischen Volkssprache erörtern. Ein Vergleich mit anderen ähnlichen Texten aus dem gleichen Zeitraum und Region würde die Relevanz und Einzigartigkeit dieses Textes aufzeigen. Die Analyse würde sich auf die sprachlichen Merkmale konzentrieren, die den Übergang von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit beleuchten.
2.4 Sermoni subalpini: Die Zusammenfassung dieses Kapitels befasst sich mit den "Sermoni subalpini", Analysiert werden ihre sprachlichen Eigenschaften, ihre Funktion im religiösen Kontext und ihre Bedeutung als Beispiele für die Herausbildung einer volkssprachlichen Schriftlichkeit. Der Fokus liegt auf der Synthese des Kapitels – die verschiedenen Aspekte der Sermoni werden zu einem kohärenten Bild zusammengefügt, das deren Rolle innerhalb der Entwicklung der frühen italienischen Literatur aufzeigt.
2.5 Ritmo cassinese & 2.6 Ritmo di Sant'Alessio: Diese beiden Kapitel behandeln die "Ritmo cassinese" und den "Ritmo di Sant'Alessio". Die Zusammenfassung analysiert die literarischen und sprachlichen Merkmale beider Texte, vergleicht sie miteinander und setzt sie in den Kontext der religiösen Lyrik des Mittelalters. Die Analyse würde aufzeigen, wie diese Texte die Eigenheiten mündlicher Traditionen in einer schriftlichen Form wiedergeben und welche sprachlichen Innovationen sie zeigen. Die Bedeutung dieser Texte für das Verständnis des Übergangs von Mündlichkeit zu Schriftlichkeit wird hervorgehoben.
2.7 Sizilien: die Scuola Siciliana & 2.8 Sardinien: Diese Abschnitte geben einen Ausblick auf die Entwicklung der volkssprachlichen Schriftlichkeit in Sizilien und Sardinien. Die Zusammenfassung wird die Besonderheiten der literarischen Entwicklungen in diesen Regionen im Vergleich zum italienischen Festland erörtern, wobei der Fokus auf den Einfluss der jeweiligen sprachlichen und kulturellen Kontexte auf die Entstehung und Gestaltung volkssprachlicher Texte gelegt wird. Der Vergleich erlaubt, die Vielfalt der Entwicklungen in den unterschiedlichen Regionen Italiens zu zeigen.
Schlüsselwörter
Mündlichkeit, Schriftlichkeit, mittelalterliches Italien, Sprachdenkmäler, Volkssprache, Latein, Diglossie, Formula di confessione umbra, Sermoni subalpini, Ritmo cassinese, Ritmo di Sant’Alessio, Scuola Siciliana, Sardinien, Diskurstraditionen, Medialität, Konzeption.
Häufig gestellte Fragen zu "Frühe italienische Sprachdenkmäler"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht frühe italienische Sprachdenkmäler aus dem Mittelalter und analysiert deren Entwicklung im Spannungsfeld zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Der Fokus liegt auf der Analyse ausgewählter Texte, um die Entstehung und Besonderheiten der volkssprachlichen Schriftlichkeit in dieser Periode zu beleuchten.
Welche Texte werden untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene Texte, darunter die "Formula di confessione umbra", die "Sermoni subalpini", den "Ritmo cassinese", den "Ritmo di Sant'Alessio", sowie die Entwicklungen in Sizilien (Scuola Siciliana) und Sardinien. Diese Texte repräsentieren unterschiedliche Genres und Regionen, um ein breiteres Bild der sprachlichen Entwicklung zu zeichnen.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Klassifizierung der Texte erfolgt nach einem methodischen Ansatz, der die Beziehung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit berücksichtigt. Dieser Ansatz, angelehnt an die Arbeit von Peter Koch, unterscheidet vier Kategorien: verschriftete Mündlichkeit, Listen, zum mündlichen Vortrag bestimmte Schriftlichkeit und linguistische Spannungsfelder. Die Analyse berücksichtigt Entstehungsbedingungen, kommunikative Merkmale und Diskurstraditionen.
Welchen historischen und linguistischen Kontext liefert die Arbeit?
Die Arbeit bietet einen detaillierten historischen und linguistischen Hintergrund, der die Entwicklung der italienischen Sprache im Mittelalter, insbesondere die Diglossie zwischen Latein und den verschiedenen Vulgärlatein-Dialekten, beleuchtet. Dieser Kontext ist essentiell für das Verständnis der Entstehung und der sprachlichen Besonderheiten der analysierten Texte.
Wie werden die einzelnen Texte analysiert?
Für jeden Text (Formula di confessione umbra, Sermoni subalpini, Ritmo cassinese, Ritmo di Sant'Alessio) werden sprachliche Besonderheiten, der Kontext innerhalb religiöser Praktiken und die Bedeutung für die Entwicklung der italienischen Volkssprache erörtert. Vergleiche mit ähnlichen Texten und die Analyse der Merkmale des Übergangs von Mündlichkeit zur Schriftlichkeit bilden zentrale Aspekte der Analyse.
Was ist das Ergebnis der Analyse der sizilianischen und sardischen Texte?
Die Abschnitte zu Sizilien (Scuola Siciliana) und Sardinien bieten einen Vergleich der Entwicklungen der volkssprachlichen Schriftlichkeit in diesen Regionen mit dem italienischen Festland. Der Fokus liegt auf dem Einfluss der jeweiligen sprachlichen und kulturellen Kontexte auf die Entstehung und Gestaltung der Texte. Der Vergleich verdeutlicht die Vielfalt der Entwicklungen in den verschiedenen Regionen Italiens.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist es, die Entwicklung der volkssprachlichen Schriftlichkeit im mittelalterlichen Italien anhand ausgewählter Texte zu beleuchten und die medialen und konzeptionellen Besonderheiten dieser Dokumente zu analysieren. Die Arbeit trägt zum Verständnis des komplexen Verhältnisses von Mündlichkeit und Schriftlichkeit in dieser Periode bei.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Mündlichkeit, Schriftlichkeit, mittelalterliches Italien, Sprachdenkmäler, Volkssprache, Latein, Diglossie, Formula di confessione umbra, Sermoni subalpini, Ritmo cassinese, Ritmo di Sant’Alessio, Scuola Siciliana, Sardinien, Diskurstraditionen, Medialität, Konzeption.
- Quote paper
- M.A. Friederike Kleinknecht (Author), 2004, 'Italienisch': Religiöse Texte bis ca. 1250 - Ausblick auf Sizilien und Sardinien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70671