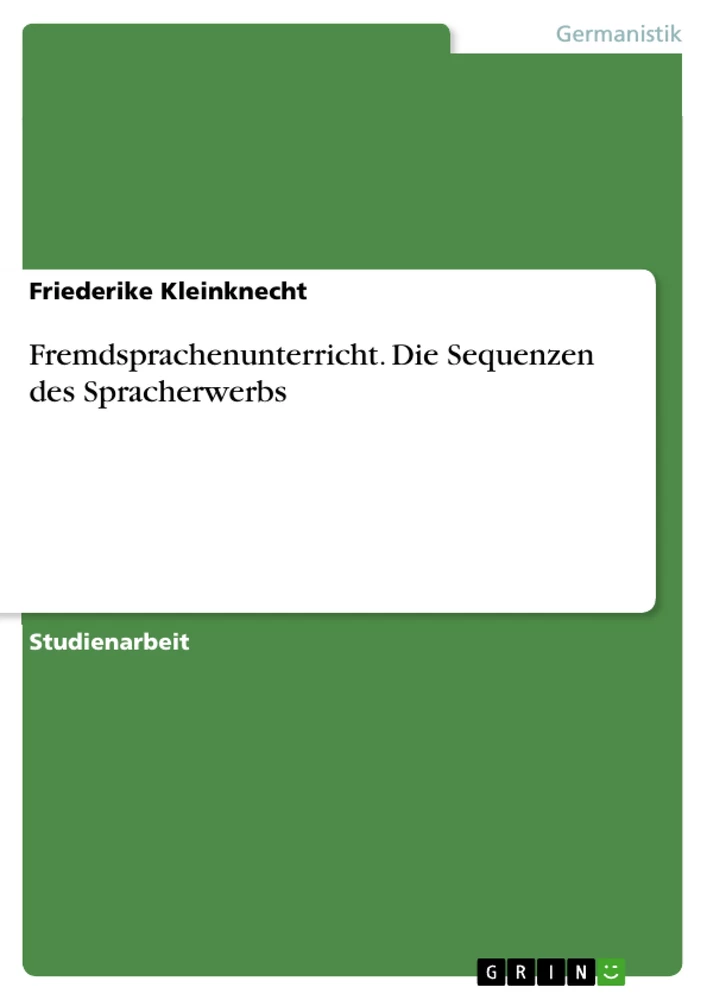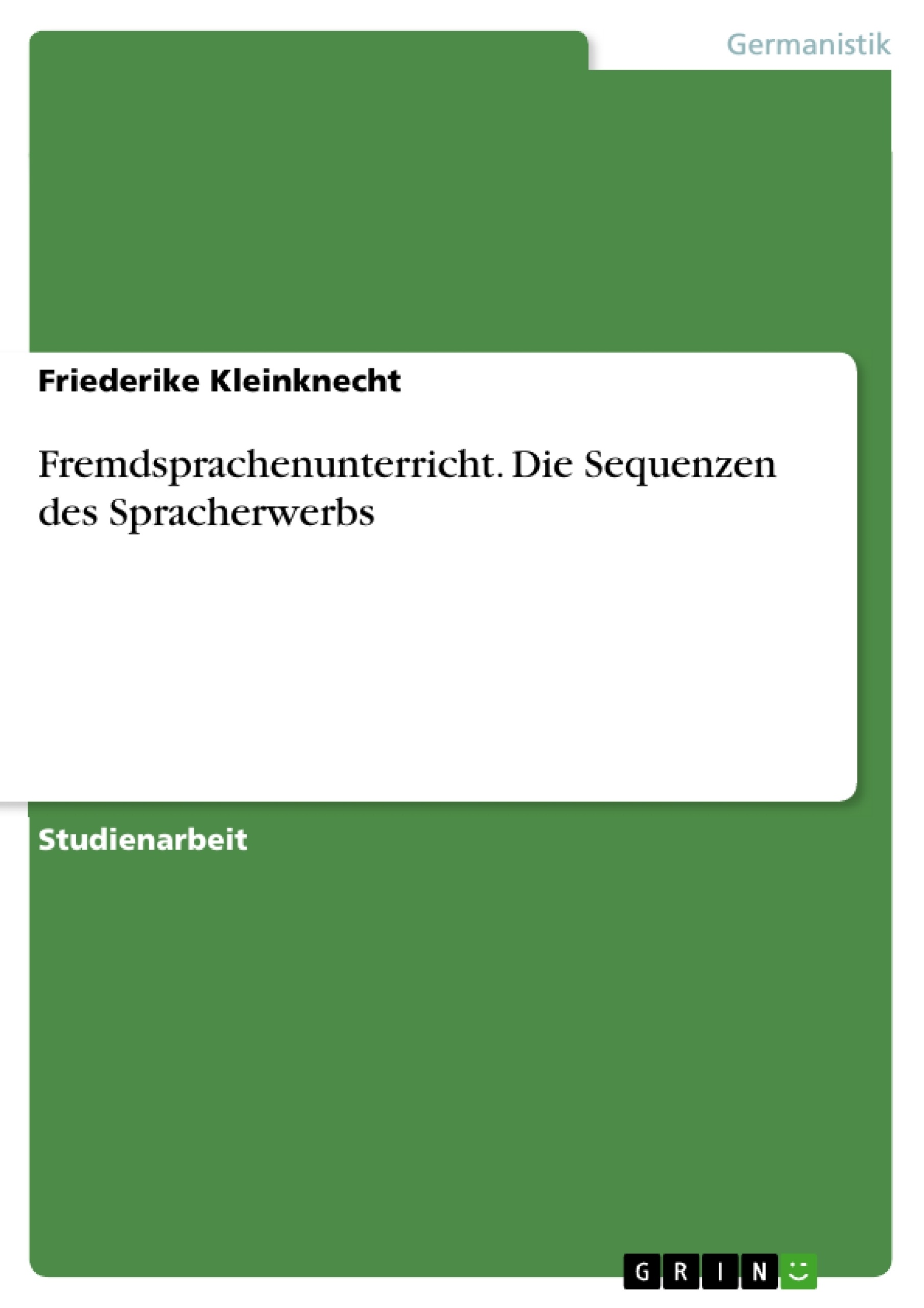Das (gesteuerte oder ungesteuerte) Erlernen einer Fremdsprache ist ein äußerst komplexer Prozess, der auf vielerlei Arten begonnen werden kann, der verschiedene Ausgänge haben kann und zu dessen Beschreibung und Erklärung eine Vielzahl von Aspekten zu berücksichtigen ist. Einer dieser Aspekte ist die Annahme, dass der Spracherwerb in invarianten Sequenzen vonstatten geht: die Theorie der Spracherwerbsstufen.
Diese Theorie ist in der Sprachlehr- und -lernforschung seit den 1970er Jahren bekannt. Die Details, etwa die Gültigkeit der Ergebnisse für die verschiedenen Strukturbereiche und die psycholinguistischen Grundlagen der Sequenzen sowie die praktische Anwendbarkeit im Fremdsprachenunterricht, sind z.T. nach wie vor umstritten. Während bestimmte Sequenzen, etwa in Bezug auf die Reihenfolge des Erwerbs der deutschen Wortstellung, als empirisch abgesichert gelten können, wurde für andere erst wenig Evidenz gefunden.
In der Frage nach dem Warum dieser Reihenfolge, wo sie denn als gegeben hingenommen wird, spiegelt sich die althergebrachte Diskussion zwischen den verschiedenen Strömungen der Wissenschaftstradition wider. Einige suchen die Ursachen in den Gegebenheiten einer Universalgrammatik, die bestimmte Parameter beinhaltet, die jeweils in einer bestimmten Reihenfolge aktiviert werden müssen; andere führen sie eher auf die neuronale Struktur des menschlichen Gehirns und auf die Natur der Sprachverarbeitungsprozesse im Gehirn oder auf die kognitiv-intellektuelle Entwicklung allgemein zurück.
Die Theorie der Spracherwerbssequenzen wird zunächst in den allgemeinen Kontext der Wissenschaftsgeschichte gestellt, um die theoretischen Rahmenbedingungen zu klären, auf denen sie basiert bzw. von denen sie sich kontrastiv abhebt.
In der Folge wird im Detail nachgezeichnet, wie diese Theorie von einem ihrer wichtigsten Vertreter, Manfred Pienemann, entwickelt und fortgeführt wurde: vom Multidimensionalen Modell über die Teachability Theory zur Processability Theory. Dabei wird festgestellt, welche Aspekte des Spracherwerbs damit erklärt und vorhergesagt werden könne, und auf welche Weise.
Zu guter Letzt wird die praktische Relevanz der Erwerbssequenzen im Fremdsprachenunterricht diskutiert, d.h. die Möglichkeit und die Modalitäten ihrer Einbeziehung gerade in ein kommunikativ-interkulturell ausgerichtetes Curriculum.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Theorie der Erwerbssequenzen im Kontext der Wissenschaftsgeschichte
- Theorien des L1-Erwerbs
- Behaviorismus und Funktionalismus
- Nativismus und Universalgrammatik
- Kognitivismus und Konstruktivismus
- Theorien und Methoden des Fremdsprachenunterrichts
- Der ungesteuerte L2-Erwerb
- Das Heidelberger Projekt und das Kieler Projekt
- Die ZISA-Studie
- L1 vs. L2
- Theorien des L1-Erwerbs
- Spracherwerbsstufen: Vom Multidimensionalen Modell zur Processability Theory
- Die ZISA-Studie und das Multidimensionale Modell
- Die Teachability Theory
- Die Processability Theory
- Spracherzeugung und Sprachverarbeitung
- Der Hypothesenraum
- Generative Entrenchment
- Die Steadyness Hypothesis
- Universalität des PT-Ansatzes
- Nicht-verarbeitungsbezogene Variablen
- Konsequenzen für Praxis und Forschung
- Das Lernbarkeitsproblem: PT vs. Markiertheitstheorien
- Erkenntnisse über die Natur des Spracherwerbs
- Praktische Anwendbarkeit
- Verzicht auf Steuerung
- Progression gemäß den Erwerbssequenzen
- Der Input
- Output und Fehleranalyse
- Grammatikprogression
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Theorie der Spracherwerbssequenzen, die besagt, dass der Spracherwerb in festen Abfolgen stattfindet. Es werden die historischen Wurzeln der Theorie, verschiedene theoretische Ansätze und die Entwicklung der Processability Theory von Manfred Pienemann dargestellt. Darüber hinaus werden die praktischen Implikationen für den Fremdsprachenunterricht diskutiert.
- Die historischen Wurzeln der Spracherwerbssequenzen
- Die Entwicklung der Processability Theory
- Die Erklärungsansätze für die Abfolgen des Spracherwerbs
- Die Anwendung der Theorie im Fremdsprachenunterricht
- Die Relevanz der Theorie für ein kommunikativ-interkulturell ausgerichtetes Curriculum
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Theorie der Spracherwerbssequenzen vor und erläutert ihre Relevanz für die Sprachlehr- und Sprachlernforschung.
- Die Theorie der Erwerbssequenzen im Kontext der Wissenschaftsgeschichte: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über verschiedene Theorien des L1-Erwerbs, wie z.B. Behaviorismus, Nativismus und Kognitivismus. Es werden auch die relevanten Ansätze zur Theoriebildung im Fremdsprachenunterricht und die Besonderheiten des ungesteuerten L2-Erwerbs diskutiert.
- Spracherwerbsstufen: Vom Multidimensionalen Modell zur Processability Theory: Dieses Kapitel fokussiert auf die Entwicklung der Processability Theory von Manfred Pienemann. Es werden wichtige Aspekte der Theorie, wie z.B. das Multidimensionale Modell, die Teachability Theory und die Kernaussagen der Processability Theory, erläutert.
- Konsequenzen für Praxis und Forschung: Dieses Kapitel beleuchtet die Auswirkungen der Processability Theory auf Forschung und Praxis. Es werden wichtige Themen, wie z.B. das Lernbarkeitsproblem, die Erkenntnisse über die Natur des Spracherwerbs, die praktische Anwendbarkeit der Theorie und die Implikationen für den Fremdsprachenunterricht, behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die folgenden Schlüsselwörter: Spracherwerbssequenzen, L1-Erwerb, L2-Erwerb, Processability Theory, Multidimensionales Modell, Teachability Theory, Fremdsprachenunterricht, Lernbarkeit, Sprachverarbeitung, Sprachproduktion, Input, Output, Fehleranalyse, Grammatikprogression.
- Quote paper
- M.A. Friederike Kleinknecht (Author), 2006, Fremdsprachenunterricht. Die Sequenzen des Spracherwerbs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70669