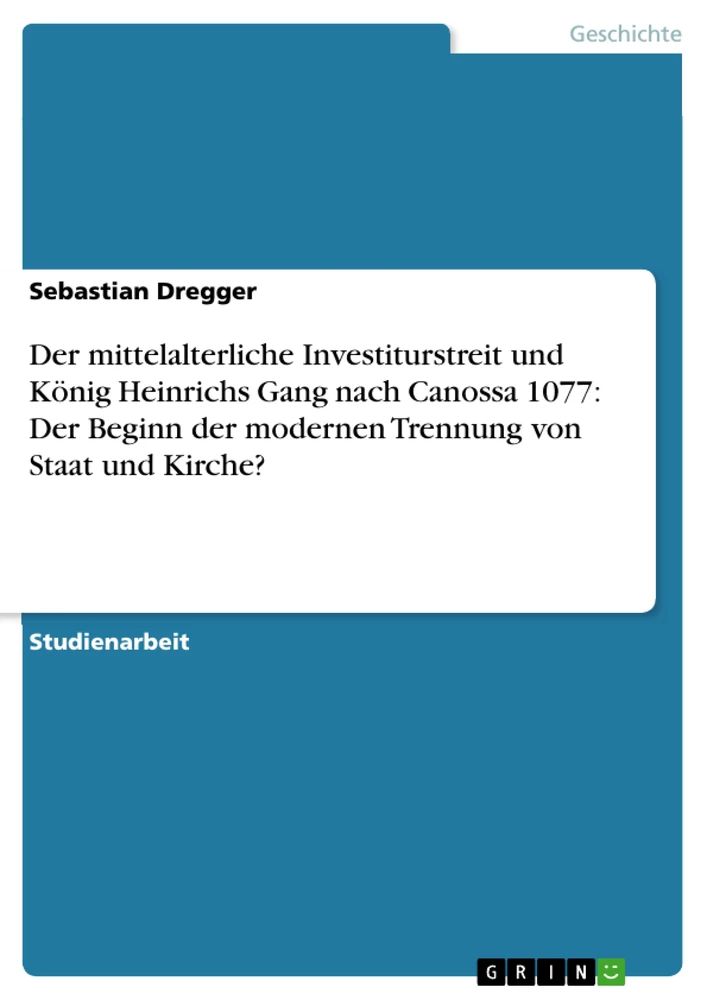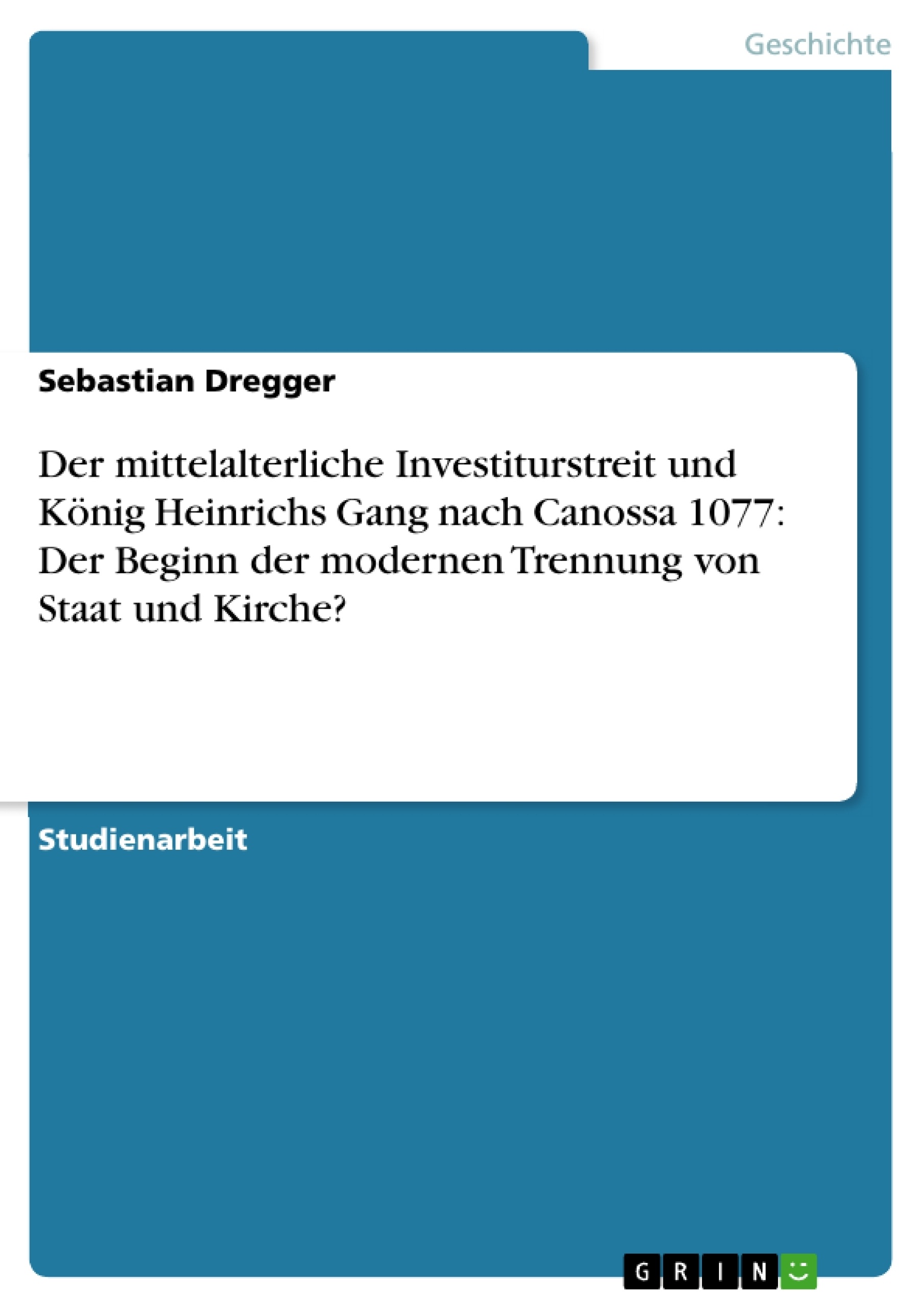Die Arbeit setzt sich zentral mit der Frage auseinander, ob im Investiturstreit und dem Canossagang der Beginn der modernen Trennung von Staat und Kirche liegt. Um diese Frage zu beantworten, werden die damaligen Ereignisse sowie der Stand der mediävistischen Forschung zum Thema "Canossa" bezogen auf diese Frage dargestellt. Dabei wird der grundlegende Unterschied aufgezeigt, der zwischen dem heutigen Verständnis der Trennung von Staat und Kirche und den mittelalterlichen Ansätzen dazu besteht.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Ereignisschilderung
- A. Die Legende von der Demütigung und Unterwerfung der weltlichen Macht durch den Papst im Zusammenhang der Ereignisse des Jahres 1077
- B. Die Erklärung für den Konflikt zwischen Königtum und Papsttum
- 1) Das veränderte Selbstverständnis des Königtums
- 2) Das veränderte Selbstverständnis des Papsttums - Vom primus inter pares unter den Bischöfen zum absoluten Papsttum
- 3) Die weitere Eskalation des Konfliktes zwischen Papsttum und Königtum nach dem Canossagang
- 4) Die Beendigung des Konfliktes durch das Wormser Konkordat
- C. Die aktuelle Deutung des Canossaganges – Canossa als Beginn der modernen Trennung von Staat und Kirche
- III. Der Stand der mediävistischen Forschung zum Themenkomplex „Canossa“
- A. Die Argumentationsweise des Autors
- 1) Die Argumentation gegenüber dem mediävistischen Fachpublikum als Adressanten
- 2) Die Argumentation gegenüber dem Laienpublikum als Adressaten
- B. Einordnung des Buches in den Stand der Forschung
- 1) Untersuchung des Canossaganges im Hinblick auf die mittelalterliche Welt vs. Die neuzeitliche Wirkungsgeschichte des Canossaganges
- 2) Personen- und ereignisgeschichtliche Betrachtungsweise vs. Strukturgeschichtliche Betrachtungsweise des Canossaganges
- 3) Innerhalb der strukturgeschichtlichen Betrachtungsweise: Sozioökonomische Faktoren vs. Ideelle Faktoren als geschichtliche Bestimmungsgrößen
- A. Die Argumentationsweise des Autors
- IV. Die Prüfung der Canossa- Interpretationen
- A. Canossa - Die Unterwerfung eines „deutschen“ Königs durch einen „römischen“ Papst?
- B. Canossa - Das Ergebnis eines jeweils neuen königlichen sowie päpstlichen Amtsverständnisses im 11.Jhd.?
- C. Canossa - Der Beginn der modernen Trennung von Staat und Kirche?
- 1) Definitorische und methodische Mängel der These
- 2) Die mittelalterlichen „Ansätze“ der Trennung von Staat und Kirche: bloße organisatorische Autonomie der Kirche als Institution gegenüber dem Staat
- 3) Das heutige Verständnis der „Trennung von Staat und Kirche“: die grundrechtlich verbürgte Religionsfreiheit des Einzelnen gegenüber Staat und Kirche als Institutionen
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem mittelalterlichen Investiturstreit, der in König Heinrichs Canossagang 1077 gipfelte. Der Autor analysiert verschiedene Interpretationen dieses historischen Ereignisses, darunter die Sichtweise des 19. Jahrhunderts, die den Canossagang als Demütigung des deutschen Königs durch den römischen Papst betrachtet, sowie die aktuelle Debatte in Deutschland über das Verhältnis von Staat und Kirche. Darüber hinaus untersucht er Weinfurters Interpretation des Investiturstreits, die einen grundlegenden Wandel im Amtsverständnis des Königtums und des Papsttums im 11. Jahrhundert als Ursache des Konflikts sieht.
- Die verschiedenen Interpretationen des Canossagangs
- Die Rolle des Investiturstreits in der historischen Entwicklung des Verhältnisses von Staat und Kirche
- Die Frage nach dem Beginn der modernen Trennung von Staat und Kirche
- Das sich verändernde Selbstverständnis des Königtums und des Papsttums im 11. Jahrhundert
- Die Analyse von Weinfurters Werk im Kontext der mediävistischen Forschung zum Thema „Canossa“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die drei zentralen Interpretationen des Canossagangs vor, die in der Arbeit untersucht werden sollen. Anschließend wird die Argumentationsweise des Autors Weinfurter und die Einordnung seines Buches in den Stand der Forschung diskutiert. Kapitel III analysiert die verschiedenen Interpretationen des Canossagangs, die sich auf die Rolle des Investiturstreits in der Entwicklung des Verhältnisses von Staat und Kirche konzentrieren.
Schlüsselwörter
Investiturstreit, Canossagang, König Heinrich IV., Papst Gregor VII., Trennung von Staat und Kirche, Mittelalter, Mediävistik, Weinfurter, Selbstverständnis des Königtums, Selbstverständnis des Papsttums, moderne Interpretationen, historische Deutung.
- Quote paper
- Sebastian Dregger (Author), 2006, Der mittelalterliche Investiturstreit und König Heinrichs Gang nach Canossa 1077: Der Beginn der modernen Trennung von Staat und Kirche?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70653