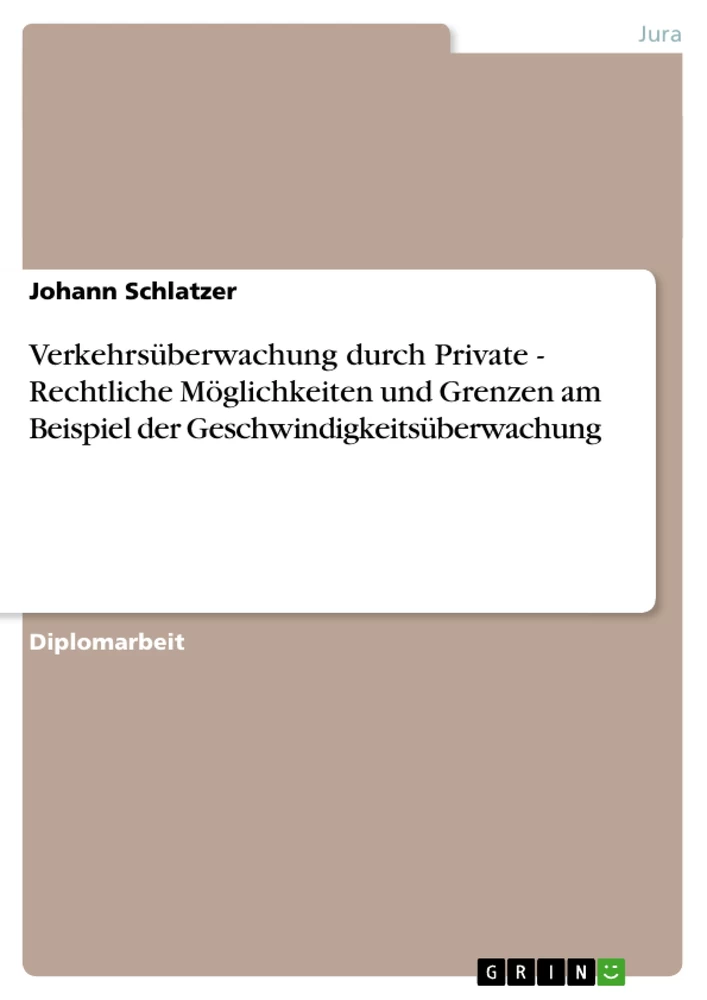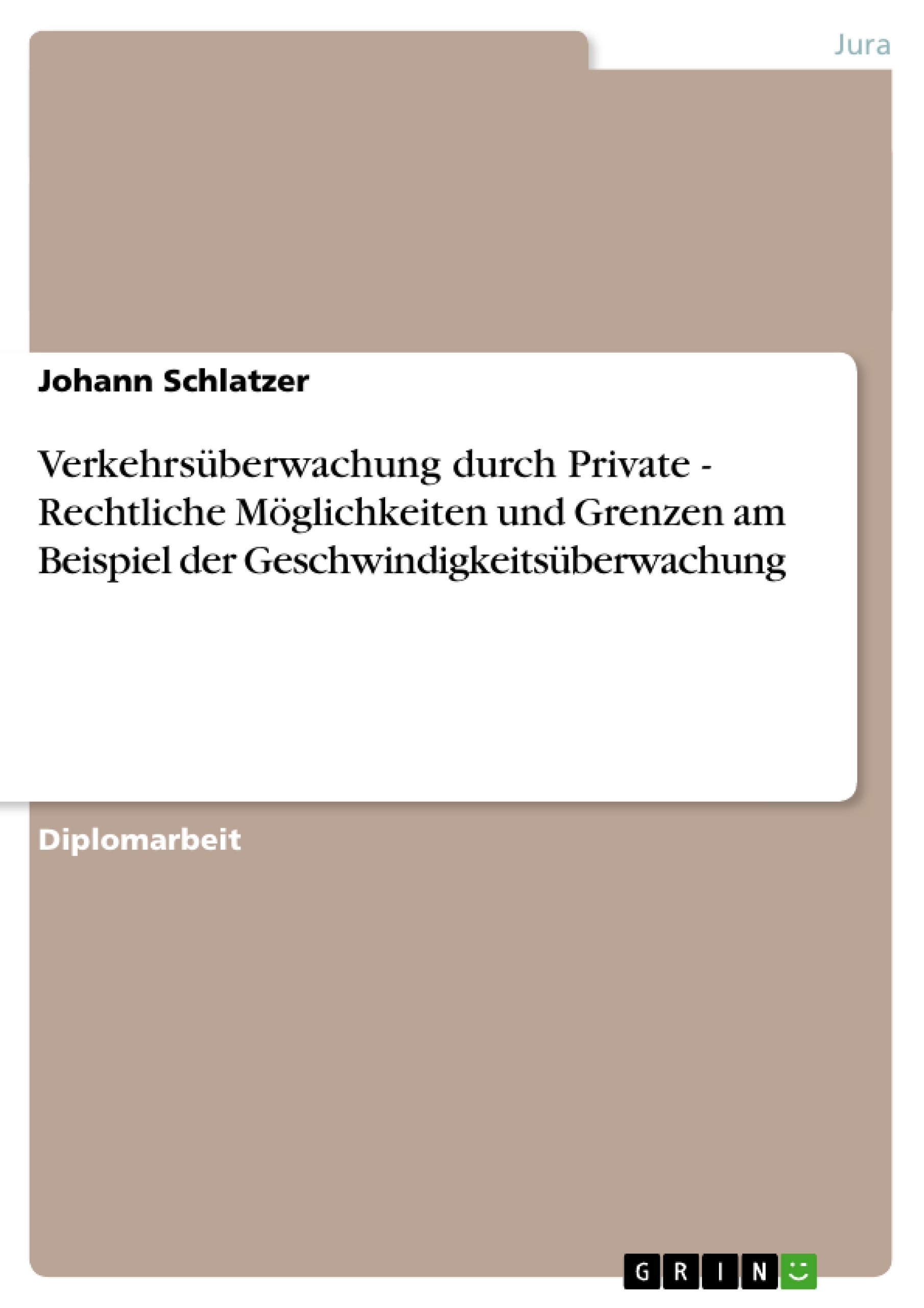Da die Fragestellung rund um die Möglichkeit und Erlaubtheit der Einbindung „Privater“ in ein Verkehrsüberwachungskonzept auf kommunaler Ebene einer gewissen Aktualität nicht entbehrt und andererseits Vorhaben rund um Beleihung, Ausgliederung und Privatisierung immer wieder neue Fragen rechtlicher Natur aufwerfen, widmet sich der Autor der vorliegenden Diplomarbeit den rechtlichen und rechtspolitischen Aspekten rund um die Beteiligung von Privaten in der öffentlichen Verwaltung, speziell im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung auf öffentlichen Straßen. Im Rahmen der Erörterungen zeigt er Möglichkeiten und Grenzen der Einbindung „Privater“ auf.
Nach einer detaillierten Aufarbeitung der verfassungsrechtlichen Grundlagen geht der Autor dazu über, Begriffe zu definieren und zuzuordnen, um anschließend in die verwaltungs(straf)rechtliche Systematik, in die die Geschwindigkeitsüberwachung eingreift, vorzudringen. Danach behandelt er die verschiedenen Möglichkeiten zur Einbindung von „Privaten“, auch anhand von Beispielen aus der Praxis (zB Stadt Graz). Im Resümee kann der Leser durch diese Vorgehensweise neben Antworten auf die Fragestellung auch einen Spiegel der Komplexität des Rechtsbereichs „Straßenverkehr“ und der damit verbundenen Probleme finden. Nicht zuletzt deshalb legt der Autor während seiner gesamten Ausführungen großen Wert darauf, den „roten Faden“ nicht zu verlieren.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- I Kompetenzfragen
- I. Allgemeines
- I.I. Kompetenzverteilung nach Art 10 bis 15 B-VG
- I.2. Die Interpretation der Kompetenznormen
- 2. Die Kompetenzlage auf dem Gebiet des Straßenwesens
- 2.I. Die Kompetenzlage während der Monarchie
- 2.2. Der Übergang zur bundesstaatlichen Kompetenzordnung (1920/25)
- 2.3. Die Novellen 1925 und 1929
- 2.4. Die Verfassung 1934
- 2.5. Die Wiederherstellung des österreichischen Rechts und seine Weiterentwicklung in kompetenzrechtlicher Sicht
- 2.6. Bundesverfassungsnovelle 1960
- II Abgrenzung, Begriffsbestimmung und -zuordnung
- I. Abgrenzung der Kompetenztatbestände „Kraftfahrwesen“ und „Straßenpolizei“
- I.I. Kraftfahrrecht
- I.2. Straßenpolizei
- 2. Begriffsbestimmung und Zuordnung
- 2.I. Verkehrspolizei
- 2.2. Organe der Straßenaufsicht
- 2.3. Abgrenzung „ruhender Verkehr“ und „fließender Verkehr“
- III Geschwindigkeitsüberwachung in Österreich: Methoden, Verfahren, Rechtsschutz
- I. Verfahren zur Ahndung von Geschwindigkeitsübertretungen
- I.I. Die abgekürzten Verfahren
- I.2. Das ordentliche Verwaltungsstrafverfahren
- 2. Methoden der Geschwindigkeitsüberwachung
- 2.I. Automatische Überwachung
- 2.2. Dienstliche Wahrnehmung
- 2.3. Anzeige
- IV Privatisierung der Geschwindigkeitsüberwachung in Österreich
- I. Motivation der Privatisierung
- 2. Anknüpfungspunkte: Wie und wo können „Private“ in der Geschwindigkeitsüberwachung eingesetzt werden?
- V Ein RECHT[s]politisches Fazit
- I. Rechtliches Fazit: Grenze des Einsatzes von „Privaten“ ist der Hoheitsakt
- 2. Rechtspolitische Erwägungen: „Private“ als systematische Anzeigeerstatter?
- Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern im Straßenverkehr
- Abgrenzung der Kompetenzen "Kraftfahrwesen" und "Straßenpolizei"
- Methoden und Verfahren der Geschwindigkeitsüberwachung in Österreich
- Rechtliche und praktische Aspekte der Privatisierung der Geschwindigkeitsüberwachung
- Rechtliche und rechtspolitische Folgen der Einbindung von Privatpersonen in die Verkehrsüberwachung
- Kapitel I: Kompetenzfragen
- Das Kapitel erläutert die grundlegende Kompetenzverteilung im österreichischen Bundesstaat und widmet sich der Frage, wo die Kompetenz für die Verkehrsüberwachung liegt.
- Es wird die Kompetenzverteilung nach Art 10 bis 15 B-VG sowie die Interpretation dieser Kompetenznormen im Kontext der Straßenverkehrsgesetzgebung diskutiert.
- Weiterhin wird die historische Entwicklung der Kompetenzverteilung auf dem Gebiet des Straßenwesens beleuchtet, von der Monarchie bis zur Gegenwart.
- Kapitel II: Abgrenzung, Begriffsbestimmung und -zuordnung
- Dieses Kapitel befasst sich mit der Abgrenzung der Kompetenztatbestände "Kraftfahrwesen" und "Straßenpolizei".
- Es werden die Begriffe "Kraftfahrrecht", "Straßenpolizei", "Verkehrspolizei" und "Organe der Straßenaufsicht" definiert und in ihren Kontext eingeordnet.
- Zudem erfolgt eine Abgrenzung zwischen "ruhendem Verkehr" und "fließendem Verkehr" im Hinblick auf die Kompetenzen.
- Kapitel III: Geschwindigkeitsüberwachung in Österreich: Methoden, Verfahren, Rechtsschutz
- Das Kapitel beschreibt die verschiedenen Methoden und Verfahren zur Ahndung von Geschwindigkeitsübertretungen in Österreich.
- Es werden die „abgekürzten Verfahren“ sowie das ordentliche Verwaltungsstrafverfahren im Detail erläutert.
- Die verschiedenen Methoden der Geschwindigkeitsüberwachung, wie automatische Überwachung, dienstliche Wahrnehmung und Anzeigen, werden vorgestellt.
- Kapitel IV: Privatisierung der Geschwindigkeitsüberwachung in Österreich
- Hier werden die Gründe für die Privatisierung der Geschwindigkeitsüberwachung in Österreich beleuchtet.
- Das Kapitel untersucht, welche Möglichkeiten und Rahmenbedingungen für die Einbindung von Privatpersonen in die Geschwindigkeitsüberwachung bestehen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der rechtlichen und rechtspolitischen Einbindung von Privatpersonen in die öffentliche Verwaltung, insbesondere im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung. Das Ziel ist, die rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen der Privatisierung in diesem Bereich zu erörtern und zu analysieren.
Zusammenfassung der Kapitel
- Quote paper
- Ing. Mag. Johann Schlatzer (Author), 2007, Verkehrsüberwachung durch Private - Rechtliche Möglichkeiten und Grenzen am Beispiel der Geschwindigkeitsüberwachung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70516