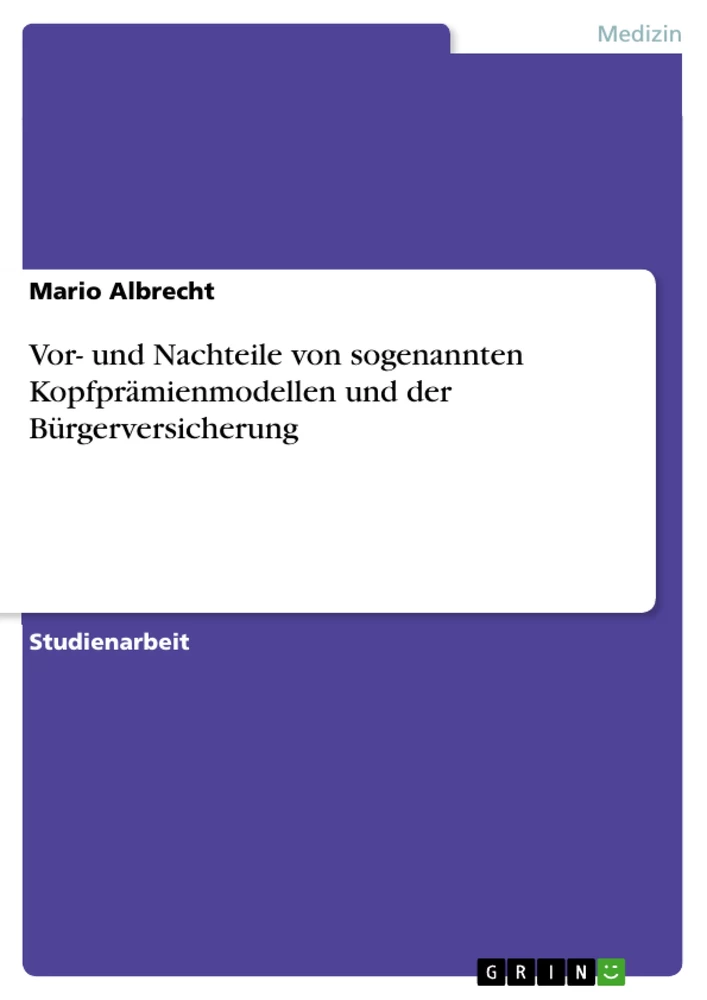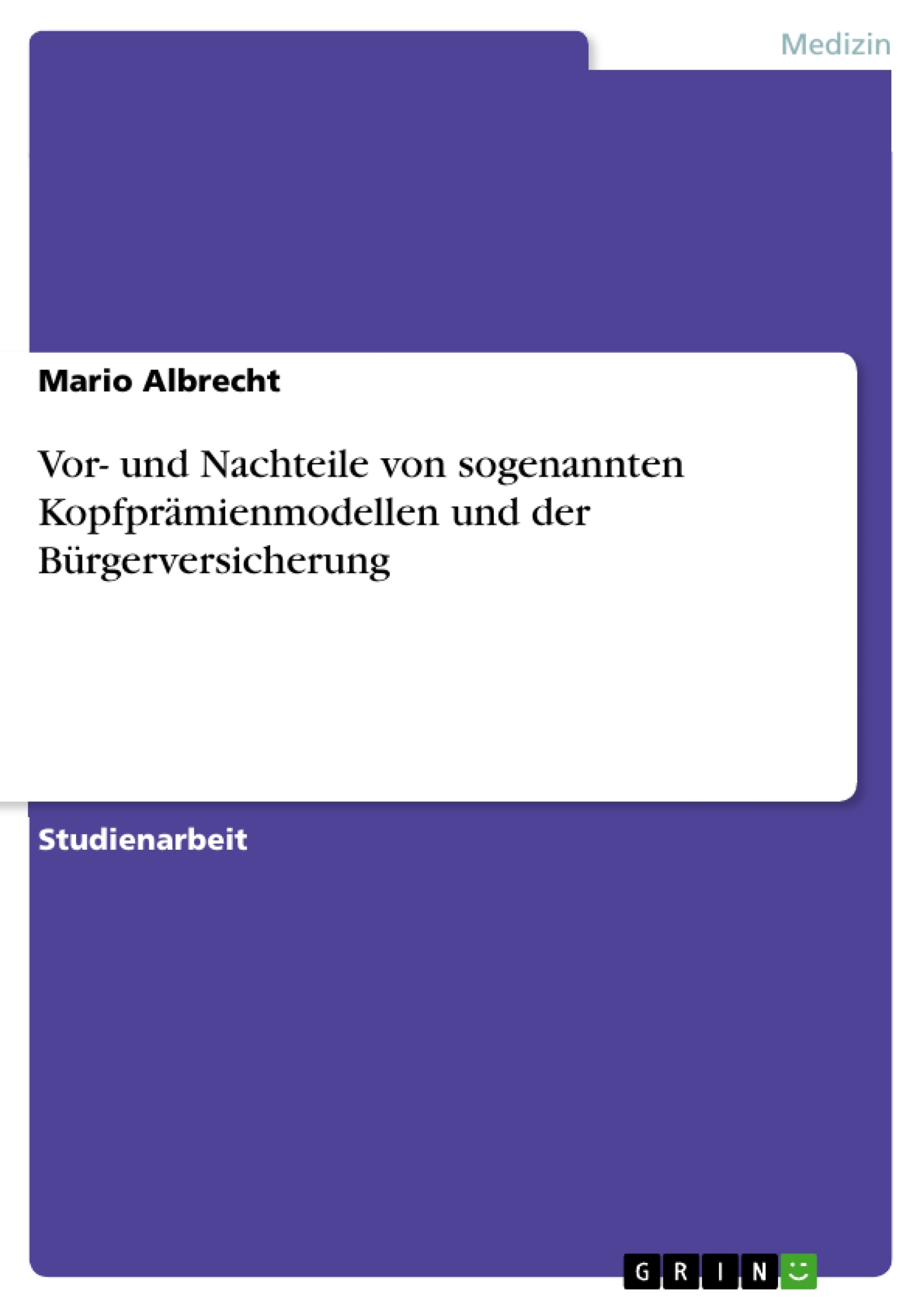Dem Reformbedarf zur nachhaltigen Finanzierung der Leistungen im Gesundheitswesen nach dem SGB V stehen ständig steigende Ausgaben und deren kurz- bis mittelfristige Deckelung durch GKV-Modernisierungsgesetze gegenüber. Im Vorfeld der letzten Gesundheitsreform, welche nun schon 2007 in Kraft getreten ist, wurden verschiedene Modelle entwickelt, welche von den Verfechtern als zukunftsträchtig gepriesen wurden. Das Lager der Diskutierenden spaltete sich: Die einen favorisierten das Modell der Kopfprämie, die anderen sprachen sich für eine Bürgerversicherung aus. Welches Modell ist zukunftstauglich? Welches sind die Kritikpunkte an den Modellen? Der folgende Beitrag möchte beide Modelle vorstellen und vergleichen und wirft in diesem Zusammenhang einen Blick auf das Gesundheitssystem in der Schweiz, wo eine Variante des Kopfprämienmodells eingeführt worden ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Reformbedarf der Finanzierung der GKV
- Das Kopfprämienmodell der Herzog-Kommission
- Die Vorschläge der Rürup-Kommission
- Das Modell des Gesundheitsprämienkonzeptes
- Das Modell der Erwerbstätigenversicherung (Bürgerversicherung)
- Vor- und Nachteile, Gegenüberstellung
- Das Kopfprämienmodell in der Schweiz
- Modell der Kopfpauschale (Gesundheitsprämie) der Herzog-Kommission
- Vorteile
- Nachteile
- Das Rürup-Gesundheitsprämienmodell im Vergleich zum Herzog-Modell
- Vorteile des Gesundheitsprämien-Modells von Rürup
- Nachteile des Rürup-Modells der Gesundheitsprämien
- Das Modell der Bürgerversicherung der Rürup-Kommission im Vergleich
- Vorteile des Rürup-Modells der Bürgerversicherung
- Nachteile der Bürgerversicherung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Reformvorschläge der Herzog- und der Rürup-Kommission bezüglich der Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Die Arbeit untersucht die Notwendigkeit einer Reform der GKV im Kontext des demographischen Wandels und der finanziellen Belastung des umlagefinanzierten Systems. Sie vergleicht die beiden Modelle der Kopfpauschale (Gesundheitsprämie) und der Bürgerversicherung hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
- Finanzierungsreform der GKV
- Demographischer Wandel und Auswirkungen auf die GKV
- Kopfprämienmodell vs. Bürgerversicherung
- Vorteile und Nachteile der Reformmodelle
- Zukünftige Entwicklung der GKV-Finanzierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Notwendigkeit einer Reform der GKV-Finanzierung im Kontext des demographischen Wandels und der finanziellen Belastung des umlagefinanzierten Systems dar. Sie führt die beiden Reformmodelle der Herzog- und der Rürup-Kommission ein, die eine Kopfpauschale (Gesundheitsprämie) bzw. eine Bürgerversicherung vorschlagen. Kapitel 2 analysiert den Reformbedarf der GKV-Finanzierung, unter anderem mit Blick auf die demographische Entwicklung, die Arbeitslosigkeit und die Konjunkturschwäche. Die folgenden Kapitel beschreiben die jeweiligen Reformmodelle der Herzog- und Rürup-Kommission im Detail. Es werden sowohl die Vor- als auch die Nachteile der beiden Modelle erörtert, wobei die vergleichenden Analysen zeigen, dass die Modelle sich in wichtigen Punkten unterscheiden. Die Analyse legt den Fokus auf die finanzielle Nachhaltigkeit der GKV-Finanzierung und die soziale Gerechtigkeit in der Gesundheitsversorgung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der GKV-Finanzierung und der Sozialreform in Deutschland. Die Schlüsselbegriffe umfassen dabei u.a. Kopfprämienmodell, Bürgerversicherung, demographischer Wandel, soziale Sicherheit, Finanzierung der GKV, Nachhaltigkeit, Gesundheitspolitik, Reformbedarf, Vor- und Nachteile, Vergleich der Modelle. Die Arbeit befasst sich mit dem Ziel, eine objektive Analyse der beiden Modelle im Kontext des aktuellen Reformdiskurses zu liefern.
- Quote paper
- Mario Albrecht (Author), 2005, Vor- und Nachteile von sogenannten Kopfprämienmodellen und der Bürgerversicherung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70488