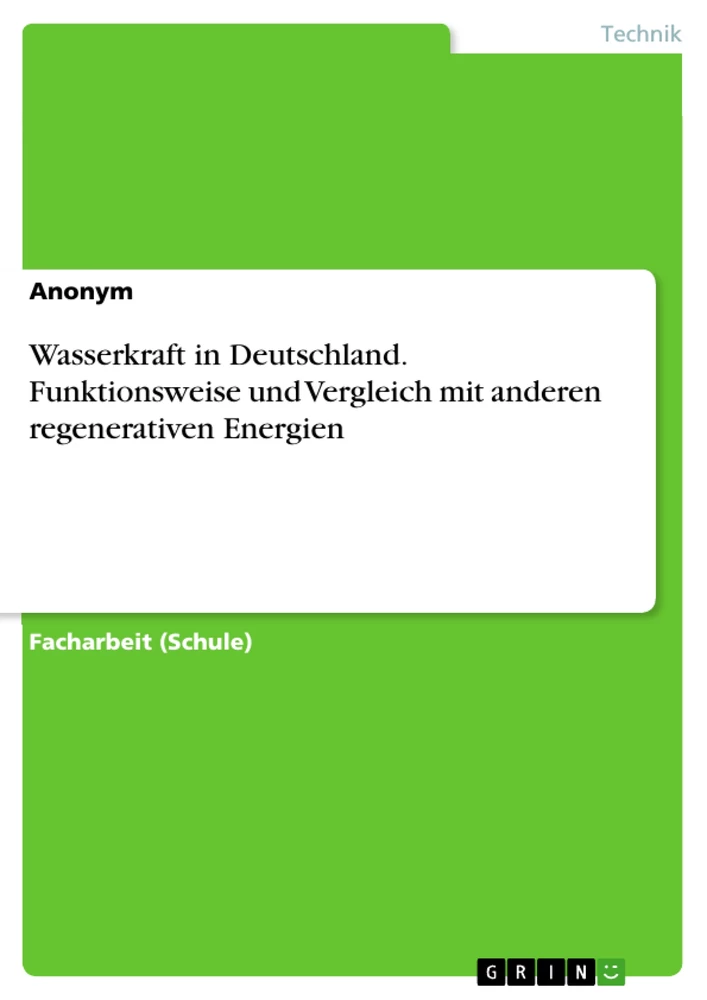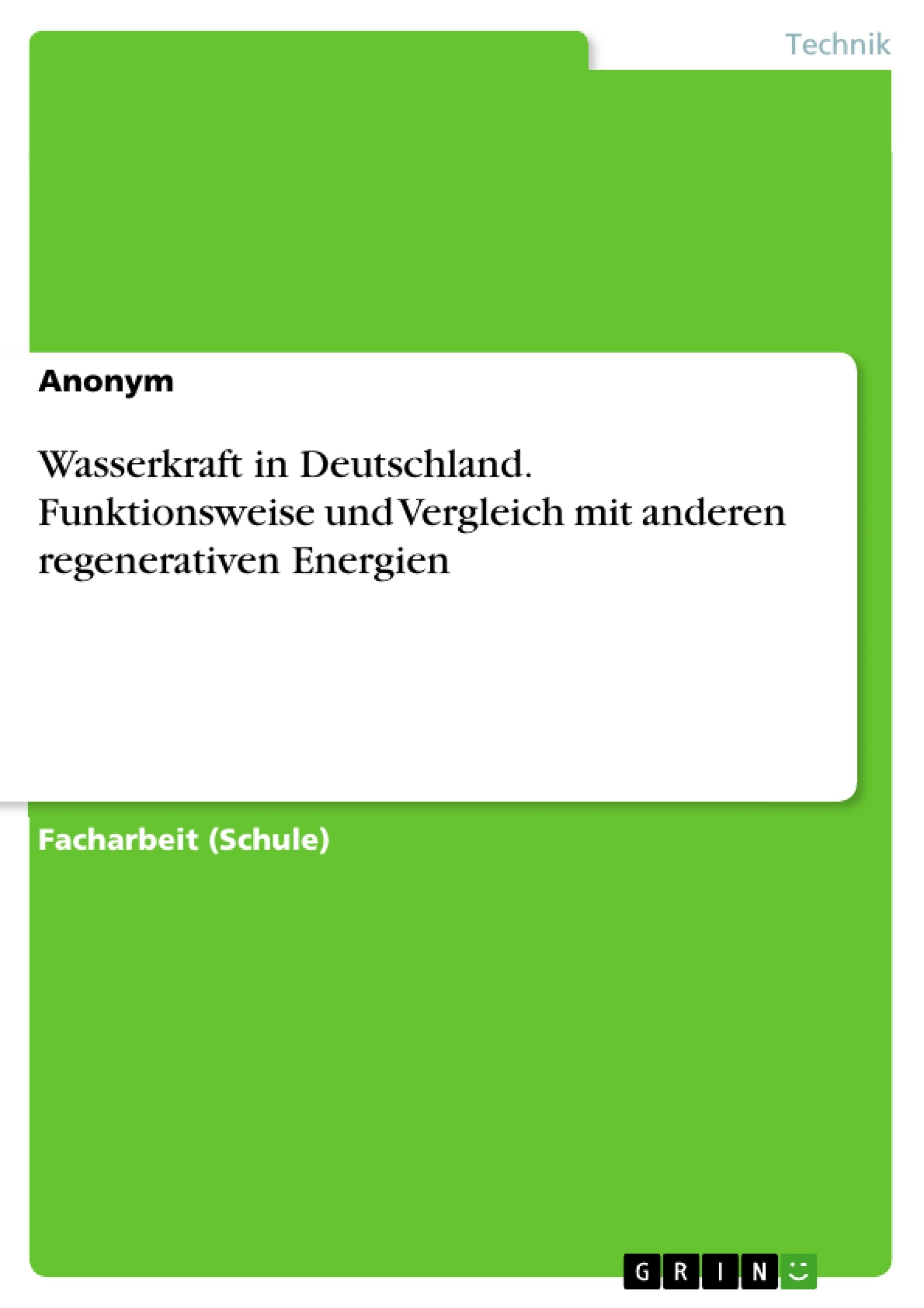Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Grundlagen der Wasserkraftnutzung, ihren Vor- und Nachteilen und ihrem Potential in Deutschland.
Die Kraft des Wassers wird seit über 3500 Jahren genutzt. In ihrer frühesten Form diente sie ausschließlich der Bewässerung von Feldern durch Wasserschöpfräder. Die Griechen erfanden im 3./4. Jahrhundert v. Chr. das erste Wasserrad und erweiterten so den Begriff der Wasserkraft als Antriebsquelle für Maschinen aller Art. Die Entwicklung des oberschlächtigen Wasserrades im Spätmittelalter sorgte für einen Wasserfluss über das Rad und machte das Gewicht des Wassers nutzbar.
Im Jahr 1767 gelang es John Smeaton, das erste Wasserrad aus Eisen herzustellen. Somit waren die Voraussetzungen für die industrielle Revolution gegeben und die Wasserkraft war von nun an die wichtigste Antriebsquelle der Welt. Keine hundert Jahre später (1842) sorgten der Vorläufer der Francis-Turbine von Benoît Fourneyron und die Erfindung des ersten elektrodynamischen Generators (1866) durch Werner von Siemens dafür, dass die Wasserkraft als erste erneuerbare Energie zur Stromerzeugung genutzt wurde. 14 Jahre später folgten die ersten Wasserkraftwerke in England und daraufhin auch in den USA, Deutschland und überall auf der Welt.
Die Wasserkraft hat heutzutage einen Anteil von über 16 Prozent an der weltweiten Stromerzeugung und liegt damit auf Platz Eins der erneuerbaren Energiequellen. Da die Stromerzeugung durch Wasserkraft seit über 100 Jahren besteht, ist ihre Technologie stets verbessert worden und im Vergleich zu Photovoltaik oder Windkraft sehr ausgereift.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen der Wasserkraftnutzung
- Physikalische Grundlagen
- Funktionsweise einer Wasserkraftanlage
- Arten von Wasserkraftwerken
- Einteilung in Niederdruckanlagen
- Einteilung in Hochdruckanlagen
- Funktionsweise von Turbinen anhand der Kaplan-Turbine
- Grundlagen einer Turbine
- Besonderheiten der Kaplan-Turbine
- Das Wasserkraftpotential
- Aufbau eines Laufwasserkraftwerkes am Beispiel Keselstraße Kempten
- Historie und Daten des Kraftwerkes
- Aufbau und Funktion
- Betrieb und Wartung
- Vergleich mit anderen regenerativen Energien
- Ähnlichkeiten
- Differenzen
- Potential in Deutschland
- Momentane Lage
- Errungenschaften des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
- Zukunftsaussichten
- Vor- und Nachteile der Wasserkraft
- Ökologische Auswirkungen
- Wirtschaftliche Lösungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Wasserkraftnutzung in Deutschland. Ziel ist es, die Funktionsweise von Wasserkraftwerken, ihre verschiedenen Arten und ihr Potential im deutschen Kontext zu erläutern. Zusätzlich werden ökologische und wirtschaftliche Aspekte sowie ein Vergleich mit anderen regenerativen Energien vorgestellt.
- Funktionsweise und technische Aspekte von Wasserkraftanlagen
- Ökologische Auswirkungen der Wasserkraftnutzung
- Wirtschaftliche Rentabilität und Kostenfaktoren
- Vergleich mit anderen erneuerbaren Energien
- Das Wasserkraftpotential in Deutschland und dessen zukünftige Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die lange Geschichte der Wasserkraftnutzung, beginnend mit der Bewässerung von Feldern bis hin zur modernen Stromerzeugung. Sie betont die Bedeutung der Wasserkraft als ausgereifte und wichtige erneuerbare Energiequelle mit einem hohen Anteil an der weltweiten Stromproduktion.
Grundlagen der Wasserkraftnutzung: Dieses Kapitel legt die physikalischen Grundlagen der Wasserkraft dar, erklärt die Funktionsweise von Wasserkraftanlagen, differenziert zwischen verschiedenen Arten von Wasserkraftwerken (Niederdruck- und Hochdruckanlagen) und beschreibt detailliert die Funktionsweise der Kaplan-Turbine als Beispiel für eine weitverbreitete Turbinenart. Der Abschnitt über das Wasserkraftpotential erläutert die verschiedenen Arten des Potentials (theoretisch, technisch, wirtschaftlich).
Aufbau eines Laufwasserkraftwerkes am Beispiel Keselstraße Kempten: Anhand des Beispiels des Kraftwerks Keselstraße in Kempten wird der Aufbau und die Funktionsweise eines Laufwasserkraftwerks detailliert dargestellt. Es werden die historischen Aspekte des Kraftwerks, die technischen Details, der Betrieb und die Maßnahmen zur Lärmminimierung und zum Schutz der Umwelt (Fischtreppe) erläutert.
Vergleich mit anderen regenerativen Energien: Dieses Kapitel vergleicht die Wasserkraft mit anderen erneuerbaren Energien wie Solarenergie, Windenergie und Biomasse hinsichtlich ihrer Ähnlichkeiten (unerschöpfliche Ressourcen, CO2-Neutralität) und Unterschiede (Kontinuität der Energieerzeugung, Bedarf an Energiespeichern bei anderen Energien).
Potential in Deutschland: Das Kapitel beschreibt die aktuelle Situation der Wasserkraft in Deutschland, die Verteilung der Kraftwerke und die Entwicklung des Zubaus im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energien. Die Bedeutung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und seine Auswirkungen auf den Ausbau der Wasserkraft werden ebenfalls beleuchtet.
Vor- und Nachteile der Wasserkraft: Abschließend werden die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte der Wasserkraftnutzung diskutiert. Die ökologischen Auswirkungen, wie die Beeinträchtigung der Fischwanderung, werden ebenso thematisiert wie die wirtschaftlichen Faktoren, die die Rentabilität von Wasserkraftwerken beeinflussen.
Schlüsselwörter
Wasserkraft, Wasserkraftwerk, Kaplan-Turbine, Erneuerbare Energien, EEG, regenerative Energie, Ökologie, Wirtschaftlichkeit, Potential, Deutschland, Laufwasserkraftwerk, Speicherkraftwerk, Niederdruckanlage, Hochdruckanlage, Umweltverträglichkeit, Fischwanderung, Grundlast.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Wasserkraftnutzung in Deutschland
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Wasserkraftnutzung in Deutschland. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Funktionsweise von Wasserkraftwerken, ihren verschiedenen Arten, ihrem Potential in Deutschland, sowie ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten im Vergleich zu anderen regenerativen Energien.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Das Dokument behandelt die physikalischen Grundlagen der Wasserkraft, die Funktionsweise verschiedener Wasserkraftanlagen (inkl. detaillierter Erklärung der Kaplan-Turbine), den Aufbau eines Laufwasserkraftwerks am Beispiel Keselstraße Kempten, einen Vergleich mit anderen regenerativen Energien (Solar, Wind, Biomasse), das Potential der Wasserkraft in Deutschland (inkl. der Rolle des EEG), sowie die Vor- und Nachteile der Wasserkraftnutzung bezüglich ökologischer Auswirkungen und wirtschaftlicher Rentabilität.
Welche Arten von Wasserkraftwerken werden beschrieben?
Das Dokument unterscheidet zwischen Niederdruck- und Hochdruckanlagen und beschreibt detailliert die Funktionsweise der Kaplan-Turbine als Beispiel für eine weitverbreitete Turbinenart. Es wird auch der Aufbau eines Laufwasserkraftwerks anhand eines konkreten Beispiels erklärt.
Wie wird die Wasserkraft mit anderen erneuerbaren Energien verglichen?
Der Vergleich mit anderen regenerativen Energien wie Solarenergie, Windenergie und Biomasse umfasst sowohl Ähnlichkeiten (unerschöpfliche Ressourcen, CO2-Neutralität) als auch Unterschiede (Kontinuität der Energieerzeugung, Bedarf an Energiespeichern bei anderen Energien).
Welche Rolle spielt das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)?
Das Dokument beleuchtet die Bedeutung des EEG und seine Auswirkungen auf den Ausbau der Wasserkraft in Deutschland. Es wird die aktuelle Situation der Wasserkraft in Deutschland beschrieben, inklusive der Verteilung der Kraftwerke und der Entwicklung des Zubaus im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energien.
Welche ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte werden betrachtet?
Die ökologischen Auswirkungen der Wasserkraftnutzung, wie z.B. die Beeinträchtigung der Fischwanderung, werden ebenso behandelt wie die wirtschaftlichen Faktoren, die die Rentabilität von Wasserkraftwerken beeinflussen. Es werden sowohl potentielle Probleme als auch wirtschaftliche Lösungen diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für dieses Dokument?
Schlüsselwörter umfassen: Wasserkraft, Wasserkraftwerk, Kaplan-Turbine, Erneuerbare Energien, EEG, regenerative Energie, Ökologie, Wirtschaftlichkeit, Potential, Deutschland, Laufwasserkraftwerk, Speicherkraftwerk, Niederdruckanlage, Hochdruckanlage, Umweltverträglichkeit, Fischwanderung, Grundlast.
Wo finde ich detaillierte Informationen zum Kraftwerk Keselstraße Kempten?
Das Dokument nutzt das Kraftwerk Keselstraße in Kempten als Beispiel, um den Aufbau und die Funktionsweise eines Laufwasserkraftwerks detailliert darzustellen. Es werden die historischen Aspekte des Kraftwerks, die technischen Details, der Betrieb und Maßnahmen zur Lärmminimierung und zum Schutz der Umwelt (z.B. Fischtreppe) erläutert.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Wasserkraft in Deutschland. Funktionsweise und Vergleich mit anderen regenerativen Energien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/704329