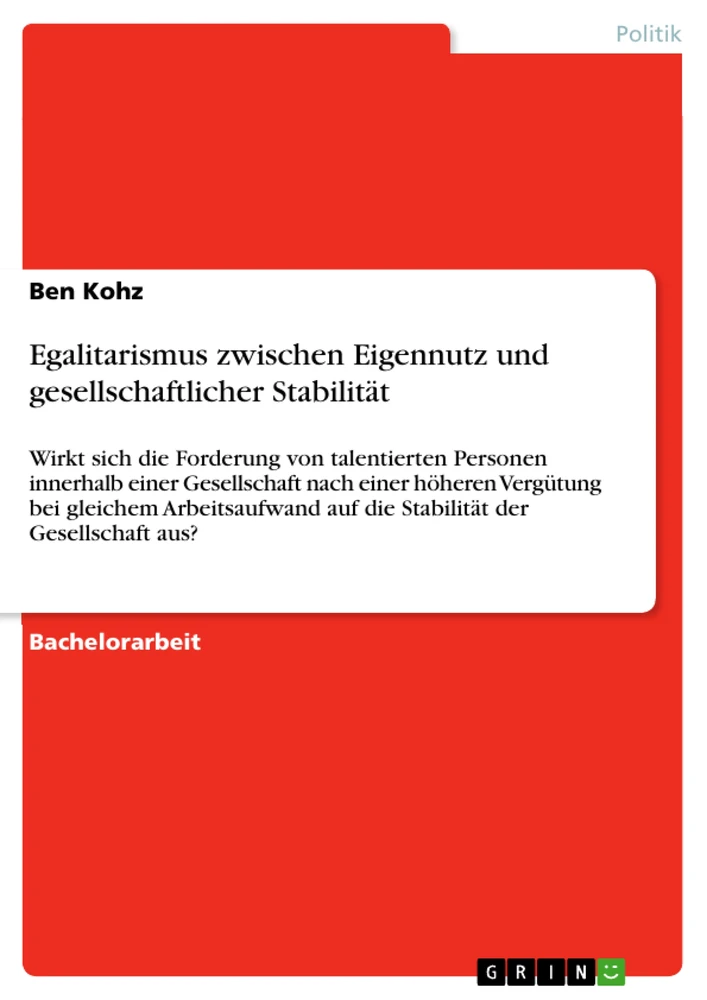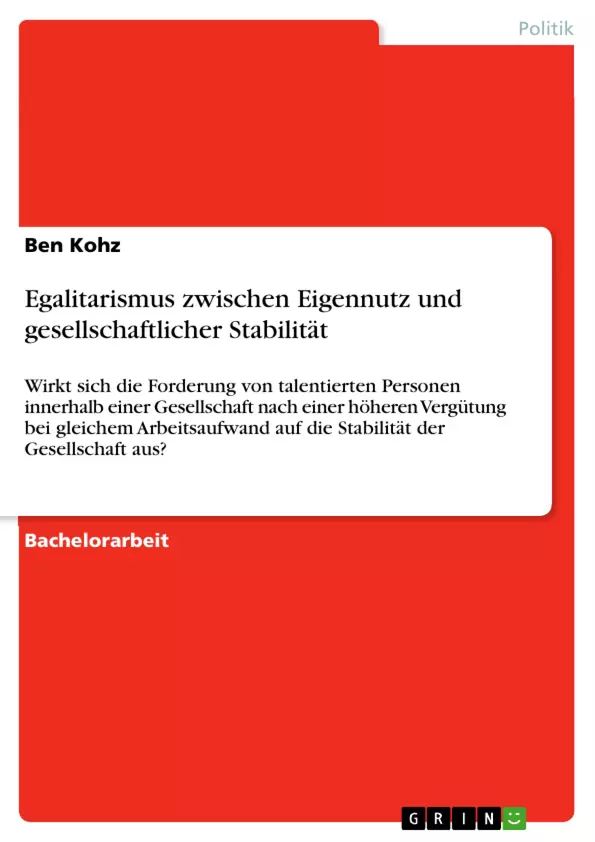Das Ziel dieser Arbeit ist, den Einfluss der Verteilungsgerechtigkeit von Gütern innerhalb einer Gesellschaft und dessen Auswirkung auf die Stabilität der Gesellschaftsstruktur zu analysieren. Der Zusammenhang zwischen der Verteilungsgerechtigkeit und der Stabilität der Gesellschaft wird in der folgenden Arbeit mittels einer spieltheoretischen Analyse untersucht.
Die Frage, was Gerechtigkeit ist, bestimmt einen Großteil des philosophischen, politischen und gesellschaftlichen Diskurses. So ist der Begriff Gerechtigkeit seit den Anfängen der Philosophie, politischen Theorie und anderen geisteswissenschaftlichen Theorien ebenfalls ein zentrales Thema dieser Disziplinen.
Eine grundlegende Frage der unzähligen Debatten, spiegelt sich in der Diskussion, ob und wenn ja Ungleichheit gerecht bzw. gerechtfertigt ist. Ein Teilaspekt dieser Debatte beschäftigt sich mit der Rechtfertigung von Ungleichheiten, die aufgrund von biologischen Merkmalen entstanden sind. Dabei wird davon ausgegangen, dass Menschen weder für noch gegen diese Vor- oder Benachteiligungen etwas können. Wie sollen Entlohnungen zwischen verschiedenen effektiven, begabten oder motivierten Menschen geregelt werden?
Die theoretische Grundlage dieser Arbeit baut auf einer von Gerald Allan Cohen entwickelten Kritik am Differenzprinzip auf.
Die in dieser Arbeit diskutierte Forschungsfrage lautet: Wirkt sich die Forderung von talentierten Personen innerhalb einer Gesellschaft nach einer höheren Vergütung bei gleichem Arbeitsaufwand auf die Stabilität der Gesellschaft aus?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsbestimmungen und Definitionen
- 2.1 Gleichheit
- 2.2 Gerechtigkeit
- 2.3 Talent und Begabung
- 2.4 Gesellschaft
- 3 Theorie
- 3.1 Egalitarismus
- 3.2 Differenzprinzip
- 3.3 Rational Choice
- 3.4 Theoretische Grundlage und Begriffe der Spieltheorie
- 3.5 Handlungsketten
- 4 Analyse
- 4.1 Betrachtung der Erpressungssituation als spieltheoretische Situation
- 4.2 Ursprüngliche Erpressungssituation
- 4.3 Erweiterung der Erpressungssituation
- 4.4 Neue Spielsituation
- 4.5 Analyse der erweiterten Erpressungssituation
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert den Einfluss gerechter Güterverteilung auf die gesellschaftliche Stabilität. Der Zusammenhang zwischen Verteilungsgerechtigkeit und gesellschaftlicher Stabilität wird mithilfe einer spieltheoretischen Analyse untersucht. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und wie Forderungen talentierter Personen nach höherer Entlohnung die gesellschaftliche Stabilität beeinflussen.
- Spieltheoretische Modellierung von Erpressungssituationen zwischen Talentierten und Nichttalentierten.
- Analyse des Einflusses von Ungleichheiten auf die gesellschaftliche Kooperation.
- Bewertung unterschiedlicher Gerechtigkeitskonzepte im Kontext der Güterverteilung.
- Anwendung des Differenzprinzips und des Maximin-Prinzips auf die analysierten Situationen.
- Untersuchung der Macht- und Handlungsstrukturen in ungleichen Verteilungen.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt die Zielsetzung, die Forschungsfrage und die aufgestellten Hypothesen. Sie beleuchtet den Zusammenhang zwischen Verteilungsgerechtigkeit, gesellschaftlicher Stabilität und der Diskussion um die Rechtfertigung von Ungleichheiten, insbesondere solcher, die auf biologischen Merkmalen beruhen. Die Arbeit kündigt die methodische Herangehensweise an, welche die spieltheoretische Modellierung und Analyse einer Erpressungssituation umfasst.
2 Begriffsbestimmungen und Definitionen: Dieses Kapitel definiert und grenzt zentrale Begriffe wie Gleichheit, Gerechtigkeit, Talent, Begabung und Gesellschaft ab. Es wird betont, dass Gleichheit als arithmetische Gleichheit pro Person verstanden wird. Der Begriff Gerechtigkeit wird als vielschichtig und komplex dargestellt, wobei die Unmöglichkeit einer allgemeingültigen Definition hervorgehoben wird. Die Ausführungen dieses Kapitels legen die Grundlage für die spätere theoretische und analytische Auseinandersetzung.
3 Theorie: In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Arbeit gelegt. Es werden der Egalitarismus, das Differenzprinzip und die Rational-Choice-Theorie eingeführt und erläutert. Die Grundideen und Strukturen der Konzepte werden hergeleitet und verschiedene Kritiken an diesen werden besprochen. Diese theoretische Basis dient als Fundament für die anschließende spieltheoretische Modellierung und Analyse.
4 Analyse: Dieses Kapitel präsentiert die spieltheoretische Modellierung und Analyse der von Cohen skizzierten Erpressungssituation. Die anfängliche Situation wird erweitert und schrittweise analysiert, um den Einfluss unterschiedlicher Macht- und Handlungsstrukturen auf das Ergebnis zu untersuchen. Die Analyse umfasst die Betrachtung der erweiterten Situation unter dem von Rawls entwickelten Maximin-Prinzip. Die verschiedenen Tabellen veranschaulichen die spieltheoretischen Modelle und deren Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Egalitarismus, Verteilungsgerechtigkeit, gesellschaftliche Stabilität, Differenzprinzip, Rational-Choice-Theorie, Spieltheorie, Erpressungssituation, Ungleichheit, Talent, Begabung, Maximin-Prinzip, Kooperation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Gerechte Güterverteilung und gesellschaftliche Stabilität
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit analysiert den Einfluss gerechter Güterverteilung auf die gesellschaftliche Stabilität. Im Fokus steht der Zusammenhang zwischen Verteilungsgerechtigkeit und gesellschaftlicher Stabilität, untersucht anhand einer spieltheoretischen Analyse von Erpressungssituationen zwischen talentierten und nicht-talentierten Personen.
Welche Forschungsfrage wird behandelt?
Die Arbeit untersucht, ob und wie Forderungen talentierter Personen nach höherer Entlohnung die gesellschaftliche Stabilität beeinflussen.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine spieltheoretische Modellierung und Analyse von Erpressungssituationen. Es werden verschiedene Gerechtigkeitskonzepte, wie das Differenzprinzip und das Maximin-Prinzip, angewendet.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf den Egalitarismus, das Differenzprinzip, die Rational-Choice-Theorie und die Spieltheorie. Die Grundkonzepte dieser Theorien werden erläutert und kritisch diskutiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Einleitung, Begriffsbestimmungen und Definitionen, Theorie, Analyse und Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Zielsetzung. Das zweite Kapitel definiert wichtige Begriffe. Das dritte Kapitel stellt die theoretischen Grundlagen vor. Das vierte Kapitel präsentiert die spieltheoretische Analyse einer Erpressungssituation. Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche zentralen Begriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert und grenzt zentrale Begriffe wie Gleichheit, Gerechtigkeit, Talent, Begabung und Gesellschaft ab. Es wird insbesondere auf die Vielschichtigkeit des Gerechtigkeitsbegriffs eingegangen.
Welche konkreten Situationen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert eine spieltheoretische Modellierung einer Erpressungssituation zwischen Talentierten und Nichttalentierten. Diese Situation wird schrittweise erweitert und unter verschiedenen Gerechtigkeitskonzepten analysiert.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der spieltheoretischen Analyse zeigen den Einfluss unterschiedlicher Macht- und Handlungsstrukturen auf das Ergebnis der Erpressungssituation und auf die gesellschaftliche Kooperation. Die Analyse betrachtet die Situation unter dem Maximin-Prinzip.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Egalitarismus, Verteilungsgerechtigkeit, gesellschaftliche Stabilität, Differenzprinzip, Rational-Choice-Theorie, Spieltheorie, Erpressungssituation, Ungleichheit, Talent, Begabung, Maximin-Prinzip, Kooperation.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht und dient der Analyse von Themen im Bereich der Verteilungsgerechtigkeit und gesellschaftlicher Stabilität.
- Quote paper
- Ben Kohz (Author), 2020, Egalitarismus zwischen Eigennutz und gesellschaftlicher Stabilität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/704245