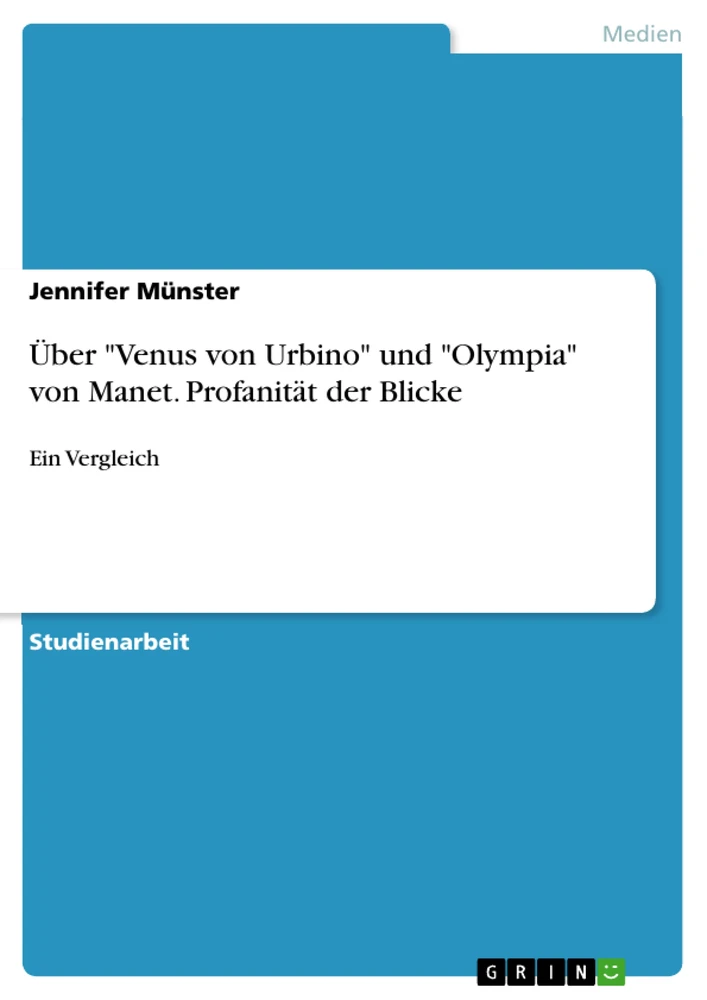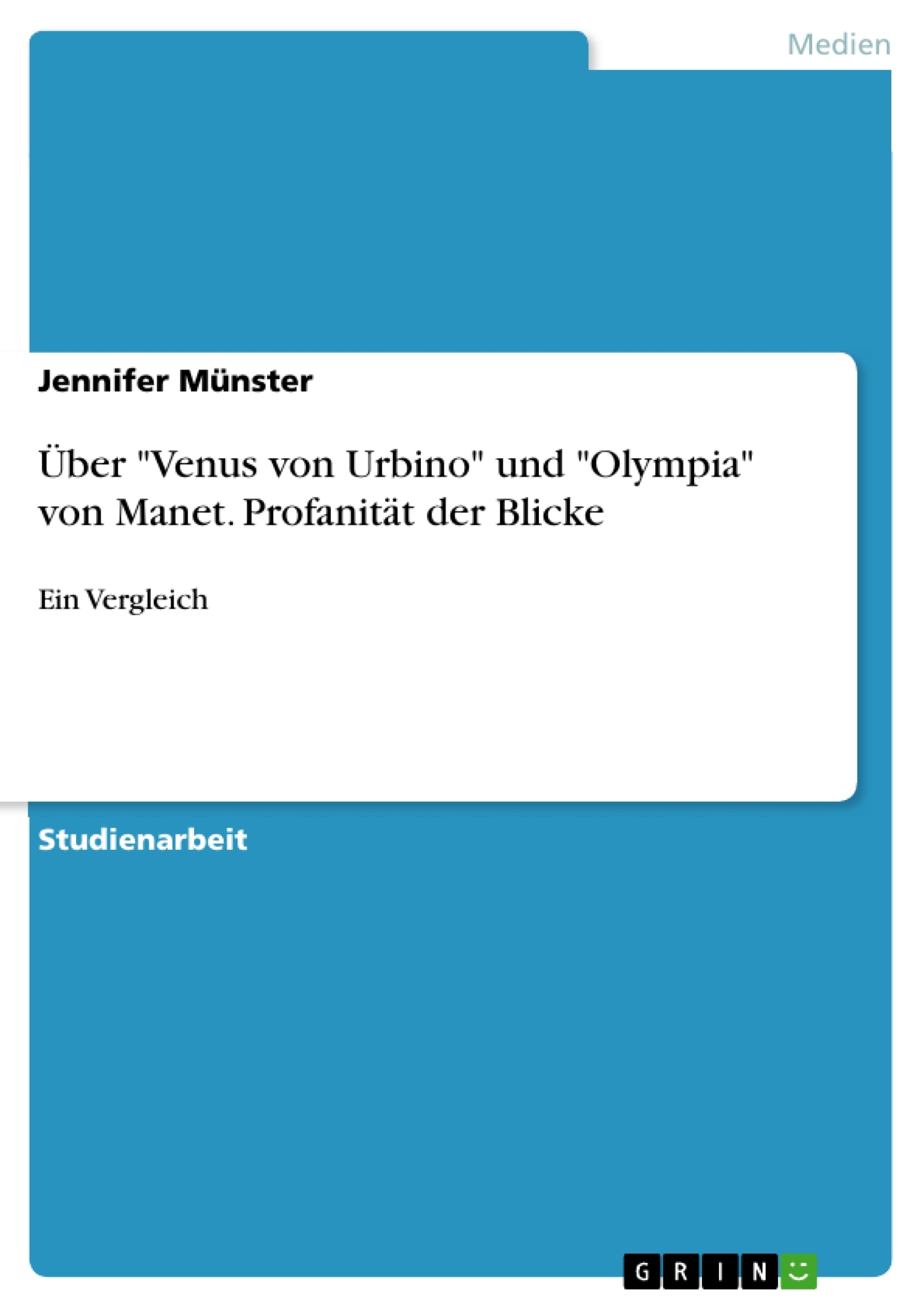Ziel der Arbeit ist es, die unterschiedlichen Blicke der Venus und der Olympia zu erfassen und mit dem durch sie angesprochenen Betrachter in Beziehung zu setzen. Dabei soll gezeigt werden, dass der profane Charakter von Manets Werk bereits im Blick der Olympia angelegt ist.
Die Analyse des Blicks zeigt, dass beide Bilder mit dem Bick aus dem Bild Kommunikation als solche thematisieren. Die Venus kaschiert die stetige Distanz von Bild und Betrachter allerdings, während Manet eine fehlgeschlagene Kommunikation ausstellt. Die Bedeutung des Aktes ergibt sich aus jenem Sujet der Illusion der Nähe zwischen Akt und Betrachter. Obwohl die idealisierte Venus in einen irdischen Kontext gerückt wurde, ist sie noch immer stärker illusionistisch als die Olympia.
Daher leitet sich der profane Charakter der Olympia ab, den ihr Blick bereits verrät: Sie schaut nicht den sich nähernden Liebhaber an, sondern einen fremden Voyeur. So kann die Analyse verschiedene Beziehungsgefüge zwischen Bild und Betrachter aufzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Heranführung ans Thema
- Ähnlichkeiten, Unterschiede und Referenzen zwischen der Venus von Urbino (1538) und der Olympia (1865)
- Blick und Betrachter - Betrachter des Blicks
- Der Blick als Kommunikationsmittel
- Im Vergleich: Dresdner Venus und Venus von Urbino
- Im Vergleich: Geburt der Venus und Olympia
- Der Akt im Blick
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Blicke der Venus von Urbino und der Olympia, um die durch sie angesprochenen Betrachter in Beziehung zu setzen. Dabei soll gezeigt werden, dass der profane Charakter von Manets Werk bereits im Blick der Olympia angelegt ist.
- Der Blick als Kommunikationsmittel in der Kunst
- Vergleichende Analyse der Blickkonstellationen und -situationen in den Bildern
- Untersuchung des Verhältnisses von Bild und Betrachter
- Bedeutung des Aktes in den Darstellungen
- Referenz von Manets Olympia auf die Venus von Urbino
Zusammenfassung der Kapitel
- Heranführung ans Thema: Die Arbeit erläutert die Entstehung des Themas und stellt die beiden Werke, die Venus von Urbino und die Olympia, im Kontext ihrer jeweiligen Entstehungszeit vor. Es wird die Frage gestellt, wie die Bilder trotz ihrer Ähnlichkeiten unterschiedliche Wirkungen beim Betrachter erzeugen.
- Ähnlichkeiten, Unterschiede und Referenzen zwischen der Venus von Urbino (1538) und der Olympia (1865): Dieser Abschnitt beschreibt die beiden Werke im Detail, beleuchtet ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie die Referenz von Manets Olympia auf Tizians Venus von Urbino.
- Blick und Betrachter - Betrachter des Blicks: Dieser Abschnitt analysiert den Blick als Kommunikationsmittel und untersucht die Beziehung zwischen Bild und Betrachter. Es werden verschiedene Aktdarstellungen aus der Zeit verglichen, um die unterschiedlichen Wahrnehmung und Kommunikation mit dem Betrachter zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Blick, Betrachter, Kommunikation, Aktdarstellung, Renaissance, Manierismus, Venus von Urbino, Olympia und Interpikturalität. Der Fokus liegt auf der Analyse der Blickbeziehungen in den beiden Kunstwerken, ihrer Bedeutung für die Rezeption und die Entwicklung der Kunstgeschichte.
- Quote paper
- Jennifer Münster (Author), 2015, Über "Venus von Urbino" und "Olympia" von Manet. Profanität der Blicke, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/704093