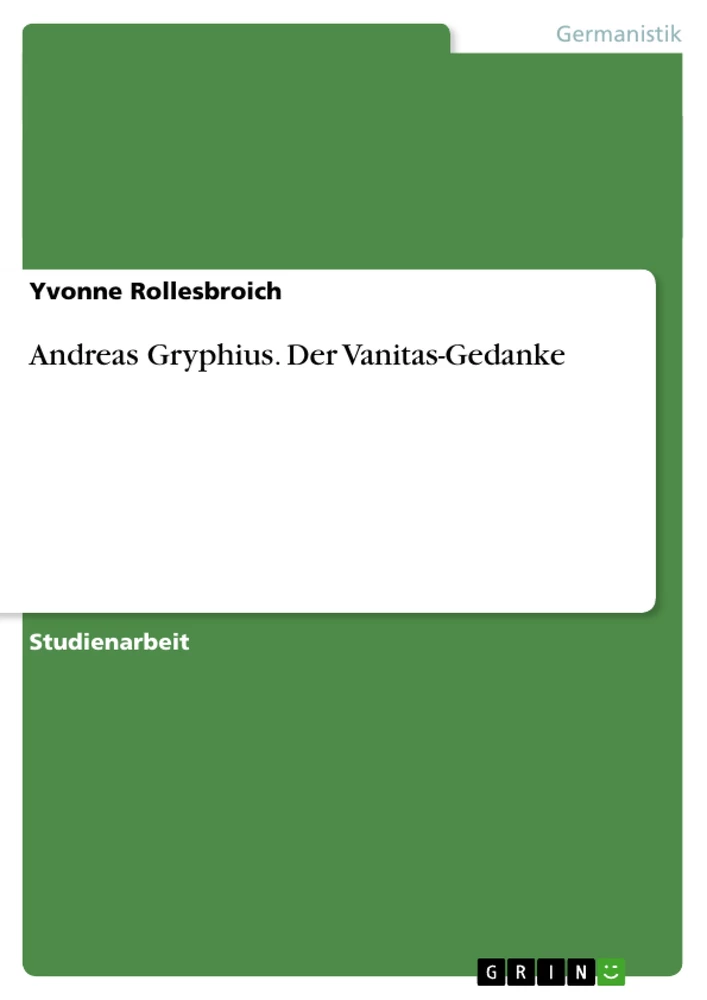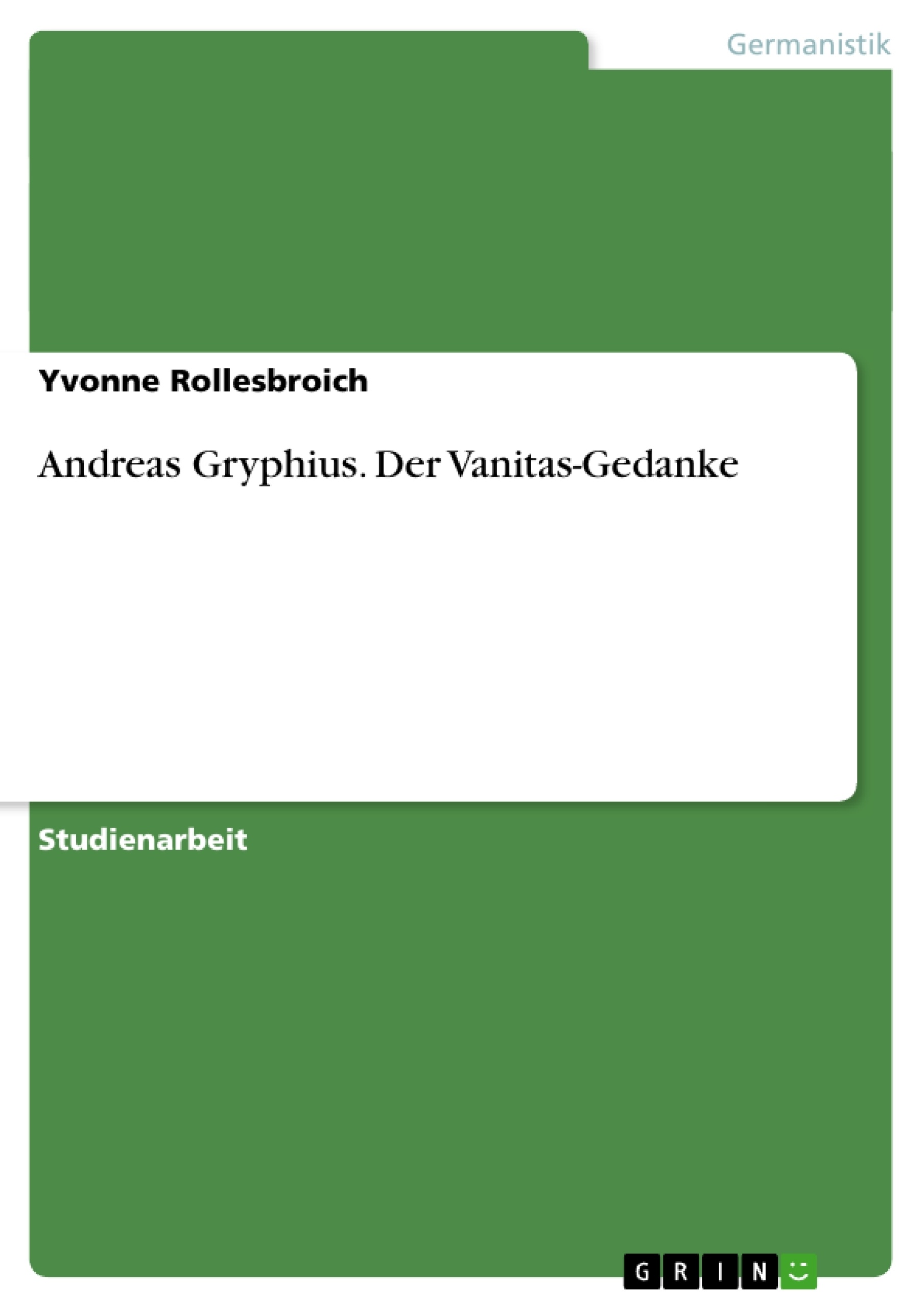Alles wofür wir hart arbeiten, sei es Geld, Macht oder Ruhm, ist unbeständig, da es die Ewigkeit auf Erden nicht gibt. Der Tod gehört zum menschlichen Leben und niemand weiß, wann er uns ereilt. Dies liegt nicht in unserer Hand, sondern allein in der des Allmächtigen oder des Schicksals.
Geht man nun davon aus, dass dieses Problem nur in unserer Gesellschaft zeitgemäß ist, so liegt ein Irrtum vor. Das Anliegen dieser Arbeit ist es, der Frage nachzugehen, wie frühere Generationen mit diesem Thema umgingen. Exemplarisch soll dies an einem lyrischen Werk der Barockzeit erarbeitet werden.
Der Vanitas Gedanke, also die Vorstellung von der Vergänglichkeit alles Irdischen, war eines der bedeutendsten Motive der Barockliteratur und prägt vor allem die Dichtung des wohl bekanntesten Lyrikers jener Epoche: Andreas Gryphius.
Es werden die erste und zweite Fassung seines Gedichts „Vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Es ist alles gantz eytel.“ herangezogen, untersucht und verglichen. Zwischen beiden Ausgaben liegen fast 30 Jahre. Warum eine Überarbeitung erfolgte und ob das Sonett dadurch seinen ursprünglichen Sinn verlor, wird durch einen Vergleich deutlich werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einflüsse auf die Lyrik Gryphius'
- Literaturhistorische Einordnung
- Biographie
- Der Vanitas Gedanke
- Analyse von „Vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Es ist alles gantz eytel.“ und „Es ist alles Eitel.“
- Die Zahlenkomposition in den Lissaer Sonetten
- Formale Aspekte
- Inhaltliche Aspekte
- Gegenüberstellung der Fassungen
- Sinnbilder der Vanitas und ihr biblischer Ursprung
- Zusammenfassende Betrachtung
- Quellenverzeichnis
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
- Bibel
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Vanitas-Gedanken in der Lyrik von Andreas Gryphius und untersucht, wie der berühmte Barockdichter das Thema der Vergänglichkeit alles Irdischen in seinen Gedichten verarbeitet. Die Arbeit analysiert insbesondere zwei Fassungen des Gedichts „Vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Es ist alles gantz eytel.“ und vergleicht diese, um die Entwicklung des Gedankens und die Intention Gryphius' zu verstehen.
- Die literaturhistorische Einordnung des Barocks und die Rolle des Dreißigjährigen Krieges
- Die Biographie Andreas Gryphius' und deren Einfluss auf seine Lyrik
- Die Bedeutung des Vanitas-Gedankens in der Barockliteratur
- Die Analyse der formalen und inhaltlichen Aspekte des Gedichts „Vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Es ist alles gantz eytel.“
- Die Sinnbilder der Vergänglichkeit und ihre biblischen Wurzeln
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung thematisiert die Aktualität des Themas Vergänglichkeit und Tod in unserer modernen Gesellschaft und führt den Vanitas-Gedanken als zentrales Motiv der Barockliteratur ein. Sie stellt das Ziel der Arbeit vor, die Interpretation des Gedichts „Vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Es ist alles gantz eytel.“ durch eine umfassende Analyse und die Berücksichtigung von Gryphius’ Biographie zu ermöglichen.
Im zweiten Kapitel werden die Einflüsse auf Gryphius' Lyrik erörtert. Hierbei wird die literaturhistorische Einordnung des Barocks und die Rolle des Dreißigjährigen Krieges beleuchtet. Außerdem wird Gryphius’ Biographie und der Einfluss seiner Lebensumstände auf seine Werke beleuchtet.
Kapitel drei widmet sich einer detaillierten Analyse des Gedichts „Vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Es ist alles gantz eytel.“. Hierbei werden die formale Komposition, die inhaltlichen Aspekte und die Unterschiede zwischen den beiden Fassungen des Gedichts untersucht. Darüber hinaus werden die Sinnbilder der Vanitas und ihre biblischen Bezüge beleuchtet.
Schlüsselwörter
Andreas Gryphius, Barocklyrik, Vanitas, Vergänglichkeit, Tod, Dreißigjähriger Krieg, Lissaer Sonette, Formale Analyse, Inhaltliche Analyse, Sinnbilder, Bibel, Martin Opitz.
- Quote paper
- Yvonne Rollesbroich (Author), 2007, Andreas Gryphius. Der Vanitas-Gedanke, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70239