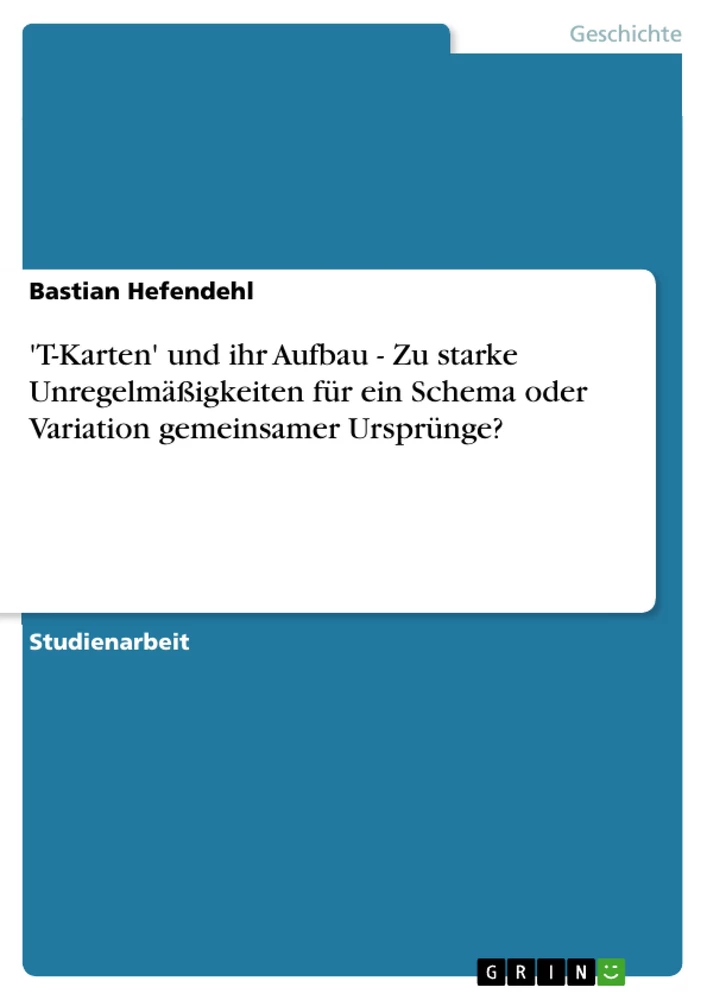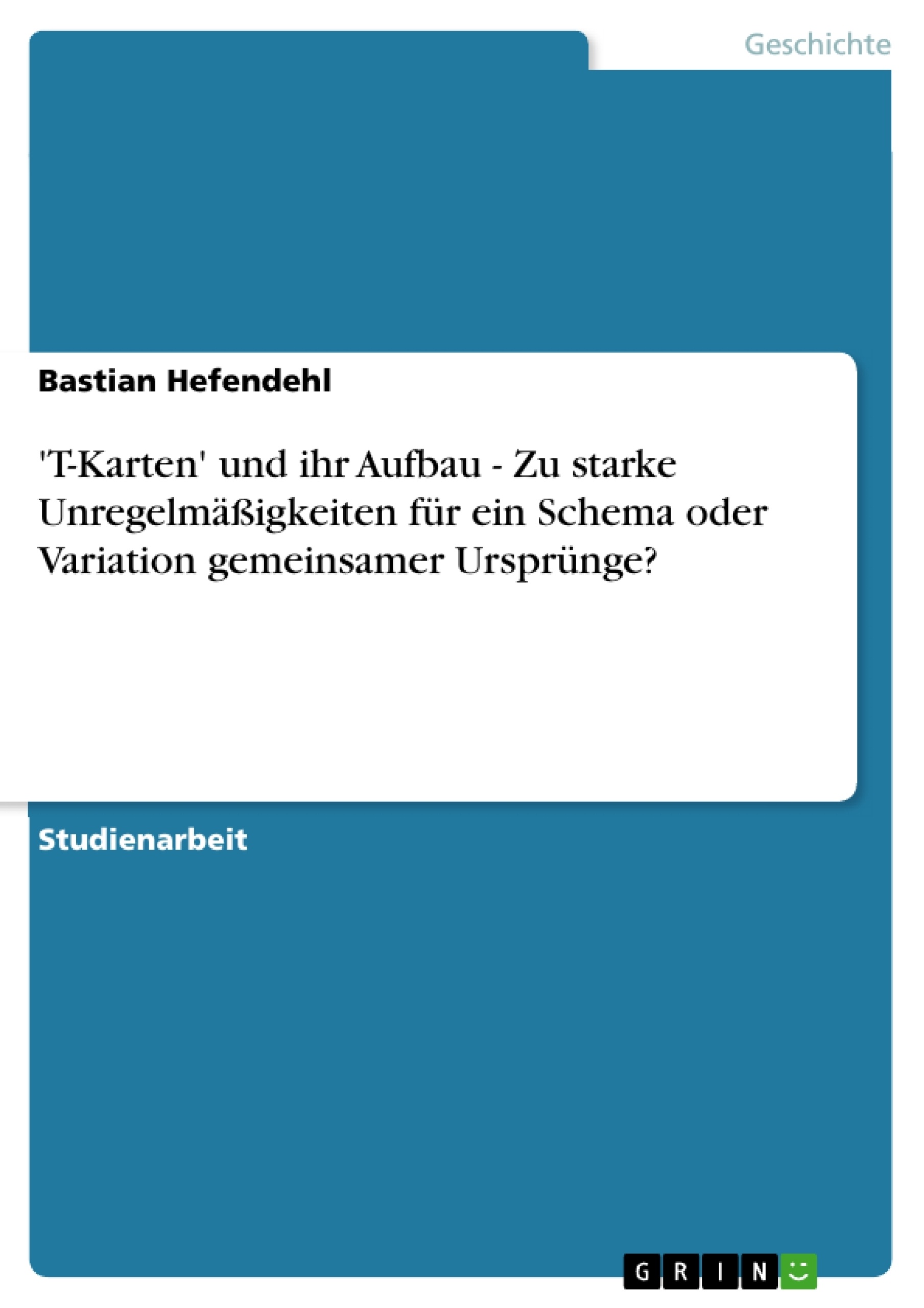Omnia in mensura et numero et pondere fecisti. Die von Gott geschaffene Welt ist nach Maß, Zahl und Gewicht bis in das kleinste Detail hinein geordnet. Eine nach Regeln erschaffene Welt muss demnach erfass- und erklärbar sein, da ihre Schöpfung in keinem Bereich dem Zufall unterlag. Da die Bibelexegese keine Verbote der Beschäftigung mit der Erde und deren Gestalt formuliert hatte, folgten zwangsläufig Versuche der Menschen, die von Gott geordnete Welt zu erklären und darzustellen. Einen besonderen Platz in der Abbildung der Welt und dem Weltbild nehmen dabei die TO-Schemakarten oder auch Radkarten ein. Besonders auch deshalb, weil sie parallel zu geografisch teilweise überraschend genauen Karten existieren. Wie erklärt sich demnach, dass die Menschen bedingte Kenntnis von geografischen Lagen und Verhältnissen hatten und sich trotzdem mit einem Typus von Karte beschäftigen, der offenbar nicht die geografische Genauigkeit seiner „wissenschaftlichen Pendants“ aufweist. Wie kommt es, dass der Symbolismus einer T-Karte parallel zum Realismus einer Welt- oder Gebietskarte existieren konnte? Handelt es sich hierbei wirklich um eine Armut des Wissens,wie sie Leithäuser formuliert? Betrachtet man verschiedene T-Karten, sind diese nach einem, augenscheinlich immer gleich bleibendem, Schema aufgebaut. Scheinbar folgt ein großer Teil der Karten Gemeinsamkeiten wie der Anzahl und Aufteilung der Kontinente, dem kreisrunden Randozean (das „O“) oder den Grenzflüssen/ -meeren (angeordnet als „T“). Auch ist ein Großteil der T-Karten mit der Himmelsrichtung Osten nach oben ausgerichtet. Einige T-Karten haben diese Schemata allerdings nicht befolgt und weisen eine Ausrichtung zu anderen Himmelsrichtungen auf. Und auch der runde Randozean wird in einigen wenigen Karten nicht dem Schema des kreisrunden, allumschließenden Okeanos entsprechend berücksichtigt. Wie lassen sich solche Tatsachen erklären, wenn die von Gott geschaffene Welt doch ganz klar den Prämissen der göttlichen Ordnung, der Ordounterlag? Trotzen diese Karten also, wissentlich oder unwissentlich, der Ordo? Denn für den Menschen des Mittelalters kann nur eine Sichtweise richtig sein, beachtet man die Annahme der göttlichen Ordnung. Und am wichtigsten scheint, zu betrachten, aus welchen Gründen eine Karte ein Schema verfolgt oder eben auch nicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- "T-Schemakarten" und ihr Aufbau
- Grundvoraussetzungen und Ursprünge der Kartografie des Mittelalters
- Größenverhältnisse, Lage und Herkunft der drei Kontinente
- Die Ausrichtung der Welt und verwendeter Symbolismus
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Aufbau und die Verbreitung von T-Schemakarten im Mittelalter. Sie analysiert die scheinbaren Widersprüche zwischen der geometrischen Ordnung dieser Karten und der gleichzeitig vorhandenen geographischen Genauigkeit anderer mittelalterlicher Karten. Die Arbeit strebt danach, die Gründe für die Verwendung des T-Schemas und Abweichungen davon zu verstehen und in den Kontext des mittelalterlichen Weltbildes einzuordnen.
- Das T-Schema als Ausdruck des mittelalterlichen Weltbildes
- Die Rolle der göttlichen Ordnung ("Ordo") in der Kartografie
- Der Vergleich zwischen T-Schemakarten und geographisch genauen Karten
- Die Bedeutung von Symbolismus und Himmelsausrichtung auf T-Karten
- Ursachen für Abweichungen vom Standard-T-Schema
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der T-Schemakarten ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Gründen für die Existenz und die Variationen dieser Kartentypen im Mittelalter. Sie verweist auf den scheinbaren Widerspruch zwischen dem geometrischen Schema der T-Karten und der geographischen Genauigkeit anderer zeitgenössischer Karten und nennt wichtige Studien, die als Grundlage für die weitere Untersuchung dienen. Die Einleitung hebt die Bedeutung der "Ordo" (göttliche Ordnung) im mittelalterlichen Weltbild hervor und deutet an, dass die Erklärung für die T-Karten in diesem Kontext zu suchen ist. Der Autor benennt die Forschungslücken hinsichtlich der Ausrichtung der Karten und der Vielfältigkeit der Begründungen für das T-Schema.
"T-Schemakarten" und ihr Aufbau: Dieses Kapitel beleuchtet die Grundvoraussetzungen und Ursprünge der mittelalterlichen Kartografie. Es betont die Bedeutung des Glaubens an eine von Gott geschaffene, geordnete Welt ("Ordo") und wie sich diese Ordnung in verschiedenen Bereichen des mittelalterlichen Lebens widerspiegelte, inklusive der Kartographie. Der Vergleich mit modernen Karten verdeutlicht die Unterschiede in Genauigkeit und Informationsgehalt. Das Kapitel legt die Basis für das Verständnis, warum mittelalterliche Karten oft nicht der geographischen Realität entsprachen, sondern vielmehr den jeweiligen zugrundeliegenden Weltanschauungen folgten. Es wird kurz auf verschiedene Kartentypen und ihre jeweiligen Grundannahmen hingewiesen.
Schlüsselwörter
T-Schemakarten, Mittelalter, Kartografie, Ordo, Weltbild, Geographie, Symbolismus, Himmelsrichtung, Gott, Bibelexegese, geographische Genauigkeit, Variationsformen, Kartenschema.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mittelalterliche T-Schemakarten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Aufbau und die Verbreitung von T-Schemakarten im Mittelalter. Ein besonderer Fokus liegt auf der Analyse der scheinbaren Widersprüche zwischen der geometrischen Ordnung dieser Karten und der gleichzeitig vorhandenen geographischen Genauigkeit anderer mittelalterlicher Karten. Ziel ist es, die Gründe für die Verwendung des T-Schemas und Abweichungen davon zu verstehen und in den Kontext des mittelalterlichen Weltbildes einzuordnen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die folgenden Themenschwerpunkte: Das T-Schema als Ausdruck des mittelalterlichen Weltbildes, die Rolle der göttlichen Ordnung ("Ordo") in der Kartografie, den Vergleich zwischen T-Schemakarten und geographisch genauen Karten, die Bedeutung von Symbolismus und Himmelsausrichtung auf T-Karten sowie die Ursachen für Abweichungen vom Standard-T-Schema.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über den Aufbau von T-Schemakarten und einen Schluss. Die Einleitung führt in die Thematik ein, stellt die Forschungsfrage und nennt wichtige Studien als Grundlage. Das Kapitel über den Aufbau beleuchtet die Ursprünge der mittelalterlichen Kartografie, die Bedeutung des Glaubens an eine geordnete Welt ("Ordo") und den Vergleich mit modernen Karten. Der Schluss wird im vorliegenden Auszug nicht detailliert beschrieben.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Warum existierten T-Schemakarten im Mittelalter trotz der gleichzeitig vorhandenen geographisch genaueren Karten? Weitere Fragen betreffen die Variationen des T-Schemas, die Rolle des Symbolismus und der Himmelsausrichtung, sowie der Einfluss des mittelalterlichen Weltbildes auf die Kartografie.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: T-Schemakarten, Mittelalter, Kartografie, Ordo, Weltbild, Geographie, Symbolismus, Himmelsrichtung, Gott, Bibelexegese, geographische Genauigkeit, Variationsformen, Kartenschema.
Wie wird der Aufbau von T-Schemakarten beschrieben?
Der Aufbau der T-Schemakarten wird im Detail im entsprechenden Kapitel behandelt. Es wird die Bedeutung des Glaubens an eine göttliche Ordnung ("Ordo") und deren Einfluss auf die Darstellung der Welt in diesen Karten erläutert. Der Vergleich mit modernen Karten soll die Unterschiede in Genauigkeit und Informationsgehalt verdeutlichen.
Welche Rolle spielt das mittelalterliche Weltbild?
Das mittelalterliche Weltbild, insbesondere der Glaube an eine von Gott geschaffene und geordnete Welt ("Ordo"), spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit argumentiert, dass die Struktur und die Besonderheiten der T-Schemakarten eng mit dieser Weltanschauung verbunden sind.
Wie wird der Vergleich mit anderen mittelalterlichen Karten angestellt?
Die Arbeit vergleicht die T-Schemakarten mit anderen, geographisch genaueren Karten des Mittelalters, um die Unterschiede und die Gründe für die unterschiedlichen Darstellungsweisen aufzuzeigen. Dieser Vergleich dient dazu, die spezifischen Merkmale und die Bedeutung der T-Schemakarten im Kontext der mittelalterlichen Kartografie zu verstehen.
- Quote paper
- Bastian Hefendehl (Author), 2003, 'T-Karten' und ihr Aufbau - Zu starke Unregelmäßigkeiten für ein Schema oder Variation gemeinsamer Ursprünge?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70169