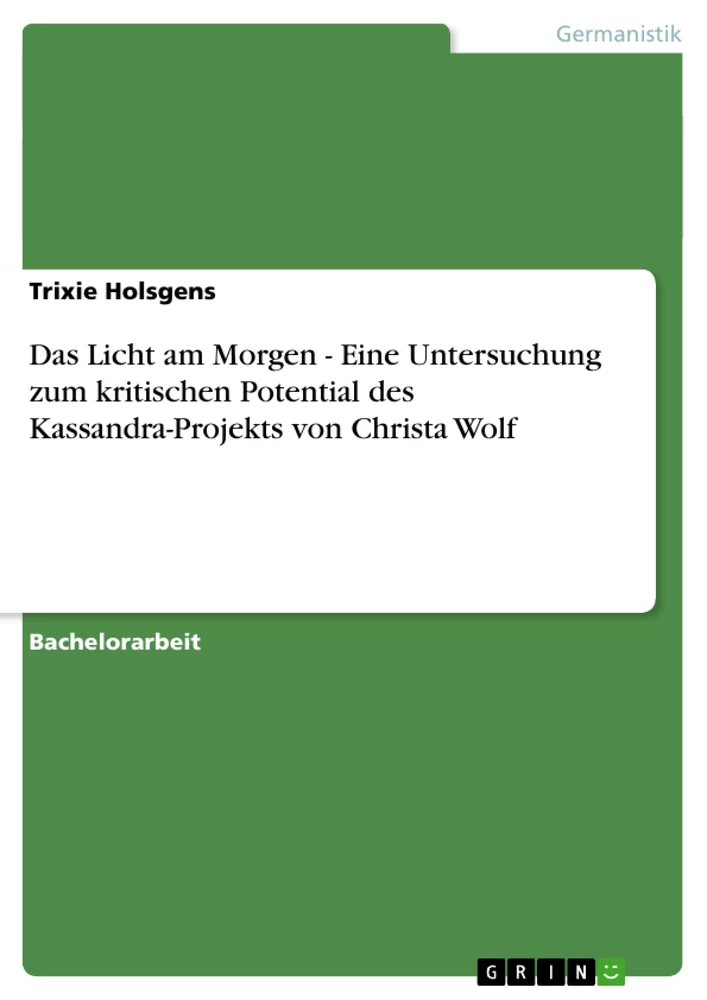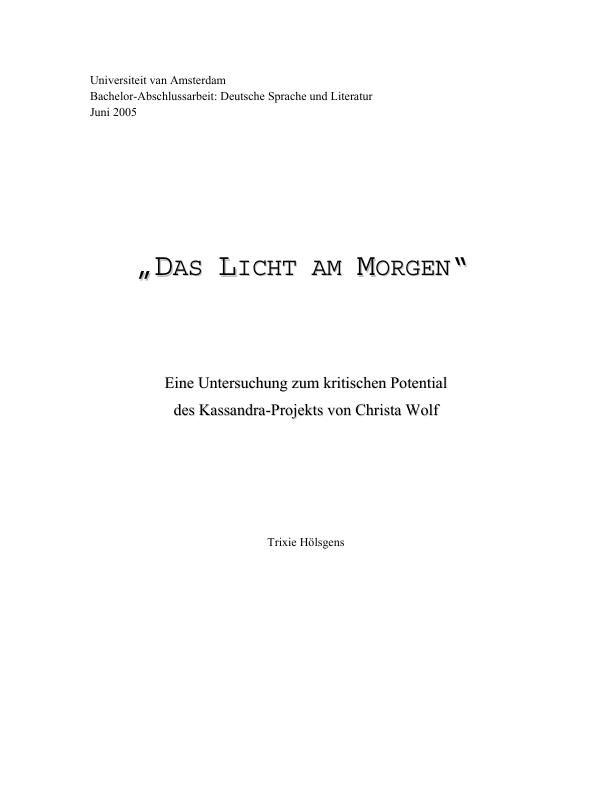Inhalt
Vorbemerkung
1. Einführung
2. Voraussetzungen einer Erzählung: Thematisierung der Autorschaft
2.1 Subjektive Authentizität: allgemein
2.2 Körperliche Präsenz: zur 1. und 2. Vorlesung: Reisebericht
3.Zivilisationskritik aus weiblicher Perspektive: Objektivierung & Krise
3.1 Ecriture féminine
3.2 Imaginierte Weiblichkeit
3.3.Das Objekt das zum autonomen Subjekt wird
4.Mythos und Aufklärungskritik: Dialektik der Aufklärung
4.1 Inhalt der Dialektik der Auklärung und Übereinstimmungen mit dem Kassandra-Projekt
4.2 Wolfs Kulturkritik in den Voraussetzungen und Unterschieden zur Dialektik der Aufklärung
5.Schlussfolgerung
Schlussbemerkung
Literaturverzeichnis
Der Splitter in deinem Auge ist das beste Vergrößerungsglas.
Theodor W. Adorno [1]
Vorbemerkung
Als ich die Erzählung Kassandra [2] zu lesen versuchte, fiel es mir anfangs schwer, sie zu verstehen. Ich las die Sätze immer wieder aufs neue und kam nicht von ihnen los. Ich kam also auch nicht gut voran mit der Lektüre. Als ich das Buch zu Ende gelesen hatte, waren einige Monate vergangen, obwohl ich mich fast jeden Tag mit dem Buch beschäftigt hatte. Ich blätterte hin und her und fand immer wieder wichtigere und schönere Sätze. Jetzt, vier Jahre und einige neue Lektüren später, ist mir klar geworden, dass genau diese Leseart die richtige war. Die Novelle ist verfasst worden in einer gesprochenen Sprache. Und obwohl man direkt von Kassandras Sprache angesprochen werden kann, braucht man Zeit, um diese Art von Schreiben zu überblicken und den Plot in der Erzählung zu finden. In den Voraussetzungen einer Erzählung: Kassandra[3] ist dieser rote Faden überhaupt nicht zu entdecken. Es wird sich erweisen, dass dieses Schreiben und Lesen auf Holzwegen wesentlich ist für die Bedeutsamkeit des Kassandra-Projekts von Christa Wolf.
1. Einführung
In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit unterschiedlichen Themen um das Kassandra-Projekt der Christa Wolf herum. In diesem Projekt, welches besteht aus vier Vorlesungen und einer Novelle, Kassandra, besteht, kritisiert Christa Wolf die abendländische Zivilisation. In den Voraussetzungen wird artikuliert, wie die Novelle aus moderner Gesellschaftskritik und persönlicher Krise entstand.
Im Gegensatz zur Novelle sind die Voraussetzungen einer Erzählung nur in beschränktem Maße in der Sekundärliteratur behandelt. Ich denke jedoch, dass die Novelle und ihre Voraussetzungen ein Ganzes bilden und meines Erachtens gibt es viele Gründe, die Vorlesungen näher zu untersuchen. Ziel dieser Arbeit ist daher, zu zeigen, dass die Entstehungsgeschichte der Wolfschen Kassandra mindestens gleich interessant ist wie die Erzählung. Die Gedankenströme in den vier Vorlesungen bilden, sowohl im gesellschaftlichen als im literaturtheoretischen Rahmen einen Ansatz zu einem ganz anderen Umgang mit der Welt.
Christa Wolf reist in das antike Griechenland und kommt zu der Schlussfolgerung, dass hier schon die Wurzeln der Destruktivität liegen. Die griechische Mythologie, wie sie überliefert wurde von vor allem Homer, kennt bereits Elemente der jetzigen, gefährlichen Rationalität.
In der Dialektik der Aufklärung von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer wird eine deutliche Verbindung zwischen Mythos und Rationalität erfasst. Die Ideen, die in dieser kritischen Betrachtung behandelt werden, wirken einleuchtend in Bezug auf die Motive und philosophischen Hintergründe in Wolfs anspruchsvollem Projekt.
Diese Arbeit kennt drei Hauptthemen. Zuerst werde ich Christa Wolfs ´Poetik´ betrachten. Diese Poetik bildet nämlich eine direkte Legitimation für meine Behandlung der Voraussetzungen einer Erzählung. Die Rolle der Autorin wird sich als ungemein wichtig erweisen für die Möglichkeit von engagierter Literatur und ist daher zweifelsohne wichtig für eine gerechte – gesellschaftskritische – Interpretation der Erzählung Kassandra.
Es gilt die Frage zu beantworten, warum Christa Wolf sich dafür entschieden hat, die vier Vorlesungen neben der Erzählung herauszugeben und in welchem Maße diese zwei unterschiedlichen Genres mit einander verknüpft sind. Begriffe, die hier behandelt werden, sind unter Anderem: subjektive Authentizität und körperliche Präsenz.
Das zweite Thema wird den genauen Inhalt der Wolfschen Zivilisationskritik erfassen. Zu diesem Thema gehört auch ihr Plädoyer für ein weibliches Schreiben. Christa Wolf ist der Meinung, dass die Sprache, und gerade auch die Sprache der Kunst, instrumentalisiert worden ist, und dass es gilt, die Sprache zurückzuholen in die direkte Erfahrungswelt. Den feministischen Einschuss – und seine Verknüpfung mit dem Pazifismus – werde ich hier betrachten im Lichte der écriture féminine.
Die Frage, die hier zu beantworten ist, ist, in wiefern Christa Wolf Erfolg hat in ihrer Suche nach einer neuen Sprache. Ich werde betrachten, woraus diese Sprache entsteht und in welcher Weise sie in der Tat eine Auswirkung haben kann auf die heutigen Probleme der zivilisierten westlichen Welt.
Das letzte Hauptthema dieser Arbeit beinhaltet die Weise, in der Adorno und Horkheimer in ihrer Dialektik der Aufklärung die Verbindung zwischen Mythos und dem rationalen Diskurs offenlegen. In diesem Projekt – welches als eine der wichtigsten Konkretisierungen der Kritischen Theorie betrachtet werden kann – wird nicht nur argumentiert, dass Mythologie bereits das Primat der Rationalität bildet, sondern auch, dass unsere Rationalität zurückschlägt in Mythologie[4]. Diese Ansichten stimmen meines Erachtens sehr überein mit denen von Christa Wolf.
Ich werde untersuchen, inwiefern diesen Vergleich gerechtfertigt ist, und welche fundamentalen Unterschiede aufzuweisen sind.
Als übergreifendes Thema wird sich Christa Wolfs Suche nach den Möglichkeiten der menschlichen Identität erweisen. Durch ihr ganzes Werk – sowohl in ihrem literarischen als auch in ihrem essayistischen – ist die Frage nach „Dieses Zu-sich-selber-Kommen des Menschen“[5] nachdrücklich anwesend.
2.Voraussetzungen einer Erzählung: Thematisierung der Autorschaft
Im Vorwort der vier Poetik-Vorlesungen begint Christa Wolf damit, ihrer Zuhörerschaft zu erklären, dass sie keine Poetik bieten kann. Der Begriff der Poetik, wie dieser formuliert wird von den antiken Autoren, beinhaltet eine systematische Form, welche die ästhetischen Positionen eines Autors bestimmen. Christa Wolf gibt zu, dass sie notwendigerweise von diesen Strukturen beeinflusst ist, aber sie hat kein Bedürfnis sich mit diesen Maßstäben auseinanderzusetzen.
[...] den wütenden Wunsch, mich mit der Poetik oder dem Vorbild eines großen Schreibers auseinanderzusetzen, in Klammern: Brecht, habe ich nie verspürt. Dies ist mir in den letzten Jahren merkwürdig geworden, und so kann es sein, daß diese Vorlesungen nebenbei auch die gar nicht gestellte Frage mitbehandeln, warum ich keine Poetik habe.[6]
Die Vorlesungen erweisen sich nicht nur als Voraussetzungen der Kassandra-Erzählung, sondern auch als Plädoyer für eine neue Art von Schreiben. Hierbei ist wichtig, dass dieses Plädoyer nicht eine solche normierende Form hat, sondern dass Christa Wolf versucht, in einer natürlichen Art zu schreiben. Sie versucht sozusagen, aus dem Bauch heraus zu schreiben, aber ohne den Intellekt zu vernachlässigen. Der bekannte Begriff der subjektiven Authentizität ist hier natürlich ganz wichtig.
2.1 Subjektive Authentizität: allgemein
Den Begriff der subjektiven Authentizität definiert Christa Wolf am deutlichsten in dem Gespräch mit Hans Kaufmann aus dem Jahre 1974[7]. In diesem Kontext ist vor allem der Nachdruck auf persönlicher Angst-Erfahrung wichtig. Wolf argumentiert, dass sowohl ihr essayistisches Werk als auch ihre Prosa ihren Anfang in der – oft beunruhigenden – Lebenserfahrung finden:
In sofern unterscheiden sich bei mir die einander ablösenden (oder einander durchdringenden) prosaistischen und essayistischen Äußerungen nicht grundsätzlich voneinander. Ihre gemeinsame Wurzel ist Erfahrung, die zu bewältigen ist: Erfahrung mit dem „Leben“ – also der unvermittelten Realität einer bestimmten Zeit und einer bestimmten Gesellschaft [...][8]
Es ist aber nicht nur eine gemeinsame Wurzel, die die zwei Gattungen teilen. Darüberhinaus ist nämlich ihr inhärentes Thema gleich: Es geht, sowohl in der Prosa als in den Essays, um den Mut, ´Ich´ zu sagen. An erster Stelle ist dieser Nachdruck auf dem ´Ich´ des Autors und seiner erlebten Wirklichkeit eine Auswirkung der Literatur-auffassung der DDR.
Der sozialistische Realismus – mit z. B. seinem Nachdruck auf dem Alltag –[9] hat einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf das Werk von Christa Wolf. Seit Nachdenken über Christa T hat sie sich jedoch von den strengen Maximen des sozial-realistischen Schreibens verabschiedet. Mit dem Kassandra-Projekt geht Christa Wolf weiter auf dem Weg der individuellen Identitätssuche unter Betracht der sozialistischen Bildungsideale, aber mit dem Nachdruck auf Subjektivität.[10]
In ihrem ganzen Œvre ist eine starke subjektive, sozialistische Literaturauffassung zurück zu finden. Bereits in ihrem Essay Lesen und Schreiben aus dem Jahre 1965[11] ist eine der wichtigsten Behauptungen, dass die zeitgemäße DDR-Prosa „das Subjektwerden des Menschen“ unterstützt. Dieses ´Subjektwerden´ bleibt immer ein Ziel ihrer Prosa, und ist auch nachdrücklich im Kassandra-Projekt anwesend. Christa Wolf widersetzt sich in diesem Sinne stark der Tendenz der poststrukturalistischen Literaturbetrachtung.
Die poststrukturalistische Literaturtheorie, und das postmoderne Denken im allgemeinen, hat als eins seiner wichtigsten Themen die Untergrabung der Idee des rationalen, autonomen Subjektes.[12] Christa Wolf lässt diese Überlegungen nicht nur links liegen – dies wäre nicht sehr bemerkenswert – , sondern sie geht stark in die umgekehrte Richtung. Ob Christa Wolf sich dagegen bewusst auflehnt, ist unwichtig. Sie hat immerhin nie das Bedürfnis gehabt, sich mit irgendeiner Poetik auseinanderzusetzen. Wohl relevant ist es, zu sehen, dass es in der postmodernen Literatur – wozu das Kassandra-Projekt meines Erachtens durchaus gehört – auch noch eine andere Tendenz gibt.
Das Kassandra-Projekt nimmt daher in der postmodernen westlichen Literatur eine interessante Stellung ein. Die Erzählung ist durchaus ein Beispiel der postmodernen Literatur. Die Thematisierung der Gewaltsamkeit von schriftlich überlieferter Geschichte und der Versuch, die destruktiven Strukturen ans Licht zu bringen, ist ein typisches Merkmal des Postmodernismus.[13] Auch die Dezentrierung, die sich in der Erzählung abspielt, steht in dieser Linie: Kassandra als objektivierte Außenseiterin ergreift das Wort und scheint zum ersten Mal eine Möglichkeit des Sprechens zu bekommen.[14] Mit dem Freilegen der Machtstrukturen und dem Kritisieren von Ideologie befindet dieses Werk sich also thematisch durchaus in der postmodernen Tradition. Andererseits scheint Christa Wolf in den Voraussetzungen festzuhalten an dem Glauben an ein – mehr oder weniger – harmonisches Selbst: sowohl die Verknüpfung von erlebter Wirklichkeit und Text, als die Identifikation von Autor und Erzähler entstehen aus der Hoffnung auf `Subjektwerdung`. Ihre Autorschaft ist eine subjektiv-authentische, was heißt, dass der Text nie ganz losgelöst sein wird von seiner Entstehungsgeschichte und daher auch nicht von seinem Autor. Dies ist eine bewusste Wahl von Christa Wolf und passt zu den Themen ihrer Prosa. Im Gespräch mit Hans Kaufmann spricht sie sich denn auch gegen die sogenannte objektivierende Autorschaft aus. Sie bekennt:
[..] daß in jener Art zu schreiben ein Element von Unredlichkeit mir aufstieß und mich zunehmend störte: die fatale Möglichkeit des Autors eben, sich hinter seinem „Material“, seinem „Thema“, „Stoff“, „Werk“ zu verschanzen; ein Objekt aus ihm – dem Werk – zu machen, mit dem er nach Belieben umspringen kann (wodurch er auch mit seinen Lesern als mit Objekten umspringt)[15]
Christa Wolf schreibt mit einer sehr starken Intention. In dem Kassandra-Projekt äußert sich diese Intention nicht nur in dem sozialistischen Engagement – wie es bereits in z.B. Der geteilte Himmel an die Oberfläche kam – , oder in der Thematisierung der Ich-Suche – welches eines der übergreifenden Themen in Christa Wolfs Gesamtwerk ist – , sondern auch in der direkten Thematisierung der Erzählerproblematik und Autorschaft.
Entstehungsgeschichte und Erzählung sind, wie sich im nächsten Paragraphen zeigen wird, zu eng miteinander verknüpft, um bei der Analyse der Prosa die eigene Erfahrung des Autors links liegen zu lassen. Christa Wolf schreibt durch ihr Engagement mit der Absicht, ihre Leser auf die Übereinstimmung zwischen den zwei Welten zu weisen: die Erfahrungswelt der Kassandra ist auch durch den Leser zu erfahren. Die Autorin ist hier jedoch mit ihrer ganzen Person die Vermittlerin. Eine textimmanente Lektüre der Erzählung ist daher nicht zu legitimieren: Damit wird gerade die Bedeutung und die gesellschaftliche Relevanz der Fiktion untergraben. Die Verbindung der realen Welt – und der gefährlichen politischen Lage dieser Welt – mit dem Mythos sind Teil der Erzählung. Der erste und letzte Abschnitt der Erzählung, die die Verbindung vom Jetzt mit dem Damals in sehr eindringlicher Sprache hervorheben, laden den Leser ein, über den Rand des Buches hinauszuschauen. Die Erzählung ist der Versuch, die Realität authentisch zu beschreiben, die Vorlesungen bilden die Methode, den Weg, zu diesem Ziel. Genau dies nennt Christa Wolf ´subjektive Authentizität´:
Die Suche nach einer Methode, dieser Realität schreibend gerecht zu werden, möchte ich vorläufig „subjektive Authentizität“ nennen – und ich kann nur hoffen, deutlich gemacht zu haben, daß sie die Existenz der objektiven Realität nicht nur nicht bestreitet, sondern gerade eine Bemühung darstellt, sich mit ihr produktiv auseinanderzusetzen.[16]
2.2 Körperliche Präsenz: zur 1. und 2. Vorlesung: Reisebericht
Innerhalb des Kassandra-Projektes liegt der Akzent auf der körperlichen Präsenz. Auch hiermit lehnt sich Christa Wolf auf gegen die heutigen Ideen über Diskursivität.
Um diese körperliche Präsenz zu erreichen, hat Christa Wolf sich auf den Weg nach Griechenland begeben. Die erste und zweite Vorlesung sind daher gestaltet in der Form eines Reiseberichtes.
Die Thematisierung der Reise ist auf verschiedenen Ebenen zu interpretieren. Zuerst begibt sie sich an Ort und Stelle, um mit ihrem Charakter in Dialog zu treten. Hierbei zeigt sie eine beeindruckende Offenheit und lässt sie die Umgebung auf eine zauberhafte Weise auf sich einwirken. Darüberhinaus ist es auch eine Reise tiefer in ihre eigene Welt: sie begibt sich in einen anderen Teil der Welt und bemerkt, dass ihre Sorgen auch in anderen Teilen der Welt gerechtfertigt sind. Damit wird die eigene apokalyptische Angst nicht relativiert sondern verallgemeinert und daher desto unentrinnbarer. Hieraus entsteht ein noch größeres Bedürfnis nach der Auseinandersetzung mit der Geschichte der Destruktivität. Christa Wolf versucht herauszufinden, wo die Wendepunkte oder die ´wunden Punkte´ sind.
Aber es ist auch eine ganz normale Reise: sie beschreibt die Menschen, die sie trifft, das griechische Essen und die Hotelzimmer. Die Vorlesungen sind so verfasst worden, als wären sie erdacht für einen Abend mit Freunden, die gespannt sind nach den Erlebnissen im fernen Land. Die Reise ist nicht nur metaphorisch, sondern auch direkt erlebte Wirklichkeit. Diese zwei Bedeutungsebenen sind ineinander verschmolzen.
Die Reise der Autorin zur Kassandra-Figur bedeutet also überhaupt keine Distanz zu ihrer eigenen Welt. Es gibt keinen Abstand, den sie zu überbrücken braucht.[17]
Kassandra. Ich sah sie gleich. Sie, die Gefangene, nahm mich gefangen, sie, selbst Objekt fremder Zwecke, besetzte mich. Später würde ich danach fragen, wann, wo und von wem die nötigen Übereinkünfte getroffen waren: Der Zauber wirkte sofort. Ihr glaubte ich jedes Wort, das gab es noch, bedingungsloses Vertrauen. Dreitausend Jahre – weggeschmolzen.[18]
In der ersten Vorlesung wird ihre „übergreifende Frage“, die sich richtet „gegen das unheimliche Wirken von Entfremdungserscheinungen“[19], schon schnell aufgegriffen. Christa Wolf zeigt eine bedingungslose Offenheit gegenüber dem, was geschehen wird. Sie lässt sich regieren vom Zufall, und versucht auch nicht, diesem sofort eine Bedeutung zu geben. Dies ist natürlich eine schwierige Aufgabe für eine Schriftstellerin.
Nicht das Gesetz, der Zufall würde unsere Reise regieren, ein selbstherrlicherer Herrscher, unberechenbar, schwer zu durchschauen, kaum zu überlisten, nicht zu kommandieren. Zufall – flüchtiger Stoff, ohne den keine Erzählung auskommt, die »natürlich« wirken will, aber wie schwer dingfest zu machen.[20]
Die erste Vorlesung, obwohl sie dicht durchwirkt ist von bildlicher, literarischer Sprache, thematisiert immer wieder die Verklammerung von Leben und Stoff: Es handelt sich um lebendiges Material. Die Umwelt, die objektive Wirklichkeit, wird in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis zur Autorin definiert. Das ´Ich´ des Autors ist hier also nicht sinngebende Instanz, sondern lässt sich von seiner Umgebung führen. Diese Art von `in der Welt sein` ist ein Gegenbeispiel zu den objektivierenden Methoden in der Politik und in der Kunst.
Wolf versucht, ihre Umgebung nicht als Objekt zu betrachten, sondern als Gesprächspartner. Das folgende Zitat bildet ein Beispiel für diesen Glauben an Unmittelbarkeit:
Der Stein weint, halten Sie das nicht für eine Metapher. Über die Gesichter der steinernen Mädchen sind Tränen geströmt, die sie zerfressen haben. Etwas, stärker als Kummer, hat sich in diese schönen Wangen eingegraben: saurer Regen, vergiftete Luft.[21]
Die Zerstörung der Umwelt (saurer Regen) ist eine Folge des inauthentischen Lebens. Das authentische, subjektive Schreiben ist also ein Beispiel für eine neue Weise in der Welt zu sein. Hiermit erhält die Literatur, wie es bei Christa Wolf immer der Fall ist, eine sehr konkrete politische Funktion. Destruktion der ´Mutter Erde´ und distanzierende Sprache sind eng miteinander verbunden. Die Harmonie soll wiederhergestellt werden. Christa Wolf scheint hier zurückzugehen zu einer romantischen Idee des organischen Ganzen: Das schreibende oder schöpferische Ich geht auf die Suche nach einem Einheitsgefühl mit dem Ganzen oder der Natur.
Absolute Stille, nur Vogelrufe. Die Farben. Grün und Weiß und Blau. Die Fülle der griechischen Frühlingsblumen. G. findet Thymian, den wir zwischen den Fingern zerreiben, um daran zu riechen. Lavendel. [...] Ganz deutlich spüre ich, wir sitzen innerhalb eines Zirkels, in den man Einblick hat von einer sehr frühen Vergangenheit her, wie auch wir imstande sind zu erfahren, was vor Zeiten hier geschah. Fühle, wie ein inneres Auge aufgeht, eine Berührung stattfindet, sehr leicht, beiläufig, unpathetisch, eher spöttisch.[22]
Christa Wolf akzentuiert hier das Unpathetische, weil das Ganzheitsgefühl für sie nicht etwas Künstliches, sondern gerade etwas Alltägliches ist. Das `innere Auge´ ist, vergleichbar mit der Sehergabe der Kassandra, nicht etwas Metaphysisches oder Paranormales, sondern eine direkte, für jeden zugängliche Welterfahrung.
Sie begibt sich also in die Tradition des Reiseberichts, indem sie neue Erlebnisse sucht. Sie stellt sich selbst aber nicht dar als eine schaffende Künstlerin, sondern als eine Person, die sich durchaus bewusst ist von ihrer Abhängigkeit von der Umwelt. Sie will ihrer Umgebung kein Unrecht tun. Sie will nicht objektivieren und darum nicht ´nur dichten´. Die erlebte Wirklichkeit kommt vor dem Text und die Sprache ist nicht allgegenwärtig. In der direkten Beschreibung – welche nicht nur ´stream of consciousness´ ist, sondern vor allem Kontakt zur Außenwelt und zum Mitmenschen – wird das Ideal der subjektiven Authentizität verwirklicht. Christa Wolf ist als Autorin fast identisch mit Kassandra.
Dann blickte ich auf und sah das Licht. Es war die siebte Abendstunde. Die Sonne, sehr tief, stand hinter uns und beleuchtete den Hafenbogen von Piräus, doch schien ein jeder Gegenstand in seiner eignen Farbe aus sich selbst, in einem Zauberlicht, das ich von da an keinen Abend mehr versäumte. So, in diesem Schein, mögen, falls die Schiffe der Archaier auch gegen Abend erst von Troias Küste abgelegt haben, die gefangenen Troerinnen, am Heck der Schiffe zusammengedrängt, die Trümmer ihrer Stadt zum letzten Mal gesehen haben. Das wird ihren Schmerz geschärft und zugleich jene Liebe verankert haben, an die sie sich in der Fremde werden halten können.
Von den Erzählern aber, die über sie geschrieben haben und die alle nicht dabei gewesen sind, hat keiner dieses Licht erwähnt.[23]
Dieses Zitat ist vielsagend über die Bedeutung der Voraussetzungen. Die Licht- Metapher deutet an, dass an dieser Stelle die Geschichte neu erhellt wird. Es gibt viele verschiedene Diskurse über den troianischen Krieg, aber all diese Geschichten haben nicht erklärt oder aufgeklärt, sondern sie haben – nach der Meinung Christa Wolfs – die Wirklichkeit eher verdunkelt und versteckt. Die mythische Kassandra ist in der Überlieferung zu einem Produkt ideologisch bestimmter Diskurse geworden.[24] Christa Wolf ist sich dessen sehr bewußt[25] und geht darum auf die Suche nach einer vor-sprachlichen Welt. Als Autorin befindet sie sich natürlich in einer schwierigen Position: sie ist völlig von Sprache – sogar von Schrift – abhängig.
Weil Christa Wolf sich bewusst ist von ihrer eigenen Subjektivität, ist ihr Kassandra-Projekt mehr als nur ein Diskurs über die alten Mythen. Ihr Umgang mit dem Mythos steht ganz in der Linie ihrer schon vorher artikulierten Gesellschafts- und Aufklärungskritik. Christa Wolfs Zurückgreifen auf den Mythos will nicht sagen, dass sie sich mit diesen Mythen besser identifizieren kann als mit der ´Vernunft´ oder dem ´Logos´. Das ganze Œvre der Christa Wolf könnte sich benennnen lassen als eine Suche nach dem Ungetrennten: der Zusammenarbeit von Mythos und Logos; Gefühl und Verstand. In der Erzählung lässt sie Kassandra diese Utopie formulieren:
Für die Griechen gibt es nur entweder Wahrheit oder Lüge, richtig oder Falsch, Sieg oder Niederlage, Freund oder Feind, Leben oder Tod. Sie denken anders. Was nicht sichtbar, riechbar, hörbar, tastbar ist, ist nicht vorhanden. Es ist das andere, das sie zwischen ihren scharfen Unterscheidungen zerquetschen, das Dritte, das es nach ihrer Meinung überhaupt nicht gibt, das lächelnde Lebendige, das imstande ist, sich immer wieder aus sich selbst hervorzubringen, das Ungetrennte, Geist im Leben, Leben im Geist.[26]
Die Vorlesungen könnten als ein Versuch betrachtet werden, dieser Spaltung von Leben und Geist, Idee und Erscheinung, Autor und Erzähler zu entkommen. Kunst und Leben sind keine Gegensätze, sondern sind miteinander in Übereinstimmung.
Mit dem Nachdruck auf Präsenz, wie es in der Reise-Erfahrung thematisiert wird, wird die poststrukturalistische Verabsolutierung der Sprache als nur Diskurs entlarvt. Christa Wolf versucht, aus diesem Diskurs des Objektivierens herauszutreten, indem sie Kassandra nicht nur beschreibt, sondern auch ihre Wirklichkeit erlebt. Sie versucht, dasselbe Licht zu sehen. Möglich, dass die Autorin sich mit den Vorlesungen in den Diskurs der mündlichen Überlieferung begibt. Und möglich auch, dass sie daher die Erzählung gerne als Teil dieses Projektes sieht, indem sie diese die fünfte Vorlesung nennt.[27]
Die Erfahrung vor Ort, die sich an erster Stelle auf einer nicht-sprachlichen Ebene abspielt, hat zur Folge, dass es sich hier um Kunst und Sprache handelt, die sinnlich und konkret ist, und sich daher nicht vom Leben abspaltet. Die Voraussetzungen einer Erzählung sind daher nicht nur eine Konkretisierung der subjektiven Authentizität, sondern auch ein Versuch, mittels der Präsenz in einer völlig neuen Umgebung zu neuen, nicht nur-subjektiven Ansichten zu geraten. Der Diskurs ist im Kassandra-Projekt – jedenfalls in den Voraussetzungen – nicht festgelegt, sondern offen und beweglich.[28]
Christa Wolf scheint überzeugt zu sein von ihrem zauberischen Verstehen und der direkten Einfühlung in die mythische Kassandra. Welche anderen Gründe – neben ihrem Ausgangspunkt der subjektiven Authentizität und ihrem Reise-Erlebnis – gibt es für diese Identifikationsmöglichkeit? Um diese Frage zu beantworten, werde ich Christa Wolfs feministische Überzeugungen – in ihrer Verknüpfung mit dem Pazifismus – näher untersuchen.
3.Zivilisationskritik aus weiblicher Perspektive:Objektivierung & Krise
Christa Wolfs neue Art zu schreiben hängt eng zusammen mit ihren feministischen Ansichten. In der dritten und vierten Vorlesung geht sie weiter ein auf die objektivierenden Kräfte, die sich in der abendländischen Geschichte auf Frauen abgesetzt haben. Die Offenheit zur Erfahrung erweist sich als eine Gegenkraft zur objektivierenden, männlichen Sprache.
3.1 Écriture féminine
É criture féminine kritisiert die Dominanz des Logozentrismus in der Philosophie und Wissenschaftstheorie. In diesem Denken in Ein-heiten ist kein Platz für das Denken in Zwei-heiten, die nicht in Hierarchien geordnet sind, wodurch das nicht-dominante Weibliche aus dem Denken ausgegrenzt wird. Écriture féminine zielt darauf, die bestehenden Eindeutigkeiten zu dekonstruieren.[29]
[...] as there are no grounds for establishing a discourse, but rather an arid millenial ground to break, what I say has at least two sides and two aims: to break up, to destroy, and to foresee the unforseeable, to project.[30]
In der Literatur der westlichen Welt hat sich eine objektivierende Tendenz entwickelt, die dafür gesorgt hat, dass die Frau nie ihre Geschichte erzählen konnte. Nach Cixous ist diese Art von Unterdrückung unverzeihbar, weil gerade die Literatur, das Schreiben, die Möglichkeit zu Veränderung in sich trägt. Literatur hätte ein Entstehungsraum für subversive Gedanken sein können und der Anfang von einer Transformation der sozialen und kulturellen Strukturen.[31]
Das neue Konzept der écriture féminine sollte also diese verpasste Chance wieder herstellen. Was dieses Konzept konkret beinhaltet ist gerade wegen seiner stark emotionalen Entstehungsgeschichte und seiner zutiefst subjektiven Auslegung nicht zu definieren.
It is impossible to define a feminine practice of writing, and this is an impossibility that will remain, for the practice can never be theorized, enclosed, encoded – which doesn´t mean that it doesn´t exist. But it will always surpass the discourse that regulates the phallocentric system; it does and will take place in areas other than those subordinated to philosophico-theoretical domination. It will be conceived of only by subjects who are breakers of automatisms, by peripheral figures that no authority can ever subjugate.[32]
Christa Wolf entdeckt in der Kassandra eine Frau, die versucht hat aus traditionellen Strukturen auszusteigen und auf diese Weise eine andere Dimension der Realität sieht. Kassandra bildet für Wolf eine andere Perspektive auf die Weltgeschichte als die patriarchalen Heroengeschichten. In den Voraussetzungen ist der Leser Zeuge, wie die Autorin versucht, mittels des weiblichen Schreibens, diesem Gefühl der Notwendigkeit der anderen Überlieferung – welche als eine moralische Pflicht erfahren wird – gerecht zu werden.
Es ist unentbehrlich für die Zukunft der Welt, dass nicht nur ein `blutroter Faden´[33] aus der Geschichte herausgerissen wird, – denn dies ist gerade der Faden der patriarchalen, objektivierenden Heldengeschichte, – sondern dass auch die unterdrückten Perspektiven ans Licht kommen.
3.2 Imaginierte Weiblichkeit
In Die imaginierte [34] Weiblichkeit zeigt Silvia Bovenschen die Verbindung zwischen der Abwesenheit von Frauen in der Geschichtsschreibung und der vielfältigen Thematisierung des Weiblichen in der Kulturgeschichte. Bovenschen benennt die Lücke in der modernen Zeit, wenn es darum geht, „hinter den seit Jahrhunderten die Vorstellungen vom Weiblichen konservierenden Frauenbildern das Historisch-Gesellschaftliche aufzudecken.“[35] Es erweist sich, dass es neben dem Bildnis der Frau kaum Zeugnisse der Präsenz der Frau gibt. ´Die Weiblichkeit´ hat keinen authentischen Ausdruck gefunden. Der genaue Inhalt von dem Konzept `Weiblichkeit` ist denn auch unbekannt. Bovenschen ist jedoch der Ansicht, dass gerade durch die Verbildlichung ein wichtiger Teil der Geschichte unterdrückt worden ist. Was die realen Frauen betrifft, ist die Geschichte „arm an überlieferten Fakten.“[36]
Christa Wolf sieht in Kassandra ein symptomatisches Beispiel dieser imaginierten Weiblichkeit:
Annahme: In Kassandra ist eine der ersten Frauengestalten überliefert, deren Schicksal vorformt, was dann, dreitausend Jahre lang, den Frauen geschehen soll: daß sie zum Objekt gemacht werden.[37]
Kassandra wurde nicht nur von ihren Zeitgenossen objektiviert – dies ist in der Tat eine Annahme – sondern – und das ist in diesem Kontext viel wichtiger – auch von der Geschichtsschreibung und Literatur. In den überlieferten Texten hat sie eine vorbestimmte Rolle: die der Wahnsinnigen.
Während ihrer Griechenland-Reise geht Christa Wolf auf die Suche nach der Kassandra, als sie noch nicht objektiviert war. Das Bedürfnis nach authentischem Erleben, einem direkten Kontakt mit dem, was vor dem Text steht, entsteht aus einem „Bewußtsein der Unangemessenheit von Worten vor den Erscheinungen, mit denen wir es jetzt zu tun haben.“[38]
Die „Abstraktionen füllen sich mit Fleisch und Blut“[39] und Wolf bemerkt hier dass das Schreiben der Erzählung schwieriger sein wird als sie dachte. Mit der Erzählung bekommt die Figur der Kassandra wieder einen Diskurs, sie wird imaginiert und verschwindet als lebendige Person. An diesem Punkt gerät Christa Wolf in eine Aporie. Die eigentliche Erfahrung, die sie als Mensch, als Frau, als Systemkritikerin, teilt mit Kassandra, ist nicht in ihrer Ganzheit in einer Erzählung zu fassen.
Empfinde die geschlossene Form der Kassandra-Erzählung als Widerspruch zu der fragmentarischen Struktur, aus der sie sich für mich eigentlich zusammensetzt. Der Widerspruch kann nicht gelöst, nur benannt werden.[40]
Mit der Publikation der V oraussetzungen versucht Wolf, ihre Leserschaft Zeuge werden zu lassen von der durch sie erfahrene Einfühlung und Identifikation mit der historischen Kassandra. Diese Kassandra wird jedoch nie ganz zum Sprechen kommen. Mit dem Anfang der Novelle verschwindet die lebendige Person im Diskurs. Mit dieser Ansicht bekommt der ohnehin schon mehr als doppelsinnige zweite Abschnitt der Novelle – „Mit der Erzählung geh ich in den Tod.“[41] – eine neue, noch beunruhigendere Interpretation. „Erlebte Diskursivität“[42] ist eine Illusion, die Autorin kann höchstens andeuten – und hierzu dienen, meiner Ansicht nach, die Voraussetzungen – , in welcher Richtung das Einverständnis mit der Kassandra zu finden ist.
3.3. Das Objekt das zum autonomen Subjekt wird
Trotz dieser Unmöglichkeit, Kassandra letztendlich das Wort zu geben, ist Kassandra, als Protagonistin der Erzählung, ein Beispiel der weiblichen Subjektwerdung. Dieser Prozess wird den Lesern vermittelt über die Annäherung der Autorin zur griechischen Antike. Den Schmerz, der verursacht wird durch die Verdinglichung und die Angst vor dem Weltuntergang, teilt die Autorin mit ihrer Protagonistin. Beide scheinen sich nicht nur – wie bereits erwähnt – in einem Zustand des apokalyptischen Weltschmerzes zu befinden, sondern auch in einer Art Identitätskrise.
Wäre also der Schmerz – eine besondere Art von Schmerz – der Punkt, über den ich sie mir anverwandle, Schmerz der Subjektwerdung?[43]
Das Bedürfnis, `Ich` zu sagen (und – wie es bei Kassandra der Fall ist – : „Nein.“), ist nachdrücklich bei der Autorin anwesend, und äußert sich in ihrem Plädoyer für authentisches, weibliches Schreiben. Bei Kassandra äußert sich diese unterdrückte Sehnsucht in dem Bedürfnis, mit ihrer eigenen Stimme zu sprechen, und zwar „das Äußerste.“[44] Der Umgang der Autorin mit Kassandra thematisiert diese Unterdrückung.
Kassandra erfährt, wie diese Operation lebendigen Leibes an ihr vorgenommen wird. Das heißt, es gibt reale Kräfte in ihrer Umgebung, die, je nach Bedarf, partielle Selbstverleugnung von ihr verlangen. Sie erlernt Abtötungstechniken.[45]
Mit Christa Wolfs Schreiben kommt Kassandra zur ´Subjektwerdung´. Dies ist jedoch ein schmerzhafter Prozess: Für Kassandra selbst[46], weil ihre Ansichten nicht von den Ihrigen akzeptiert wurden, aber auch für ihre geistige Mutter (oder Tochter!), Christa Wolf, die schreibend ihren eigenen Weg findet, und hierin von der Tradition eingeschränkt wird. Die Autorin, die im Einverständnis mit Kassandra ist, versucht der lebendigen Kassandra recht zu tun. Auch wenn es nicht die historische Kassandra ist, die tatsächlich eine Stimme bekommt, kann die Figur ein Gegenmodell bilden.
Schreiben für Frauen als ein Mittel, das sie zwischen sich und die Männerwelt legen. [...] Unvermeidlich der Moment, da die Frau, die schreibt (die, im Falle Kassandra »sieht«), nichts und niemanden mehr vertritt, nur sich selbst, aber wer ist das. Gibt es das ominöse Recht (oder die Pflicht) zur Zeugenschaft? Zählebige Unterstellung, es müsse immer geschrieben werden.[47]
Es scheint, die Autorin artikuliert hier ihre eigenen Schwierigkeiten mit der Suche nach dem ´Ich` innerhalb einer Gesellschaft, die voll Unbehagen und Sinn-Verlust ist[48] und wo außerdem die Privatmoral ausgeschaltet ist zugunsten der Gesetze der Apparate.[49]
Das Objektemachen: Ist es nicht die Hauptquelle von Gewalt? Die Fetischierung lebendig-wiedersprüchlicher Menschen und Prozesse in den öffentlichen Verlautbarungen, bis sie zu Fertigteilen und Kulissen erstarrt sind: selbst tot, andere erschlagend.[50]
Christa Wolf tut alles daran, nicht in dieser Linie weiterzuschreiben, und versucht mit aller Macht an einem lebendigen und widersprüchlichen ´Ich´ festzuhalten. Wie bereits ausgearbeitet wurde, ist diese zentrale Rolle der Autorschaft eine ziemlich seltene Erscheinung im Zeitalter des Poststrukturalismus. Dieser Glaube an die Möglichkeit eines autonomen Ichs ist dann auch weit mehr als, zum Beispiel, Spivaks Konzept des strategischen Essentialismus.[51] Wolfs ´Subjektwerdung´ kommt hervor aus Notwendigkeit, aber auch aus Überzeugung. Es ist die objektivierte, imaginierte Frau, die diese neue, subjektive Sprache zu sprechen versteht, und zwar weil sie, um mit Ingeborg Bachmann zu sprechen, mit ihrem „Dasein zur Sprache geht“.[52]
Aus der oben beschriebenen Unterdrückung, dem Objektivieren, das nach Christa Wolf vielleicht die Hauptquelle von Gewalt ist, entsteht eine Möglichkeit zu einer besseren, friedlicheren Welt. Weil die Frau nämlich nie am „Objektemachen“ teil hatte, sondern immer vom Mann zum Objekt gemacht wurde, könnte die Frau eine entscheidende Veränderung in den Werten der westlichen Welt herbeiführen.[53]
Aus dieser Krisen-Erfahrung kann eine neue Sprache entstehen, und das ist genau die Sprache, die Wolf in den Voraussetzungen artikuliert: Sprache, die bewegt und nur schreibt und spricht von eigenen Erfahrungen mit der Umwelt. Wiederum kann ein Zitat der Bachmann diese Art von Literatur am besten zusammenfassen: „Mit meiner verbrannten Hand schreibe ich von der Natur des Feuers.“ Das tiefste Unbehagen muß in einer gerechten Weise in Worte gefasst werden, und dies ist nur möglich, wenn der Autor, oder die Autorin, das bedrohende Gefühl genau kennt.
Die wirklich neue Art zu schreiben, das weibliche, subjektiv-authentische Schreiben, steckt daher nicht in der diskursiven Erzählung, sondern in dem Weg hierher: in der Verknüpfung von Leben und Stoff, in den Voraussetzungen, die ein literarisches Ereignis überhaupt möglich machen.
4. Mythos und Aufklärungskritik: Dialektik der Aufklärung
Adorno und Horkheimer sehen, so wie Christa Wolf, einen Zusammenhang zwischen destruktiver Rationalität und Subjektspaltung im Sinne von entfremdeter Wirklichkeits- und Selbstwahrnehmung.
Die Dialektik der Aufklärung ist eines der Hauptwerke der kritischen Theorie. Das Konzept kritische Theorie – wie es 1937 von Max Horkheimer introduziert wurde – hat drei Ziele. Zuerst soll sie gesellschaftliche Erscheinungen innerhalb einer historischen Perspektive interpretieren. Zweitens soll sie eine zukünftige Veränderung der Gesellschaft antizipieren. Drittens soll sie aus der Praxis entstehen und sich dessen auch bewusst sein. Sie ist daher auch selbstreflexiv. Kritische Theorien sind emanzipatorisch.[54]
Darüberhinaus ist die Dialektik der Aufklärung von einem starken Kulturpessimismus gezeichnet.
4.1 Inhalt der Dialektik der Auklärung und Übereinstimmungen mit dem Kassandra-Projekt
Adorno and Horkheimer kritisieren in der Dialektik der Aufklärung den abendländischen Umgang mit der instrumentellen Vernunft. Ideologie, Totalitarismus und Naturverlust – sowohl innere als äußere Natur – sind eine Folge dieser destruktiven, instrumentellen Rationalität. Adorno und Horkheimer sehen, genauso wie Christa Wolf, den Anfang der westlichen Kultur bei Homer. Der Mythos, wie er von Homer überliefert wurde, zeigt bereits die gefährlichen Elemente unserer Zivilisation.
Schon der orginale Mythos enthält das Moment der Lüge, das im Schwindelhaften des Faschismus triumphiert, und das dieser der Aufklärung aufbürdet. Kein Werk aber legt von der Verschlungenheit von Aufklärung und Mythos beredteres Zeugnis ab als das homerische, der Grundtext der europäischen Zivilisation.[55]
Das Projekt von Adorno und Horkheimer betont, obwohl es die Aufklärung nicht völlig rückgängig machen will, dass das Konzept des Fortschritts ein ideologischer Schleier wird, welcher den Menschen von der Natur entfremdet und hiermit seine eigene Vernichtung in sich trägt[56]. Technologischer und wissenschaftlicher Fortschritt geht Hand in Hand mit Destruktion. Aufklärung trägt den Keim ihrer eigenen Selbstzerstörerung in sich.[57] Adorno und Horkheimer wollen mit ihrem kritischen, negativen Projekt die westliche Welt bewusst machen von dieser Tendenz zur Destruktion, um in dieser Weise letztendlich die Aufklärung – und damit die Welt – von ihrem herannahenden Untergang zu retten.
Nimmt Aufklärung die Reflexion auf dieses rückläufige Moment nicht in sich auf, so besiegelt sie ihr eigenes Schicksal.[58]
Es scheint jedoch, dass Adorno und Horkheimer sehr skeptisch sind gegenüber einer derartigen Kursänderung. Das aufklärerische Denken hat sich nämlich schon soweit durchgesetzt, dass Aufklärung nicht mehr ansetzt zu kritischem Denken[59], sondern dass das aufklärerische Plädoyer für Rationalität sich völlig herausgebildet hat als instrumentelle Vernunft. Die Instrumentalität, ist, durch ihre Einseitigkeit, selber Mythos. ´Mythos´ ist hier zu verstehen als – um mit Christa Wolf zu sprechen – ´falsches Bewusstsein.´[60]
Im ersten Exkurs der Dialektik der Aufklärung („Odysseus oder Mythos und Aufklärung“) sehen Adorno und Horkheimer in der heroischen Geschichte des Odysseus einen destruktiven Hang nach Fortschritt. Odysseus muß sich selber `abtöten`[61] um sein Ziel zu erreichen. „Das Organ des Selbst, Abenteuer zu bestehen, sich wegzuwerfen, um sich zu behalten, ist die List.“[62] In diesem einseitigen, gradlinigen Denken sehen Adorno und Horkheimer die Destruktivität: Es ist der Mythos der nicht zu kritisierenden und nicht aufhaltbaren Aufklärung. Die kritische Theorie, und damit die Dialektik der Aufklärung, soll diese instrumentelle Vernunft entlarven.
In der Erzählung Kassandra gibt es deutlich sichtbare Übereinstimmungen mit diesen Ansichten. In der Sekundärliteratur sind diese beiden Bücher denn auch bereits verglichen worden.[63] Die Fetischisierung der Helena-Figur innerhalb der troianischen Stadtmauern und das instrumentelle, von Wirklichkeit entfremdete, Kriegsdenken des Königs Priamos sind zwei wichtige Beispiele dieser Übereinstimmungen.
Kassandra könnte, aus dieser Perspektive, durchaus betrachtet werden als die Personifizierung der kritischen Vernunft. Sie versucht, obwohl sie sehr geformt worden ist von der Palastwelt, ihre eigenen Ansichten aufzubauen. Die Erzählung zeigt Kassandras Prozess zur Subjektwerdung, indem sie sich, mit steigerndem Bewusstsein, (zuerst äußert sie sich in irrationalen, hysterischen Anfällen) gegen ihren Vater und damit gegen das Patriarchat ausspricht.
[Köning Priamos:] Es geht doch um die Ehre unseres Hauses.
[Kassandra:] Darum, beteuerte ich ihm, ging es auch mir. Vernagelt war ich. Dachte, sie und ich, wir wollten doch dasselbe. Und welche Freiheit dann das erste Nein: Nein, ich will etwas andres. Doch damals nahm, mit Recht, der König mich beim Wort. Kind, sagte er, zog mich zu sich heran, ich atmete den Duft, den ich so liebte. Kind. Wer jetzt nicht zu uns hält, arbeitet gegen uns.[64]
Es mag deutlich sein, dass Christa Wolfs Kritik starke Übereinstimmungen kennt mit Adornos und Horkheimers Ansichten. Auch in den Voraussetzungen gibt es den gleichen, pessimistischen und warnenden Ton, den wir kennen aus der Dialektik der Aufklärung. Und das obwohl im offiziellen Denken der DDR das Buch, wegen seiner Auswegslosigkeit, ein Tabu war.[65]
Wem soll man sagen, daß es die moderne Industriegesellschaft, Götze und Fetisch aller Regierungen, in ihrer absurden Ausprägung selber ist, die sich gegen ihre Erbauer, Nutzer und Verteidiger richtet: Wer könnte das ändern. Der Wahnsinn geht mir nachts an die Kehle.[66]
Obwohl Christa Wolf sich nicht persönlich mit den Ideen von Adorno, Horkheimer oder anderen Mitgliedern der Frankfurter Schule auseinandergesetzt hat[67] (auch hierzu hat sie wahrscheinlich – wie zu einer Auseinandersetzung mit den Poetikern – nie das Bedürfnis gefühlt) sind die Übereinstimmungen zwischen den beiden Arten von Zivilisationskritik erstaunlich. Diese Ähnlichkeit lässt sich zusammenfassen als die radikale Kritisierung der instrumentellen Vernunft,[68] und das – mehr oder weniger konkretisierte – Plädoyer für eine kritische Vernunft. Die Unterschiede sind jedoch, im Kontext dieser Arbeit, von größerer Wichtigkeit.
4.2 Wolfs Kulturkritik in den Voraussetzungen und Unterschiede zur Dialektik der Aufklärung
Christa Wolfs Zivilisationskritik findet ihren Ursprung in der Kritik an objektivierender Sprache (siehe 2) und in der Thematisierung der Unterdrückung des Weiblichen (siehe 3). Christa Wolfs übergreifendes Thema – die Frage nach dem Zu-sich-selber-Kommen des Menschen –, welches natürlich in die beiden Subthemen eingeflochten ist, sorgt für eine andere Art von Kulturkritik.
Wie bereits besprochen in Bezug auf Wolfs Thematisierung der Autorschaft, ist Wolf der Meinung, dass ein Mensch die moralische Pflicht hat, ein ´Ich´ zu bilden. Dies ist möglich weil der Mensch nicht immer schon von seiner Natur entfremdet war. Wenn Christa Wolf über Unbehagen spricht, meint sie kein dem Menschen inhärentes Unbehagen, sondern die Leere der heutigen Welt.[69] Christa Wolf verknüpft hier die Angst vor dem Weltuntergang („Australien ist kein Ausweg.“) mit „Sinn-Verlust.“ Der Mensch braucht eine neue Sinngebung, aber diese ist „durch die verbrauchten Institutionen – woran viele gewohnt waren – [...] nicht zu erhoffen.“[70] Anstatt es in Institutionen zu suchen, geht Christa Wolf auf die Suche nach bescheidener Sinngebung in der Privatsphäre. Die Tagesgenüsse, das „Licht am Morgen“ und „die duftende Wäsche im Wind, der von der See her kommt“[71], sind Ansätze zu Zukunft in der Gegenwart.[72]
Wo Adorno und Horkheimer noch in der Freudschen Tradition stehen, die bereits innerhalb des Menschen einen destruktiven Trieb erkennt, ist Wolf voll Überzeugung auf der Suche nach der – trotz allem – Liebe zum Leben. Die Selbsterfahrung und die Sinnlichkeit werden zum Ausweg aus der Krise. Gewaltsame Subjektspaltung und Instrumentalisierung sind bei Wolf die Folge einer Reihe von falschen Entscheidungen aus der Vergangenheit, und daher – in Zukunft – möglicherweise überwindbar.
Sie weiß vom „ästhetischen Dualismus“, worüber Adorno und Horkheimer sprechen, und sie sieht auch seine Verbundenheit mit der geschichtsphilosophischen Tendenz,[73] aber sie geht, mittels des authentischen Erlebens, zurück zum Mythos, bevor er vom Diskurs aufgespalten wurde; zurück zur Einheit. Sie versucht dieses andere Zeugnis – weil sie es zum Überleben braucht – an die Welt zu übertragen.
Sie will einen anderen Anfang der abendländischen Kultur an Stelle der Homerschen „Verherrlichung eines Raubkrieges.“[74] Adorno und Horkheimer sehen „kein beredteres Zeugnis als das von Homer“, Christa Wolf aber, glaubt die Worte von Homer nicht. Wie sie auch nicht bedingungslos an Shakespeare glaubt, anders als Adorno und Horkheimer: „Die Einheit der Persönlichkeit war als Schein durchschaut seit Shakespeares Hamlet.“[75] Christa Wolf versucht selbstständig und kritisch in der Welt zu sein. Der Zweifel an der Einheit der Persönlichkeit, ist ihr zwar nicht unbekannt, aber mittels eigener Erfahrung versucht sie den Skeptizismus zu überwinden.
Adorno und Horkheimer bieten, wie die modernistische Literatur „Nicht mehr Lebens-, nur noch Sterbenshilfe.“[76] Dass bedeutet natürlich nicht, dass Christa Wolf jetzt eine bessere Zivilisationskritik formuliert hat als Adorno und Horkheimer. Es ist nur so, dass Wolf ausgeht von der Positivität, der Liebe zum Leben, wo Adorno und Horkheimer den Pessimismus vertreten. Ihre Argumentation in Negationen gehört zum Stil und ist nicht ausschließlich nihilistisch, sondern trägt hierin ein kritisches Potential.
Christa Wolf könnte in ihrer Suche nach einem Ausweg als naiv betrachtet werden. Meiner Meinung nach ist ihr Projekt dazu zu sehr durchdrungen von Subjektivität und erlebter Wirklichkeit. Sie hält fest an ein Zukunftsbild aus Notwendigkeit.
5. Schlussfolgerung
Das weibliche Schreiben kann ein autonomes, ungespaltenes Subjekt konstituieren und gerade diese ganzheitliche Identität ist imstande, eine positive, konstruktive Kritik aufzubauen. Das Schreiben dient als Zeugnis für eine andere nicht-destruktive Möglichkeit, in der Welt zu sein. Schreiben ist ein Versuch gegen die Kälte[77], aber es ist vor allem ein Versuch gegen die Blendung und Vernichtung des Lichtes, heller als tausend Sonnen.[78] Dieser Auftrag, den sie sich selbst auferlegt, ist jedoch alles andere als einfach:
Schreibend, ja aber wie denn unter dieser glühenden Vernunft-Sonne, in diesem rigorös bewirtschafteten, vermessenen und enträtselten Gelände.[79]
Auch aus ihrer sehr pessimistischen Büchner-Preis-Rede, nur kurze Zeit vor dem Verfassen des Kassandra-Projektes entstanden, spricht ein grundsätzlicher Zweifel an der Möglichkeit einer kritischen und friedlichen Vernunft.
Wir, ernüchtert bis auf die Knochen, stehn entgeistert vor den vergegenständlichten Träumen jenes instrumentalen Denkens, das sich immer noch Vernunft nennt, aber dem aufklärerischen Ansatz auf Emanzipation, auf Mündigkeit hin, längst entglitt und als blanker Nützlichkeitswahn in das Industriezeitalter eingetreten ist.[80]
Aus diesem Zitat spricht jedoch auch ein Glaube an Aufklärung im Sinne von Emanzipation. Diese Emanzipation der Unterdrückten ist die Möglichkeit zur Kritik und Veränderung. Wie bereits ausgearbeitet (siehe 2) ist die Person, die objektiviert wurde, zuerst – und zwar aus Not – imstande, sich zu einem autonomen Subjekt zu entwickeln. Adorno und Horkheimer sehen zwar die Unterdrückung der Frau, aber sie sehen nicht, dass hierin eine Öffnung in der Prädestination der westlichen Zivilisation besteht. ´Subjektwerdung´ fungiert bei Wolf als ein Mittel gegen die pervertierende Vernunft und bildet eine Gegenbewegung zur Destruktivität.
Frage: „was von heute aus und aus den Voraussetzungen dieser Zivilisation (überhaupt noch) Fortschritt sein könnte, da doch der männliche Weg, alle Erfindungen und Verhältnisse und Gegensätze auf die Spitze zu treiben, bis sie ihren äußersten negativen Punkt erreicht haben: jenen Punkt der alternativlos bleibt, beinah an sein Ende gelangt ist.[81]
Der „moralische Mut des Autors zur Selbstkenntnis“[82], muss ihren Lesern übergebracht werden. Dazu dient die Literatur. Literatur unterstützt das Subjekt-werden des Menschen und die Welt braucht diese kritischen ´Subjekte´. Es müssen neue Entscheidungen getroffen werden. „Literatur heute muß Friedensforschung sein.“
Diese Ansichten über die mögliche Einheit der Person sind nicht Folge eines Essentialismus, und schon überhaupt nicht eines `strategischen Essentialismus`[83], sondern sie entstehen aus einem kritischen Humanismus. Christa Wolf hegt – meiner Ansicht nach – keinen zweifelsfreien Glauben an die idealistische Einheit des Ichs: Die Charaktere ihrer Erzählungen sind immer gekennzeichnet von dem inneren Konflikt. Die Überzeugung der Notwendigkeit eines derartigen Glaubens ist wohl sichtbar. Sowohl sie selbst, als ihre Romanfiguren – und Kassandra voran – sind gekennzeichnet durch ihre Suche nach Identität. Wolfs Konzept des Subjekts ist daher eher humanistisch-existentiell als esssentiell[84] zu nennen. Wir wissen immer noch nicht, was es ist: dieses „Zu-sich-selber-Kommen des Menschen“; trotzdem gilt es – durch den unmittelbaren Kontakt zur Welt – ein Ich darzustellen, das die richtigen Entscheidungen trifft. Die Frage nach dem Ich ist des Menschen moralische Pflicht. Eine klare oder eindeutige Antwort ist jedoch nicht zu erwarten und auch nicht wünschenswert. Die Literatur, und die Kunst im Allgemeinen, soll nicht in Ideologie verfallen, sondern „große Fragen stellen und nicht lockerlassen.“[85]
Der Identitätsbegriff bei Christa Wolf ist offen und beweglich, und in dieser Offenheit für die Einflüsse von außen entsteht die Möglichkeit von Einfühlung. Die Weise, in der Christa Wolf sich in Kassandra, aber auch in Ingeborg Bachmann und Marie-Luise Fleißer einfühlt, ist vielleicht der Weg zur „Schwesterlichkeit“[86] und kann den Weg zu einer neuen Art Aufklärung bilden.
Gab es Kreuz- und Wendepunkte, an denen die Menschheit, will sagen: die europäische und nordamerikanische Menschheit, Erfinder und Träger der technischen Zivilisation, andere Entscheidungen hätte treffen können, deren Verlauf nicht selbstzerstörerisch gewesen wäre? War denn, fragen wir uns, mit der Erfindung der ersten Waffen – zur Jagd –, mit ihrer Anwendung gegen um Nahrung rivalisierende Gruppen, mit dem Übergang matriarchalisch strukturierter, wenig effektiver Gruppen zu patriarchalischen, effektiveren, der Grund für die weitere Entwicklung gelegt? [...] Hätte es, für unsere Länder, irgendeine Möglichkeit gegeben, aus diesem Wettlauf auszusteigen, indem wir uns auf andre Werte orientiert hätten?[87]
Es ist noch immer die Kunst die imstande ist, andere Werte ans Licht zu bringen und die die Zeit überwinden kann. Diese Kunst sollte sich jedoch niemals von der Wirklichkeit entfernen, und auch nicht von ihrer Entstehungsgeschichte. Nur in dem menschlichen Kontakt, in der Intersubjektivität, kann Veränderung und erneute Lebenslust entstehen.
Kassandra, wie sie von Christa Wolf gesehen wird, „hält die Erinnerung an eine Zukunft in uns wach, von der wir bei Strafe unseres Untergangs nicht lossagen dürfen.“[88] Vielleicht kann die Literatur, wenn sie menschliche Geschichten von Schmerz, Angst, Krise und Subjektwerdung erzählt, dafür sorgen, dass an neuen „Kreuz- und Wendepunkten“ – wenn diese sich noch bieten – die europäische Menschheit andere Entscheidungen trifft.
Schlussbemerkung
In dieser Arbeit habe ich versucht, die Voraussetzungen zur Kassandra-Erzählung in drei Themen aufzuteilen und sie anhand dieser Struktur zu analysieren. Die Thematisierung der Autorschaft, des Feminismus und der Zivilisationskritik sind jedoch – wie in diesem Moment deutlich sein mag – nicht voneinander zu trennen. Weil ich der Meinung bin, dass ich hiermit dem Kassandra-Projekt nicht gerecht sein würde, habe ich auch nicht versucht, dieser gegenseitigen Durchdringung der Themen entgegenzuwirken. Es scheint mir denn auch, dass diese Arbeit zeigt, dass eine lineare Analyse der vier Vorlesungen sowohl unmöglich als nicht wünschenswert ist.
Literaturverzeichnis
- Adorno, Theodor W.: Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1964.
- Bachmann, Ingeborg: „[Über Gedichte]“ In: Gesammelte Werke in vier Bänden. Band 4: Essays, Reden, vermischte Schriften, Anhang. München/Zürich: R.Piper & Co. Verlag 1993.
- Bertens, Hans: Modern Literary Theory: The Basics. London: Routledge 2001.
- Beutin, Wolfgang u.A.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 6. Auflage. Stuttgart und Weimar: Verlag J.B. Metzler 2001.
- Boussart, Monique: Zur Verschränkung von Feminismus und Pazifismus bei Christa Wolf. In: Christa Wolf in feministischer Sicht. Hrsg. von Michel Vanhelleputte. Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang 1992. S. 91 – 103.
- Bovenschen, Silvia: Die imaginierte Weiblichkeit. Exemplarische Untersuchungen zu kulturgeschichtlichen und literarischen Präsentationsformen des Weiblichen. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1979.
- Christmann, Stefanie: Auf der Suche nach dem verhinderten Subjekt: DDR-Prosa im Licht der Frankfurter Schule. Würzburg: Köningshausen & Neumann 1990.
- Emmerich, Wolfgang : Kleine Literaturgeschichte der DDR. Erweiterte Neuausgabe. Berlin: Aufbau Verlag 2000.
- Horkheimer, Max & Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. 14. Auflage. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 2003.
- Leezenberg, Michiel & Gerard de Vries: Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen. 3. korrigierte Auflage. Amsterdam: Amsterdam University Press 2003.
- Leitch, Vincent B.: The Norton Anthology of Theory and Criticism. New York and London: W.W. Norton and Company 2001.
- Lyotard, Jean-Francois: Le Differend. Paris: Minuit 1983.
- Nickel-Bacon, Irmgard: Schmerz der Subjektwerdung. Ambivalenzen und Widersprüche in Christa Wolfs utopischer Novellistik. (Studien zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, 12) Diss. Univ. Köln. Tübingen: Stauffenberg 2001.
- Wander, Maxie: Guten Morgen, du Schöne. Protokolle nach Tonband. 8. Auflage. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2003.
- Weinhold, Ulrike: „Christa Wolfs Kurze Reise in den Mythos: (Verpasste) Chancen des Kassandra-Projekts“. In: Neophilologus, Volume 88, Number 4. Kluwer Academic Publishers 2004. S. 587 – 613.
- Wolf, Christa: Die Dimension des Autors. Band I und II. Essays und Aufsätze, Reden und Gespräche 1959-1985. Berlin und Weimar: Aufbau Verlag 1986.
- Wolf, Christa: Kassandra. 5. autorisierte Auflage München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1997.
- Wolf, Christa: Medea: Stimmen. 6. Auflage. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1998.
- Wolf, Christa: Nachdenken über Christa T. Neuausgabe. München: Luchterhand Literaturverlag 2002.
- Wolf, Christa: Voraussetzungen einer Erzählung: Kassandra. Frankfurter Poetik-Vorlesungen. 2. autorisierte Auflage. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1998.
[...]
[1] Theodor W. Adorno: Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1964. S. 57.
[2] Christa Wolf: Kassandra. 5. autorisierte Auflage München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1997. Im Folgenden zitiert als: Kassandra.
[3] Christa Wolf: Voraussetzungen einer Erzählung: Kassandra. Frankfurter Poetik-Vorlesungen. 2. autorisierte Auflage. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1998. Im Folgenden zitiert als: VeE.
[4] Max Horkheimer & Theoder W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. 14. Auflage. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 2003. Im Folgenden zitiert als: DdA.
[5] Christa Wolf zitiert Johannes R. Becher in: Nachdenken über Christa T. Neuausgabe. München: Luchterhand Literaturverlag 2002. S. 8.
[6] VeE. S. 9.
[7] Christa Wolf: Die Dimension des Autors. Band II. Essays und Aufsätze, Reden und Gespräche 1959-1985. Band II. Berlin und Weimar: Aufbau Verlag 1986. S. 317.
[8] Christa Wolf: Die Dimension des Autors, a.a.O., S. 318.
[9] Wolfgang Beutin u.A.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 6. Auflage. Stuttgart und Weimar: Verlag J.B. Metzler 2001. S. 524.
[10] Vgl. Wolfgang Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR. Erweiterte Neuausgabe. Berlin: Aufbau Verlag 2000. S. 209 ff.
[11] Christa Wolf: Die Dimension des Autors. Band II, a.a.O., S. 7 – 48.
[12] Vgl. z.B. Hans Bertens: Modern Literary Theory: The Basics. London: Routledge 2001. S. 136 – 137.
[13] Vgl. z.B. Jean-Francois Lyotard: Le Differend. Paris: Minuit 1983. In diesem Werk argumentiert Lyotard dass die sprachliche Ordnung der Wirklichkeit immer Objektivierung und Ausschließung mit sich mitbringt.
[14] Vgl. z.B. Hans Bertens, a.a.O., S. 129 – 132.
[15] Christa Wolf : Die Dimension des Autors. Band II, a.a.O., S. 324.
[16] Christa Wolf : Die Dimension des Autors. Band II, a.a.O., S. 324 – 325.
[17] Vgl.: Christa Wolf: Medea: Stimmen. 6. Auflage. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1998. S. 9: „Die Jahrtausende schmelzen unter starkem Druck. Soll also der Druck bleiben. Müßige Frage.“
[18] VeE. S. 14.
[19] VeE. S. 11.
[20] VeE. S. 13.
[21] VeE. S. 29.
[22] VeE. S. 40.
[23] VeE. S. 52, 53.
[24] Vgl. Ulrike Weinhold: „Christa Wolfs Kurze Reise in den Mythos: (Verpasste) Chancen des Kassandra-Projekts“. In: Neophilologus, Volume 88, Number 4. Kluwer Academic Publishers 2004. S. 587 – 613. S. 587: „In den Voraussetzungen wie auch in Kassandra macht Christa Wolf überdies immer wieder klar, dass die bisherige wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Mythos und Frügeschichte auch nur Diskurse erbracht hat, die es ihrerseits keineswegs an ideologisch geprägter, patriarchalisch bestimmter Mythologisierung seitens der betreffenden Wissenschaftler (wie auch Künstler: Thomas Mann) fehlen lassen.“
[25] Wie sich erweist aus den Satz: „Die Figur verändert sich andauernd, indem ich mich mit Material befasse.“ VeE. S. 119.
[26] Kassandra: S. 112.
[27] VeE. S. 11.
[28] Vgl. Ulrike Weinhold, a.a.O.: Die direkte zauberische Verbindung zwischen Mythos und Realität nennt Weinhold „erlebte Diskursivität“. S. 591.
[29] Vgl. Hans Bertens, a.a.O., S. 164 – 167.
[30] Hélène Cixous, The Laugh of the Medusa. In: Vincent B. Leitch: The Norton Anthology of Theory and Criticism. New York and London: W.W. Norton and Company 2001. S. 2039 - 2040
[31] Cixous, a.a.O., S. 2043
[32] Cixous, a.a.O., S. 2046
[33] Siehe VeE. S. 170.
[34] Silvia Bovenschen: Die imaginierte Weiblichkeit. Exemplarische Untersuchungen zu kulturgeschichtlichen und literarischen Präsentationsformen des Weiblichen. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1979.
[35] Bovenschen, a.a.O., S. 9.
[36] Bovenschen, a.a.O., S. 11.
[37] VeE. S. 101.
[38] VeE. S. 99.
[39] VeE. S. 138.
[40] VeE. S. 140.
[41] Kassandra. S. 5.
[42] Vgl. Ulrike Weinhold, a.a.O.
[43] VeE. S. 104.
[44] Kassandra. S. 6.
[45] VeE. S. 103.
[46] Vgl. Irmgard Nickel-Bacon: Schmerz der Subjektwerdung. Ambivalenzen und Widersprüche in Christa Wolfs utopischer Novellistik. (Studien zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, 12.) Diss. Univ. Köln. Tübingen: Stauffenberg 2001.
[47] VeE. S. 105.
[48] VeE. S. 113.
[49] VeE. S. 114.
[50] VeE. S. 133.
[51] Hans Bertens, a.a.O., S. 210.
[52] Ingeborg Bachmann: „[Über Gedichte]“. In: Gesammelte Werke in vier Bänden. Band 4: Essays, Reden, vermischte Schriften, Anhang. München/Zürich: R.Piper & Co. Verlag 1993. S. 216.
[53] Monique Boussart: „Zur Verschränkung von Feminismus und Pazifismus bei Christa Wolf“. In: Christa Wolf in feministischer Sicht, Hrsg. von Michel Vanhelleputte. Frankfurt am Main: Verlag Peter Lang 1992. S. 91 – 103 (hier: S. 93).
[54] Vgl. Michiel Leezenberg & Gerard de Vries: Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen. 3. korrigierte Auflage. Amsterdam: Amsterdam University Press 2003. S. 180 – 181.
[55] DdA. S. 52.
[56] Siehe hierzu z.B. DdA. S. 46: „Die Menschen distanzieren denkend sich von Natur, um sie vor sich hinzustellen, wie sie zu beherrschen ist.“
[57] DdA. S. 3.
[58] DdA. S. 3.
[59] Vgl. Immanuel Kant: „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ http://gutenberg.spiegel.de/kant/aufklae/aufkl001.htm (20.6.2005). S. 1: „Sapere aude! Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“
[60] VeE. S. 121.
[61] Wie Kassandra es auch erlernen muß. Vgl. VeE. S. 103.
[62] DdA. S. 55.
[63] Siehe für eine sehr ausführliche und textnahe Interpretation der Kassandra-Erzählung mit Hilfe der Ideen der Dialektik der Aufklärung: Stefanie Christmann: Auf der Suche nach dem verhinderten Subjekt: DDR-Prosa im Licht der Frankfurter Schule. Würzburg: Köningshausen & Neumann 1990.
[64] Kassandra. S. 75.
[65] Wolfgang Emmerich, a.a.O., S. 274.
[66] VeE. S. 113.
[67] Stefanie Christmann, a.a.O., S. 9: „Christa Wolf selbst erklärte auf meine Anfrage hin in einem Brief vom 15. August 1988 daß sie Arbeiten der Frankfurter Schule (gefragt war speziell nach Horkheimer, Adorno, Fromm und Marcuse) kaum kenne bzw. erst sehr spät gelesen habe. Von einer gezielten Auseinandersetzung mit theoretischen Darlegungen kann also in bezug auf ihre Texte aus den Jahren 1968, 1976 oder 1983 nicht die Rede sein.“
[68] Die DDR-Literatur in den letzten zwei Jahrzehnten ihres Bestehens ist, zum größten Teil, eine Literatur der radikalen Zivilisationskritik. Vgl. Wolfgang Emmerich, a.a.O., S. 551.
[69] VeE. S. 113.
[70] VeE. S. 113.
[71] VeE. S. 127.
[72] Christa Wolf versucht in ihrem Werk diese gegenwärtigen und konkreten Betrachtungen der Zukunft darzustellen. In Lesen und Schreiben thematisiert sie das Bedürfnis an Zunkunftsperspektive. Wolf sucht nach einer Gattung die dienen kann als „ein Mittel Zukunft in die Gegenwart hinein vorzuschieben.“ Christa Wolf : Die Dimension des Autors. Band II, a.a.O., S. 34.
[73] Vgl. DdA. S. 52: „Bei Homer treten Epos und Mythos, Form und Stoff nicht sowohl einfach auseinander, als daß sie sich auseinandersetzen.“.
[74] VeE. S. 26.
[75] DdA. S. 165.
[76] Christa Wolf: „Von Büchner sprechen.“ In: Die Dimension des Autors. Band II, a.a.O., S. 155 – 169 (hier: S. 157).
[77] VeE. S. 127.
[78] Vgl. Die Dimension des Autors. Band II, a.a.O., S. 157.
[79] VeE. S. 179.
[80] Ein anderes Zitat, aus dem Wolfs Pessimismus und Angst sprechen: Christa Wolf : Die Dimension des Autors. Band II, a.a.O., S. 156: `Büchner hat so früh, und ich glaube, mit Grauen gesehen, daß die Lust, die das neue Zeitalter an sich selber fand, an ihrer Wurzel mit Zerstörungslust verquickt war. Doch die voll ausgebildete Fratze jenes Paradoxons, das Schöpfung an Vernichtung koppelt, hat er nicht erblickt, ein Wort wie „Megatote“ nicht gekannt, die Liebe zum Tod hat er seinen Figuren eingegeben, daß man aber eine perfekte, wenn auch mörderische technische Lösung „süß“ nennen, daß man auf Raketenrümpfe Frauennamen schreiben würde – das wäre auch ihm nicht in den Sinn gekommen.`
[81] VeE. S. 118.
[82] Die Dimension des Autors. Band II, a.a.O., S. 166.
[83] Vgl. z.B. Hans Bertens, a.a.O., S. 210
[84] Vgl. Irmgard Nickel-Bacon: Schmerz der Subjektwerdung. Nickel-Bacon sieht bei Christa Wolf wohl eine ´Essenz´, die sich ´freilegt´. Meines Erachtens ist diese Argumentation nicht überzeugend weil der Wolfsche Begriff der Authentizität viel Nachdruck legt auf das Veränderliche, und hierin die Ganzheit der Person sieht. Vor allem Nickel-Bacons Bemerkung, dass Wolf sich in die Tradition Platons begibt (S. 124), finde ich nicht gerecht. Es geht im Kassandra-Projekt nicht um die invariabelle Idee, sondern um die lebendige Öffnung zur konkreten Wirklichkeit.
[85] Christa Wolf: „Selbstinterview” In: Die Dimension des Autors. Band I, a.a.O., S. 31 - 35 (hier: S. 34).
[86] Christa Wolf. „Berührung. Ein Vorwort.“ In: Maxie Wander: Guten Morgen, du Schöne. Protokolle nach Tonband. 8. Auflage. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2003. S. 11.
[87] VeE. S. 125.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kassandra-Projekt von Christa Wolf?
Das Kassandra-Projekt besteht aus vier Vorlesungen (Voraussetzungen einer Erzählung: Kassandra) und der Novelle Kassandra. Darin kritisiert Christa Wolf die abendländische Zivilisation und artikuliert, wie die Novelle aus moderner Gesellschaftskritik und persönlicher Krise entstand.
Worum geht es in den Voraussetzungen einer Erzählung: Kassandra?
Die Voraussetzungen beschreiben die Entstehungsgeschichte der Novelle Kassandra. Christa Wolf thematisiert die Rolle der Autorin, ihre Zivilisationskritik aus weiblicher Perspektive, und die Verbindung zwischen Mythos und Aufklärungskritik, insbesondere in Bezug auf die Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer.
Warum sind die Voraussetzungen einer Erzählung wichtig?
Die Voraussetzungen bilden zusammen mit der Novelle ein Ganzes. Sie geben Einblick in Christa Wolfs ´Poetik´, ihre Zivilisationskritik, ihr Plädoyer für ein ´weibliches Schreiben´, und ihre Auseinandersetzung mit der Dialektik der Aufklärung. Sie zeigen, dass die Entstehungsgeschichte der Kassandra mindestens gleich interessant ist wie die Erzählung selbst.
Was ist Christa Wolfs ´Poetik´?
Christa Wolf bietet keine systematische Poetik im klassischen Sinne. Stattdessen plädiert sie für eine neue Art von Schreiben, die auf subjektiver Authentizität und körperlicher Präsenz basiert. Die Rolle der Autorin wird als ungemein wichtig erachtet für die Möglichkeit von engagierter Literatur.
Was bedeutet "subjektive Authentizität" bei Christa Wolf?
Subjektive Authentizität bedeutet, dass sowohl ihr essayistisches Werk als auch ihre Prosa ihren Anfang in der – oft beunruhigenden – Lebenserfahrung finden. Es geht um den Mut, ´Ich´ zu sagen, und um die Verknüpfung von erlebter Wirklichkeit und Text. Die Verbindung der realen Welt mit dem Mythos sind Teil der Erzählung.
Was ist das "weibliche Schreiben" oder écriture féminine, auf das sich Christa Wolf bezieht?
Écriture féminine kritisiert die Dominanz des Logozentrismus und zielt darauf, die bestehenden Eindeutigkeiten zu dekonstruieren. Christa Wolf entdeckt in Kassandra eine Frau, die versucht hat, aus traditionellen Strukturen auszusteigen und eine andere Dimension der Realität sieht. Sie setzt sich für eine andere Perspektive auf die Weltgeschichte ein, abseits von patriarchalen Heroengeschichten.
Welche Verbindung besteht zwischen Christa Wolfs Werk und der Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer?
Adorno und Horkheimer sehen, so wie Christa Wolf, einen Zusammenhang zwischen destruktiver Rationalität und Subjektspaltung. Beide kritisieren die instrumentelle Vernunft und erkennen im Mythos bereits die gefährlichen Elemente unserer Zivilisation. Christa Wolfs Kritik ist jedoch stärker auf die Rolle der Autorin, die Unterdrückung des Weiblichen, und die Möglichkeit der ´Subjektwerdung´ ausgerichtet.
Was ist Christa Wolfs Zivilisationskritik?
Christa Wolfs Zivilisationskritik findet ihren Ursprung in der Kritik an objektivierender Sprache und in der Thematisierung der Unterdrückung des Weiblichen. Sie kritisiert die Leere der heutigen Welt und sucht nach bescheidener Sinngebung in der Privatsphäre.
Was ist das übergreifende Thema in Christa Wolfs Werk?
Das übergreifende Thema ist die Frage nach „Dieses Zu-sich-selber-Kommen des Menschen“. Durch ihr ganzes Werk – sowohl in ihrem literarischen als auch in ihrem essayistischen – ist diese Frage nachdrücklich anwesend.
- Quote paper
- B.A, Trixie Holsgens (Author), 2005, Das Licht am Morgen - Eine Untersuchung zum kritischen Potential des Kassandra-Projekts von Christa Wolf , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70043