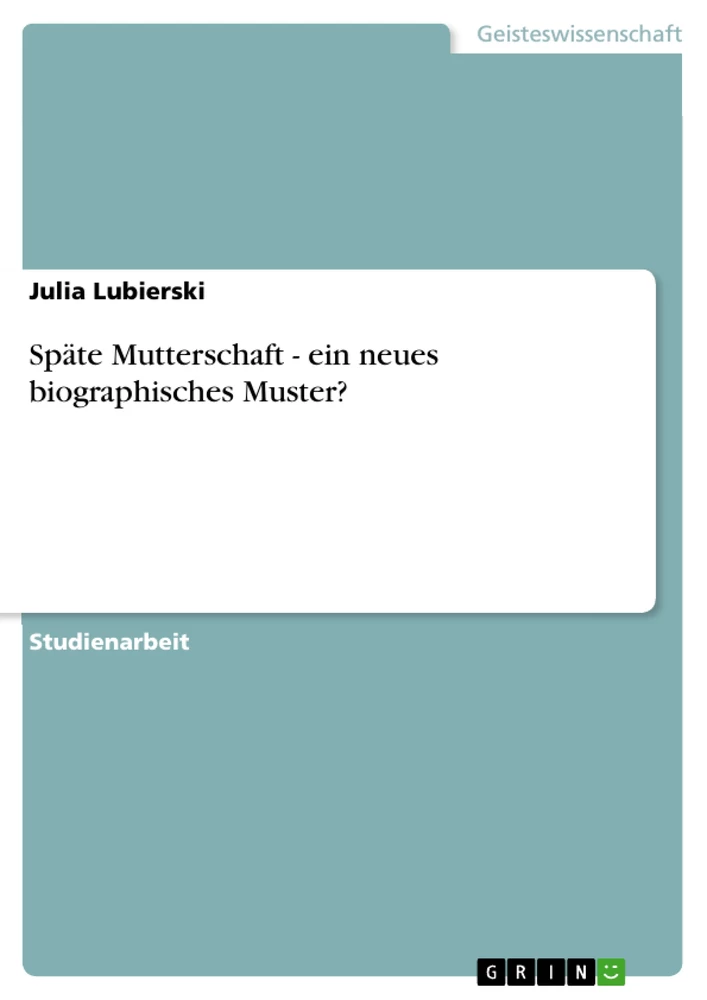Sowohl im Osten, als auch im Westen Deutschlands zeigt sich deutlich, dass seit den 60er Jahren bestimmte gesellschaftliche Prozesse dazu führen, dass die „Einheitlichkeit der weiblichen Normalbiographie, ihrer typischen Verläufe, Stationen und Ziele“ nicht mehr existiert und sich „eine neue Vielfalt“ innerhalb der bisher gewohnten Biographien von Frauen ergibt. [Elisabeth BECK-GERNSHEIM: Die Kinderfrage – Frauen zwischen Kinderwunsch und Unabhängigkeit. S.119.] Das beinhaltet unter anderem, dass sich der bis dato gewohnte Zeitpunkt für eine Erstschwangerschaft bei vielen Frauen nach hinten verschiebt.
Diese Tatsache hat natürlich großen Einfluss auf die demographische Situation, und die Statistiken, die jenen „Gegentrend“ zur weiblichen Normalbiographie in Zahlen einfangen, lassen klar erkennen, dass das Alter der Mütter bei der Geburt ihres ersten Kindes durchschnittlich ansteigt. So entstand auf der Basis einer medizinischen Definition der Begriff der „späten Mutterschaft“, der sich auf Frauen, die ihr erstes Kind mit 35 Jahren oder später bekommen, bezieht.
In der vorliegenden Arbeit wird zunächst auf statistische Werte und medizinische Aspekte eingegangen. Darauf folgend soll erläutert werden, welche Gründe dazu führen können, dass sich Frauen vermehrt für eine späte Familiengründung entscheiden. Am Schluss steht eine Darstellung über mögliche Vor -und Nachteile, die sich durch eine solche Form der Familiengründung ergeben können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Statistik
- 2 Medizinische Aspekte
- 3 Mögliche Gründe für eine späte Mutterschaft
- 4 Späte Mutterschaft in der Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der späten Mutterschaft in Deutschland, analysiert die zugrundeliegenden statistischen Trends und medizinischen Aspekte und beleuchtet verschiedene Gründe für diese Entwicklung. Das Ziel ist es, ein umfassendes Bild der späten Mutterschaft zu zeichnen und regionale Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland zu berücksichtigen.
- Statistische Entwicklungen der Geburtenraten und des Alters der Mütter bei der Geburt des ersten Kindes
- Medizinische Aspekte und potenzielle Risiken der späten Mutterschaft
- Sozioökonomische Faktoren, die die Entscheidung für eine späte Familiengründung beeinflussen
- Regionale Unterschiede in Ost- und Westdeutschland
- Diskussion der Vor- und Nachteile einer späten Mutterschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der späten Mutterschaft ein und verweist auf eine Werbekampagne in den USA, die auf die sinkende Fruchtbarkeit im höheren Alter hinweist. Sie beschreibt den steigenden Trend später Erstgeburten in Deutschland, insbesondere den Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland. Die Autorin hebt die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung der Gründe für dieses Phänomen und den Mangel an umfassenden sozialwissenschaftlichen Forschungsarbeiten hervor. Die Arbeit selbst kündigt eine statistische und medizinische Betrachtung sowie eine Analyse der Gründe und Konsequenzen späten Mutterwerdens an.
1 Statistik: Dieses Kapitel präsentiert statistische Daten zum Geburtenrückgang in Westeuropa und Deutschland seit Mitte der 1960er Jahre. Es zeigt den Anstieg des durchschnittlichen Erstgebärendenalters und den deutlichen Zuwachs an Frauen, die ihr erstes Kind nach dem 35. Lebensjahr bekommen. Es werden signifikante regionale Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland aufgezeigt, wobei der Anteil älterer Mütter im Westen deutlich höher ist. Die Autorin diskutiert mögliche Erklärungen für diese Diskrepanzen, wie z.B. bessere Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten im Westen und die unterschiedliche Verfügbarkeit von Kinderbetreuungseinrichtungen.
Schlüsselwörter
Späte Mutterschaft, Geburtenrückgang, demographische Entwicklung, Ost-West-Deutschland, Reproduktionsmedizin, sozioökonomische Faktoren, Familienplanung, Kinderbetreuung.
Häufig gestellte Fragen: Späte Mutterschaft in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Thema der späten Mutterschaft in Deutschland. Sie analysiert statistische Trends, medizinische Aspekte, sozioökonomische Faktoren und regionale Unterschiede (Ost- und Westdeutschland), um ein vollständiges Bild dieses Phänomens zu zeichnen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit untersucht die statistische Entwicklung der Geburtenraten und des Alters der Mütter bei der Geburt des ersten Kindes. Sie beleuchtet medizinische Aspekte und Risiken der späten Mutterschaft, sozioökonomische Faktoren, die die Entscheidung für eine späte Familiengründung beeinflussen, und regionale Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Schließlich diskutiert sie die Vor- und Nachteile einer späten Mutterschaft.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Statistik, ein Kapitel zu medizinischen Aspekten, ein Kapitel zu den Gründen für späte Mutterschaft und ein Kapitel zur Diskussion des Themas. Die Einleitung beinhaltet einen Vergleich mit einer Werbekampagne in den USA und hebt den Mangel an umfassenden sozialwissenschaftlichen Forschungsarbeiten hervor.
Welche statistischen Daten werden präsentiert?
Das Kapitel "Statistik" präsentiert Daten zum Geburtenrückgang in Westeuropa und Deutschland seit Mitte der 1960er Jahre. Es zeigt den Anstieg des durchschnittlichen Erstgebärendenalters und den deutlichen Zuwachs an Frauen, die ihr erstes Kind nach dem 35. Lebensjahr bekommen. Es werden auch signifikante regionale Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland aufgezeigt.
Welche medizinischen Aspekte werden berücksichtigt?
Die Arbeit beleuchtet die medizinischen Aspekte und potenziellen Risiken einer späten Mutterschaft, obwohl die genauen Details im gegebenen Auszug nicht spezifiziert sind.
Welche sozioökonomischen Faktoren werden analysiert?
Die Arbeit untersucht sozioökonomische Faktoren, die die Entscheidung für eine späte Familiengründung beeinflussen. Als Beispiele werden im Zusammenhang mit den regionalen Unterschieden bessere Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten im Westen und die unterschiedliche Verfügbarkeit von Kinderbetreuungseinrichtungen genannt.
Welche regionalen Unterschiede werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die regionalen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland bezüglich des Alters der Mütter bei der Geburt des ersten Kindes und diskutiert mögliche Erklärungen für diese Unterschiede.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen: Späte Mutterschaft, Geburtenrückgang, demographische Entwicklung, Ost-West-Deutschland, Reproduktionsmedizin, sozioökonomische Faktoren, Familienplanung und Kinderbetreuung.
- Quote paper
- Julia Lubierski (Author), 2006, Späte Mutterschaft - ein neues biographisches Muster?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70038