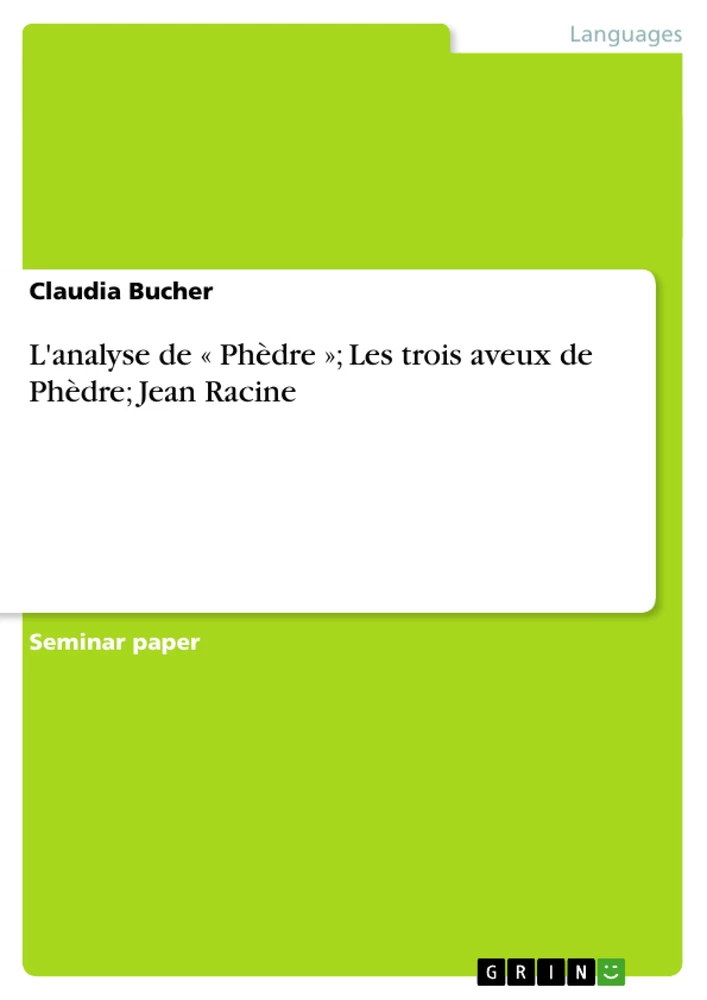Jean Racine est considéré comme un des plus grands dramaturges classiques français. Né en 1639, il reçoit une éducation janséniste à l’école du « Port Royal ». Après avoir écrit des poèmes, il se consacre finalement au théâtre. Dès l’année 1664, il écrit des tragédies (ainsi qu’ une comédie « Les Plaideurs », en 1668) qui le mèneront au succès, notamment à travers ces grands noms : Alexandre (1665), Andromaque (1667), Britannicus (1669), Bajazet (1672), Mithridate (1973), Iphigénie (1974) et enfin Phèdre (1677). Au 17ème siècle, la tragédie est le genre majeur du théâtre. Elle est codifiée par la doctrine classique dérivée d’Aristote : L’unité de temps, de lieu et d’ action, la bienséance, la vraisemblance et la catharsis. C’est toujours un héros qui commet une faute, qui subit le conflit de base, il est déchiré entre la passion et la raison. En plus, on trouve régulièrement le triangle amoureux qui cause la dépendance des personnages et de leurs actions. Tout ces critères se retrouvent dans la pièce « Phèdre ». Jean Racine a réécrit une histoire tirée de la mythologie grecque, celle de l’amour incestueux de Phèdre pour son beau-fils Hippolyte. Phèdre est l’épouse du roi d’Athènes, Thésée, qui est parti pour un voyage aux Enfers. Déchirée entre la raison et la passion, elle éprouve un amour interdit pour son beau-fils, se sent coupable et préfère mourir plutôt que d’avouer cet amour. Hippolyte prétend aller chercher son père mais à vrai dire il fuit devant l’amour qu’il éprouve pour Aricie. C’est un amour réciproque mais également interdit parce qu’ Aricie est l’ennemie de son père à cause de ses ancêtres. L’annonce de la mort de Thésée est la première étape du dénouement de la tragédie. La question de la succession du trône se pose et les trois personnages espèrent réaliser leurs désirs amoureux : ils font des aveux, c’est-à-dire qu’ils cessent de se taire et entrent en contact avec le monde. La deuxième étape de cette fin tragique est le retour de Thésée. Tous cachent la vérité, Thésée est aveugle et son seul dessein est de rétablir l’ordre. Mais c’est impossible : Œnone, pour protéger sa maîtresse, accuse Hippolyte d’avoir voulu violer sa belle-mère et de l’aimer. Thésée, en rage, demande à Neptune de le venger : Hippolyte va mourir. Les essais d’Hippolyte et d’Aricie pour rétablir la vérité échouent. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Introduction
- I. Der erste Geständnis (Akt I, Szene 3)
- II. Der zweite Geständnis (Akt II, Szene 5)
- III. Der dritte Geständnis (Akt V, Szene 7)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die drei Geständnisse der Phèdre im gleichnamigen Drama von Jean Racine. Ziel ist es, die Bedeutung dieser Geständnisse für die Struktur und den tragischen Verlauf des Stücks zu untersuchen, unter Berücksichtigung verschiedener literaturwissenschaftlicher Ansätze wie der soziokritischen Analyse von Lucien Goldman und der strukturalistischen Perspektive von Roland Barthes. Die Arbeit beleuchtet die psychologischen und gesellschaftlichen Aspekte der Handlung.
- Die Rolle der Geständnisse in der Dramenstruktur
- Die psychologische Entwicklung der Phèdre
- Der Konflikt zwischen Vernunft und Leidenschaft
- Die Bedeutung von Schweigen und Sprechen
- Die soziokulturellen Kontexte des Stücks
Zusammenfassung der Kapitel
Introduction: Die Einleitung stellt Jean Racine als bedeutenden französischen Dramatiker vor und skizziert den historischen und literarischen Kontext der Tragödie "Phèdre". Sie führt in die Thematik des Stücks ein – den inzestuösen Liebeswunsch der Phèdre zu ihrem Stiefsohn Hippolyt – und hebt die Bedeutung der drei Geständnisse als strukturierende Elemente der Handlung hervor. Die Einleitung benennt außerdem die verwendeten literaturwissenschaftlichen Ansätze zur Analyse.
I. Der erste Geständnis (Akt I, Szene 3): Dieses Kapitel analysiert das erste Geständnis der Phèdre an ihre Vertraute Œnone. Phèdres innerer Konflikt zwischen ihrem verbotenen Verlangen nach Hippolyt und ihrem Schuldbewusstsein wird detailliert dargestellt. Die Rolle von Œnone als Mittlerin und Manipulatorin wird untersucht, ebenso wie die sprachliche Gestaltung des Geständnisses, das zwischen Anrufung der Götter und direkten Ansprachen an Œnone wechselt. Die Analyse beleuchtet, wie Phèdres Hilflosigkeit vor ihrer Leidenschaft und ihr Schicksal als zentrale Themen herausgestellt werden. Das Kapitel verweist auf die literaturwissenschaftlichen Interpretationen, um die Komplexität der Szene zu unterstreichen. Phèdres Selbstzweifel und der Wunsch nach Tod werden als Ausdruck ihrer seelischen Zerrissenheit interpretiert.
Schlüsselwörter
Jean Racine, Phèdre, Tragödie, Geständnis, Schuld, Leidenschaft, Vernunft, Inzest, Schweigen, Sprechen, Soziokritik, Strukturalismus, Œnone, Hippolyt, Klassisches Drama, Mythologie.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Geständnisse in Racines "Phèdre"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die drei Geständnisse der Phèdre in Jean Racines Drama "Phèdre". Im Fokus steht die Bedeutung dieser Geständnisse für die Struktur und den tragischen Verlauf des Stücks.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Analyse verwendet verschiedene literaturwissenschaftliche Ansätze, darunter die soziokritische Analyse von Lucien Goldman und die strukturalistische Perspektive von Roland Barthes. Die Arbeit beleuchtet sowohl die psychologischen als auch die gesellschaftlichen Aspekte der Handlung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Geständnisse in der Dramenstruktur, die psychologische Entwicklung der Phèdre, den Konflikt zwischen Vernunft und Leidenschaft, die Bedeutung von Schweigen und Sprechen sowie die soziokulturellen Kontexte des Stücks.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, drei Kapitel, die sich jeweils mit einem der drei Geständnisse befassen (Akt I, Szene 3; Akt II, Szene 5; Akt V, Szene 7), und einen Schlussabschnitt mit Schlüsselbegriffen. Jedes Kapitel analysiert das jeweilige Geständnis detailliert, unter Berücksichtigung der sprachlichen Gestaltung, der Rollen der beteiligten Personen und der literaturwissenschaftlichen Interpretationen.
Was wird im ersten Kapitel analysiert?
Das erste Kapitel analysiert Phèdres erstes Geständnis an ihre Vertraute Œnone (Akt I, Szene 3). Es wird der innere Konflikt zwischen ihrem verbotenen Verlangen nach Hippolyt und ihrem Schuldbewusstsein dargestellt. Die Rolle von Œnone als Mittlerin und Manipulatorin sowie die sprachliche Gestaltung des Geständnisses werden untersucht. Phèdres Hilflosigkeit, ihr Schicksal, Selbstzweifel und der Wunsch nach Tod werden als Ausdruck ihrer seelischen Zerrissenheit interpretiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Jean Racine, Phèdre, Tragödie, Geständnis, Schuld, Leidenschaft, Vernunft, Inzest, Schweigen, Sprechen, Soziokritik, Strukturalismus, Œnone, Hippolyt, Klassisches Drama, Mythologie.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für den akademischen Gebrauch bestimmt und dient der Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise.
Welche literarischen Ansätze werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die soziokritische Analyse von Lucien Goldman und die strukturalistische Perspektive von Roland Barthes.
Welche Rolle spielt das Schweigen in der Arbeit?
Die Bedeutung von Schweigen und Sprechen im Kontext der Geständnisse und deren Auswirkungen auf die Handlung und die Charaktere wird in der Arbeit untersucht.
- Citation du texte
- Claudia Bucher (Auteur), 2006, L'analyse de « Phèdre »; Les trois aveux de Phèdre; Jean Racine, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69995