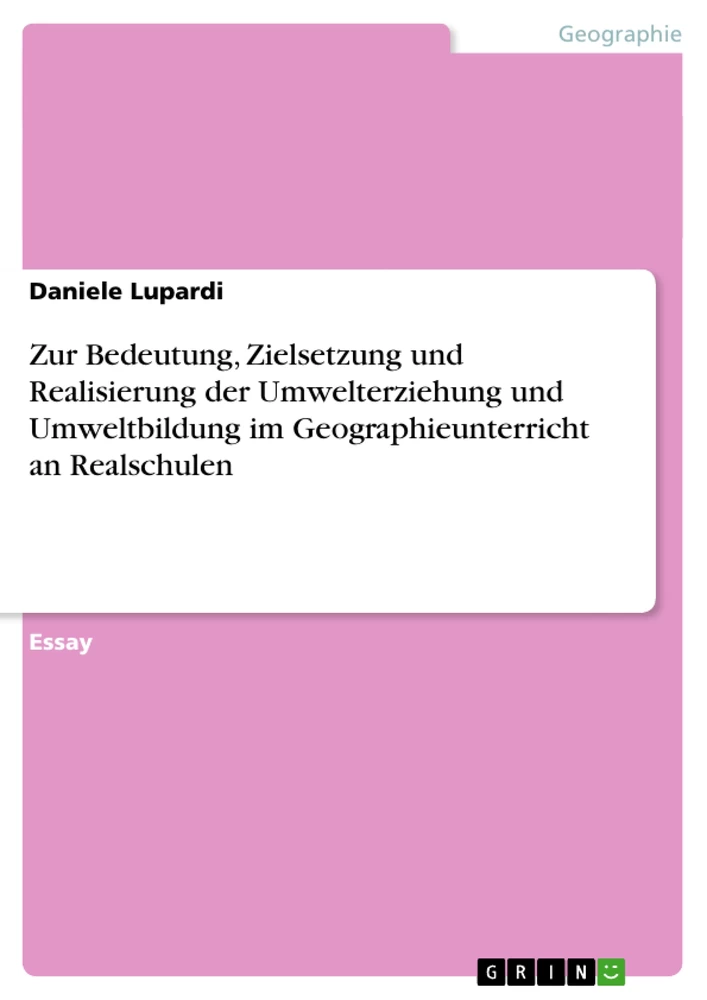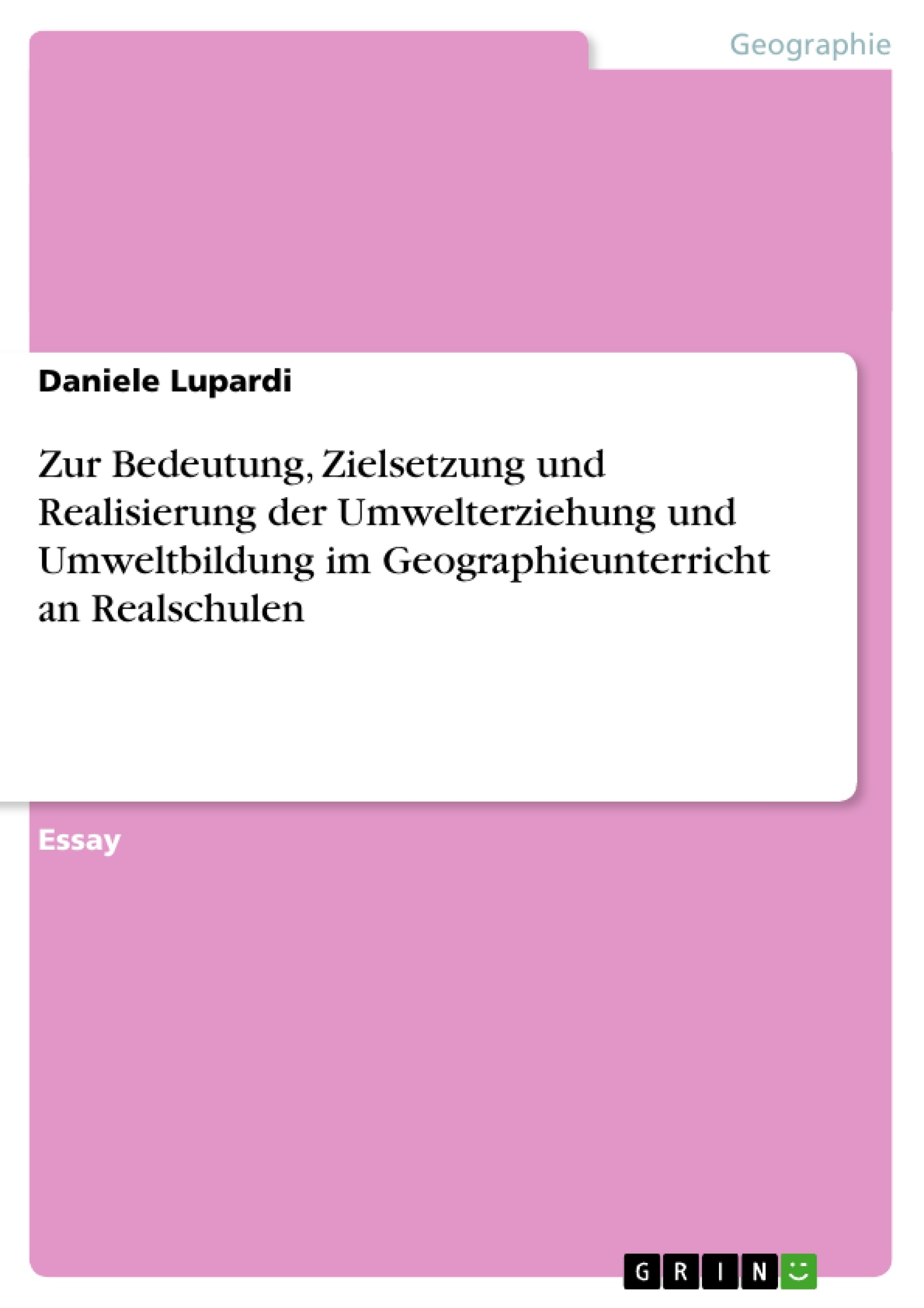Zu keiner anderen Zeit ist die Frage nach der langfristigen Erhaltung unseres Planeten so oft und so differenziert diskutiert worden, wie in unseren Tagen, denn es ist unbestritten, dass der Mensch von heute selbst die Möglichkeiten in der Hand hält, positiv oder negativ über den Fortbestand des Lebens auf der Erde zu entscheiden. Es ist daher nicht nur angebracht, sondern eine absolute Pflicht, die kommenden Generationen mit der Frage zu konfrontieren, inwieweit ein jeder einzelne Mensch eine Verantwortung gegenüber dem Ganzen - der Welt - trägt.
Die Schule hat hier, in ihrer Rolle als Erziehungs- und Bildungsorgan, die beste Möglichkeit, im Rahmen des Geographieunterrichtes, ein neues Verständnis von Welt und Umwelt zu vermitteln und Kinder und Jugendliche für das empfindliche "System Erde" zu sensibilisieren.
Über eine Analyse des Bildungsplans der Realschule in Baden-Württemberg werden in dieser Arbeit verschiedene Möglichkeiten der Realisierung von Umweltbildung und -erziehung aufgezeigt, ohne den Bezug zur Lebenswelt der Schüler aus den Augen zu verlieren.
Inhaltsverzeichnis
- Angesichts der Gegebenheit, dass der Mensch in seiner Wesenheit als zoon politikon im aristotelischen Sinne, ohne mit der ihn umgebenden Welt in Dialog zu treten und den Versuch zu unternehmen, sie erfassen zu wollen, zu leben nicht befähigt sein kann, und da er gerade diese seine Umwelt zunehmend gefährdet, sich somit selbst die Grundlage seines Menschseinkönnens zu entziehen droht, soll in folgendem Aufsatz die Frage erörtert werden, welchen Stellenwert die Umwelterziehung und Umweltbildung für Kinder und Jugendliche im Geographieunterricht unweigerlich einnehmen muss.
- Zunächst erscheint es mir als sinnvoll hervorzuheben, dass der Begriff der Umwelterziehung losgelöst von dem der Umweltbildung nicht denkbar sein kann und darf. Klafki definiert einen kategorialen Begriff von Bildung als den Zustand, bei dem „[...] sich dem Menschen seine Wirklichkeit kategorial erschlossen hat, und dass eben damit er selbst dank der selbst vollzogenen kategorialen Einsichten, Erfahrungen, Erlebnisse für diese Wirklichkeit erschlossen ist\"¹. Da Bildung als die „wachsende Teilhabe an der Kultur“ mit dem Ziel einer durch Werte geleiteten einträchtigen Persönlichkeit verstanden wird, ist ihr in der Schule höchste Priorität einzuräumen.
- Das Fach Geographie hat eo ipso unverzichtbare Orientierungsfunktionen und Perspektiven inne, dem Schüler eine Hilfe an die Hand zu geben auf dem Wege, die Wirklichkeit für sich zu erschließen. Die im schulischen Geographieunterricht eingebettete Umwelterziehung und Umweltbildung besitzt aufgrund ihres für eine integrale Bildung unabdingbaren Instrumentariums an Inhalten und Methoden eine Schlüsselfunktion³. Neben der Raumverhaltenskompetenz bzw. der räumlichen Handlungskompetenz ist das ethische Raumverhalten ein übergeordnetes Ziel des Geographieunterrichtes. Beide umfassen die dringende Forderung nach der Bewahrung der Erde, nach Zukunftsfähigkeit sowie nach territorialer Identität¹.
- Genau in der Bedrohtheit dieser Punkte liegen „epochal typische Strukturprobleme“, jene Schlüsselprobleme, mit denen es sich in der Schule im Rahmen der Umwelterziehung und Umweltbildung zu befassen gilt! Denn welches Thema ist dringender angegangen und behandelt zu werden in einem Fach, das „Geo\" - also Erde in seinem Namen trägt, als ein ebensolches, das sich mit der Gefährdung des Geosystems befasst? Vosskuhle spricht zu Recht davon, dass „mehr und mehr sich die Bewältigung der Umweltverschmutzung als zentrale Überlebensfrage der modernen Industriegesellschaft herauskristallisiert“. Die Tatsache, dass jeder einzelne Mensch an der Alteration und Zerstörung der lokalen und globalen Umwelt teilhat – ob er es denn nun begreifen möchte oder nicht – macht die Bedeutung des Stellenwertes von Umwelterziehung und Umweltbildung im Geographieunterricht mit hin aus! Infolgedessen ist der Kritik Richters insofern zu widersprechen, als dass sie erklärt, die von Klafki postulierte Fragestellung der epochalen Schlüsselprobleme ginge an der Lebenswirklichkeit der Schüler vorbei. Welche Thematik aber geht Schüler denn mehr an, als die, die ihre Gegenwärtigkeit und ihre Zukunft betrifft?
- Es ist unbestritten, dass die Befassung mit Schlüsselproblemen nicht den Geographieunterricht erschöpfend ausfüllen kann allein schon die Notwendigkeit, didaktisch zu reduzieren auf der einen Seite, die Stofffülle auf der anderen, stünden einer solchen Forderung im Wege. Gleichwohl kann daraus nicht die absurde Konsequenz gezogen werden, es sei all dasjenige nicht relevant, was an Schülerinteressen vorbei gehe. Jeder der sich pädagogisch betätigt weiß, wie oft das momentane kurzfristige persönliche Interesse von Kindern und Jugendlichen mit dem langfristig von allgemeiner Relevanz Seienden in Widerstreit steht.
- Der Bildungsplan für Realschulen weist als Ziel des Geographieunterrichtes folgendes aus: „Die Schülerinnen und Schüler verhalten sich nach der Erkenntnis, dass die Lösung der globalen Schlüsselprobleme nur durch die besondere Verantwortung der Industriestaaten möglich ist. Sie setzen sich für eine Verbesserung der Umwelt, Mitwelt und Nachwelt auf der Grundlage der nachhaltigen Entwicklung und des „Eine-Welt-Denkens\" im Kontext der Agenda 21 ein: global denken – lokal handeln“. Insofern ist selbstredend ersichtlich, welchen Nachdruck der Umwelterziehung und Umweltbildung im Bildungsplan zukommt, geht man davon aus, dass das Ziel, Kompetenzen zu erlernen, welche die Grundlage eines globalen Denkens sein sollen, wohl als das Ziel des Geographieunterrichtes schlechthin bezeichnet werden kann. Und genau hierin liegt auch das Ziel der Umweltbildung und Umwelterziehung: es geht darum, Kompetenzen zu vermitteln, die ein nachhaltiges Verhältnis zur Mit- Um- und Nachwelt garantieren sollen.
- Wie aber soll nun dieser eminente Richtungspunkt des Geographieunterrichtes in concreto umgesetzt werden? Zunächst einmal soll klar gestellt werden, dass auch die Umwelterziehung und Umweltbildung vordringlich im Lichte des Prinzips der Exemplarität, wie es 1951 neu definiert wurde, stehen muss, da sich von alleine klärt, dass selbst große Probleme der Gegenwart und der Zukunft niemals zufrieden stellend im begrenzten Rahmen des fünfundvierzigminütigen Geographieunterrichtes an Schulen angegangen und behandelt werden können. Klafki spricht absolut richtig davon, sich – anhand des besonderen Inhaltes – einen elementaren Zugang zu Grundprinzipien, Gesetzmäßigkeiten, Grundeinsichten, Grunderfahrungen, Methoden und Arbeitsweisen, ergo, zum „Fundamentalen“¹⁰ im Unterricht zu erschließen. Das aber ist so möchte ich an dieser Stelle behaupten – der richtige Weg des Unterrichtens überhaupt, denn nur durch die Beherrschung des Fundamentalen kann ein Schüler einen Transfer leisten, wie er im Rahmen eines Kompetenzbegriffes vollkommen wünschenswert ist.
- Der Erwerb von Kompetenzen im Sinne des Bildungsplans, soll meines Dafürhaltens durch Lernzielorientierung im Geographieunterricht erfolgen. Haubrich unterscheidet hierzu drei Kategorien beziehungsweise Ebenen der Lernziele hinsichtlich einer umfassenden geographischen Erziehung¹¹. Dabei konstruiert er ein Modell, in welchem die Lernziele als die Schnittmenge aus Haltungen, Kenntnisse und Fähigkeiten resultieren, wobei es mir als sinnvoll erscheinen möchte, den Begriff der Fähigkeiten noch durch den der Fertigkeiten zu ergänzen. Fertigkeiten unterscheiden sich von den Fähigkeiten insofern, als dass sie mehr als Dispositionen zum automatisierten Handlungsvollzug gedacht sind und in der Regel ohne Willenssteuerung und kognitiver Anstrengung ablaufen. Fähigkeiten dagegen sind die psychischen Prämissen, welche zum qualifizierten Handlungsvollzug führen¹². Ohne Fertigkeiten als ein basales Element sind Fähigkeiten auf kognitiv-aktionaler Ebene im unterrichtlichen Prozess nicht erlernbar.
- Lernziele können auf drei Zielklassen hin gegliedert werden. Haubrich spricht von kognitiven, affektiven und instrumentalen bzw. affirmativen Zielen¹³. Die Befunde der Lernpsychologie haben erwiesen, dass das Lernen auf allen drei Lernzielklassen ungleich dienlicher ist, als auf jeweils einer einzigen. Kirchberg bezeichnet dieses Lernen als „ganzheitlich“, da dadurch der „Kopf mit dem Körper“ verbunden wird und somit das Erfahrene nachhaltig verankert wird¹⁴.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Aufsatz untersucht die Bedeutung, Zielsetzung und Realisierung von Umwelterziehung und Umweltbildung im Geographieunterricht an Realschulen. Der Fokus liegt dabei auf der Notwendigkeit dieser Themen im Kontext der aktuellen Umweltprobleme und der Rolle des Geographieunterrichts bei der Entwicklung von Kompetenzen für nachhaltiges Denken und Handeln.
- Die Bedeutung der Umwelterziehung und Umweltbildung für die Entwicklung eines nachhaltigen Verhältnisses zur Umwelt.
- Die Herausforderungen der Umweltverschmutzung und der Bedeutung von Bildung für eine nachhaltige Gesellschaft.
- Die Schlüsselfunktion des Geographieunterrichts bei der Vermittlung von Raumverhaltenskompetenz und ethischem Raumverhalten.
- Die Rolle des Bildungsplans für Realschulen und die Bedeutung von Lernzielorientierung im Geographieunterricht.
- Die Anwendung des Prinzips der Exemplarität und die Erarbeitung von Grundprinzipien, Gesetzmäßigkeiten und Methoden im Unterricht.
Zusammenfassung der Kapitel
- Der einleitende Abschnitt stellt die Notwendigkeit von Umwelterziehung und Umweltbildung im Kontext der Herausforderungen der Umweltzerstörung und dem Bedürfnis des Menschen nach einer Beziehung zur Umwelt dar.
- Der zweite Abschnitt beleuchtet die Rolle der Bildung im Allgemeinen und die Bedeutung des Fachs Geographie für die Orientierung und Erschließung der Wirklichkeit durch Schüler. Dabei wird die Schlüsselfunktion von Umwelterziehung und Umweltbildung im Geographieunterricht betont.
- Der dritte Abschnitt widmet sich der Analyse der „epochal typischen Strukturprobleme“ und argumentiert, dass die Umweltproblematik im Geographieunterricht behandelt werden muss, da sie Schüler direkt betrifft.
- Der vierte Abschnitt diskutiert die Bedeutung des Bildungsplans für Realschulen und die Ziele des Geographieunterrichts, die auf die Entwicklung von Kompetenzen für ein nachhaltiges Verhältnis zur Umwelt ausgerichtet sind.
- Der fünfte Abschnitt erläutert die Umsetzung der Umwelterziehung und Umweltbildung im Geographieunterricht unter dem Gesichtspunkt der Exemplarität und der Erarbeitung von grundlegenden Prinzipien und Methoden.
- Der sechste Abschnitt beleuchtet die Bedeutung von Lernzielorientierung im Geographieunterricht und die drei Kategorien von Lernzielen (kognitive, affektive, instrumentale).
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe des Aufsatzes sind Umwelterziehung, Umweltbildung, Geographieunterricht, nachhaltige Entwicklung, Raumverhaltenskompetenz, ethisches Raumverhalten, Bildungsplan, Lernziele, Exemplarität und Schlüsselprobleme.
- Quote paper
- Daniele Lupardi (Author), 2006, Zur Bedeutung, Zielsetzung und Realisierung der Umwelterziehung und Umweltbildung im Geographieunterricht an Realschulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69936