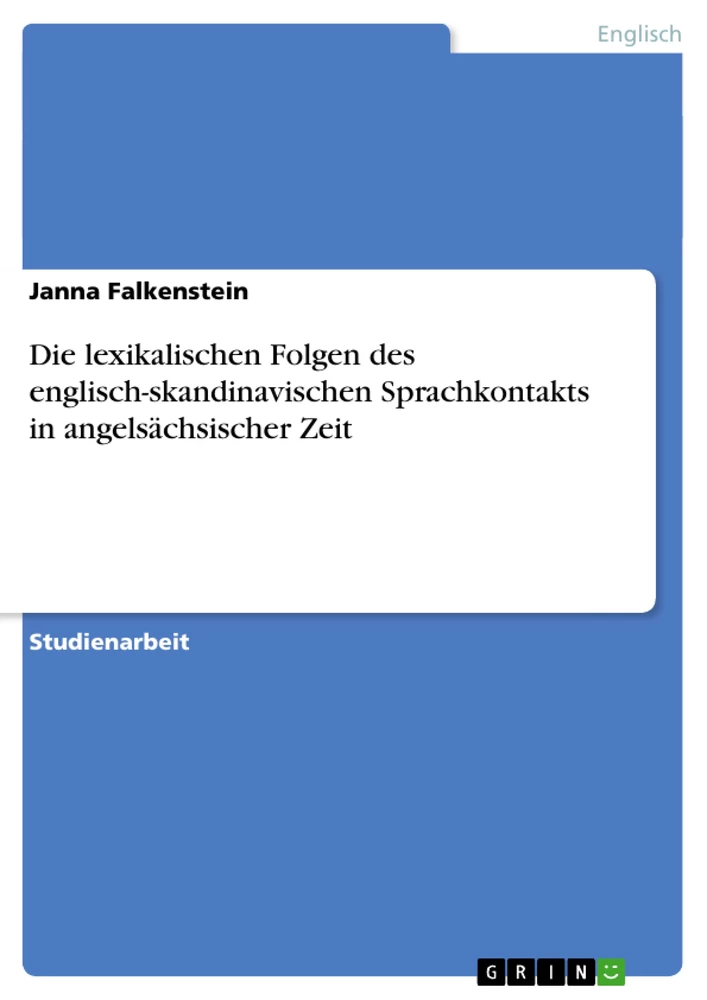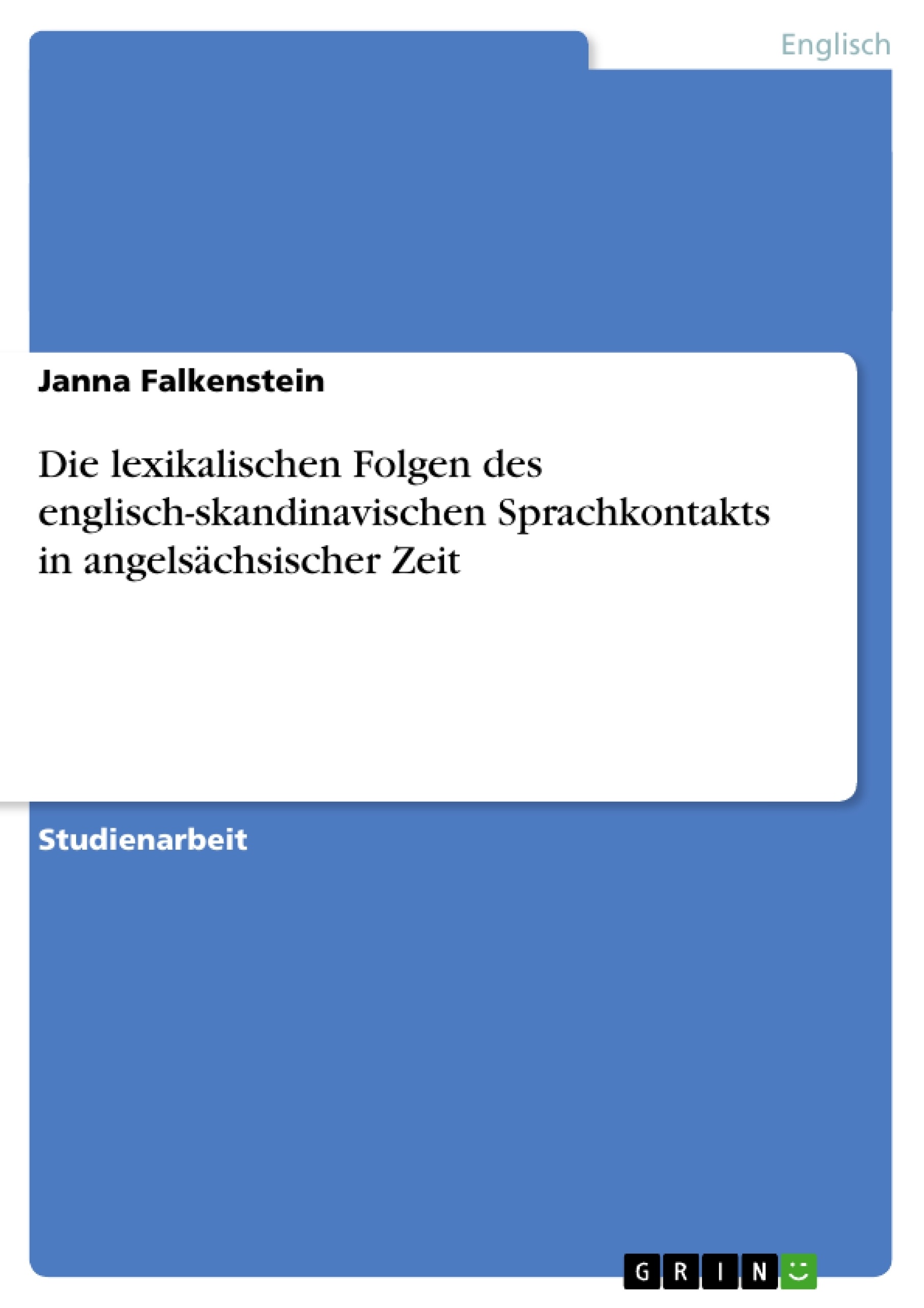Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Ursachen und vor allem den lexikalischen Folgen des englisch-skandinavischen Sprachkontakts in angelsächsischer Zeit. Um ein vollständiges Bild dieses Kontaktes zu zeigen, bezieht sich die Seminararbeit auch auf Folgen, die erst in mittelenglischer Zeit sichtbar wurden.
Zunächst wird ein kurzer geschichtlicher Überblick gegeben. Weiter beschäftigt sich die Arbeit mit dem Sprachkontakt der beiden Völkergruppen, insbesondere mit der Art und den Ursachen dieses Sprachkontakts, dem skandinavischen Lehnwortgut und dessen Nachweismöglichkeiten sowie den verschiedenen Entlehnungstypen. An erster Stelle soll diese Arbeit zeigen, welch große Bedeutung das Altnordische für die Entwicklung der englischen Sprache darstellte und wie groß die Integration dieser Sprache war. Außerdem soll sie widerspiegeln, dass der altnordische Einfluss wohl einer der bedeutendsten Einflüsse war, mit dem das Englische je in Berührung kam. Es stellt sich also die Frage: Wie konnte es zu solch einer starken Integration des Altnordischen kommen? Außerdem sollte man die spannende Frage klären, warum dass Bild entsteht, dass der englisch-skandinavische Sprachkontakt im Altenglischen scheinbar so gering war.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtliche Hintergründe
- Der Sprachkontakt
- Nachweis altnordischen Lehnwortguts
- Das Lehnwortgut
- Schlussbemerkungen
- Karte und Quellenangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die lexikalischen Folgen des englisch-skandinavischen Sprachkontakts in angelsächsischer Zeit. Sie beleuchtet die Ursachen und Auswirkungen dieses Kontakts, wobei auch mittelenglische Entwicklungen berücksichtigt werden. Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung des altnordischen Einflusses auf die englische Sprache aufzuzeigen und die scheinbar geringe Integration im Altenglisch zu erklären.
- Geschichtliche Hintergründe des englisch-skandinavischen Kontakts
- Art und Intensität des Sprachkontakts
- Nachweis und Analyse des altnordischen Lehnwortguts
- Typologie der altnordischen Entlehnungen
- Bedeutung des altnordischen Einflusses für die Entwicklung des Englischen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Arbeit untersucht die lexikalischen Folgen des englisch-skandinavischen Sprachkontakts in angelsächsischer und mittelenglischer Zeit. Sie gibt einen geschichtlichen Überblick, analysiert die Art des Sprachkontakts, das altnordische Lehnwortgut und dessen Nachweisbarkeit, sowie verschiedene Entlehnungstypen. Das zentrale Anliegen ist es, die große Bedeutung des Altnordischen für die Entwicklung des Englischen und die scheinbar geringe Integration im Altenglisch zu beleuchten.
Geschichtliche Hintergründe: Dieses Kapitel beschreibt die Geschichte des englisch-skandinavischen Kontakts, beginnend mit den ersten Aufzeichnungen von Wikingerangriffen im Jahre 787. Es unterteilt die Invasionen in drei Phasen (600-850, 850-878, 878-1070 n. Chr.), die sich durch unterschiedliche Intensität und strategische Ziele auszeichnen. Die erste Phase zeigt vereinzelte Plünderungen, die zweite umfassendere Eroberungen und die dritte, nach dem Wedmore-Vertrag, eine Periode weiterhin andauernder Konflikte, trotz der dänischen Herrschaft im Danelaw. Der Einfluss der Skandinavier auf England wird detailliert dargestellt, beginnend mit Plünderungen und Überfällen bis hin zur Etablierung von Königreichen und der schließlich vollständigen Integration in die englische Gesellschaft. Das Kapitel betont die Bedeutung dieser Ereignisse für die folgenden sprachlichen Entwicklungen.
Der Sprachkontakt: Dieser Abschnitt analysiert die Art und Intensität des Sprachkontakts zwischen Engländern und Skandinaviern. Im Gegensatz zum feindseligen Kontakt zwischen Kelten und Germanen, zeigt sich hier eine intensive Interaktion und schrittweise Integration. Die Akzeptanz der Skandinavier durch die englische Bevölkerung und die Könige, sowie die Anpassungsfähigkeit der Skandinavier selbst, werden als wesentliche Voraussetzungen für die erfolgreiche Eingliederung genannt. Die große Ähnlichkeit zwischen Altenglisch und Altnordisch, insbesondere zwischen dem anglischen Dialekt und dem Altnordischen, erleichterte die Verständigung und trug zum intensiven Sprachkontakt bei. Der Kapitel verdeutlicht, dass es sich nicht um eine Unterwerfung handelte, sondern um ein Zusammenwachsen der beiden Völker, belegt durch völkerübergreifende Ehen und die allmähliche Auflösung skandinavischer Siedlungen in gemischte Gemeinden um 1200.
Schlüsselwörter
Englisch-skandinavischer Sprachkontakt, angelsächsische Zeit, altnordisches Lehnwortgut, Sprachintegration, Danelaw, Wikinger, Altenglisch, mittelenglische Entwicklung, Sprachvergleich, Lehnworttypen.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Englisch-skandinavischer Sprachkontakt
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die lexikalischen Folgen des englisch-skandinavischen Sprachkontakts in angelsächsischer und mittelenglischer Zeit. Sie analysiert die Ursachen und Auswirkungen dieses Kontakts, einschließlich der Integration altnordischer Lehnwörter ins Englische und die scheinbar geringe Integration im Altenglisch.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu den geschichtlichen Hintergründen des Kontakts, ein Kapitel zum Sprachkontakt selbst, ein Kapitel zum Nachweis altnordischen Lehnwortguts, ein Kapitel zum Lehnwortgut an sich, Schlussbemerkungen und eine Karte mit Quellenangaben.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung des altnordischen Einflusses auf die Entwicklung des Englischen aufzuzeigen und die Gründe für die scheinbar geringe Integration altnordischer Wörter im Altenglisch zu erklären. Sie beleuchtet die Ursachen und Auswirkungen des englisch-skandinavischen Sprachkontakts, wobei auch mittelenglische Entwicklungen berücksichtigt werden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die geschichtlichen Hintergründe des Kontakts, die Art und Intensität des Sprachkontakts, den Nachweis und die Analyse des altnordischen Lehnwortguts, die Typologie der altnordischen Entlehnungen und die Bedeutung des altnordischen Einflusses für die Entwicklung des Englischen.
Wie wird der geschichtliche Kontext des Sprachkontakts dargestellt?
Das Kapitel "Geschichtliche Hintergründe" beschreibt den englisch-skandinavischen Kontakt in drei Phasen (600-850, 850-878, 878-1070 n. Chr.), von vereinzelten Plünderungen über umfassendere Eroberungen bis hin zur Etablierung skandinavischer Königreiche im Danelaw und der schrittweisen Integration in die englische Gesellschaft. Der Einfluss der Skandinavier auf England wird detailliert dargestellt.
Wie wird die Art und Intensität des Sprachkontakts analysiert?
Das Kapitel "Der Sprachkontakt" analysiert die Art und Intensität der Interaktion zwischen Engländern und Skandinaviern. Es betont die intensive Interaktion und schrittweise Integration im Gegensatz zu anderen, feindseligeren Sprachkontakten. Die große Ähnlichkeit zwischen Altenglisch und Altnordisch wird als Faktor für die erleichterte Verständigung hervorgehoben.
Wie wird das altnordische Lehnwortgut untersucht?
Die Arbeit untersucht den Nachweis und die Analyse des altnordischen Lehnwortguts, inklusive der Typologie der altnordischen Entlehnungen. Sie beleuchtet die Bedeutung dieses Lehnwortguts für die Entwicklung des Englischen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Englisch-skandinavischer Sprachkontakt, angelsächsische Zeit, altnordisches Lehnwortgut, Sprachintegration, Danelaw, Wikinger, Altenglisch, mittelenglische Entwicklung, Sprachvergleich, Lehnworttypen.
- Quote paper
- Janna Falkenstein (Author), 2001, Die lexikalischen Folgen des englisch-skandinavischen Sprachkontakts in angelsächsischer Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69922