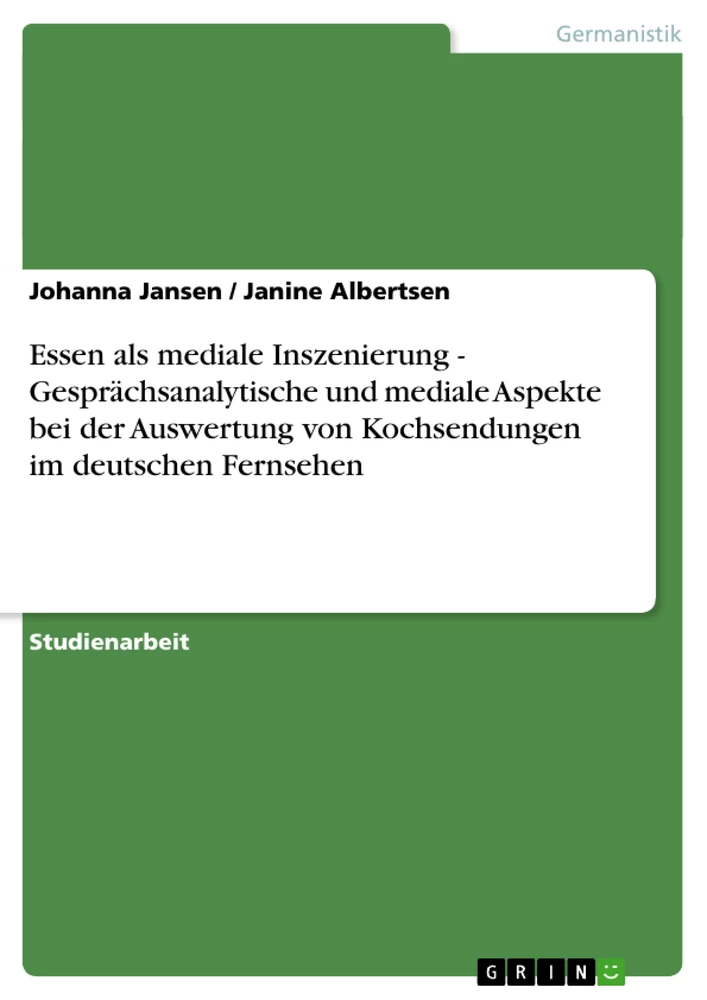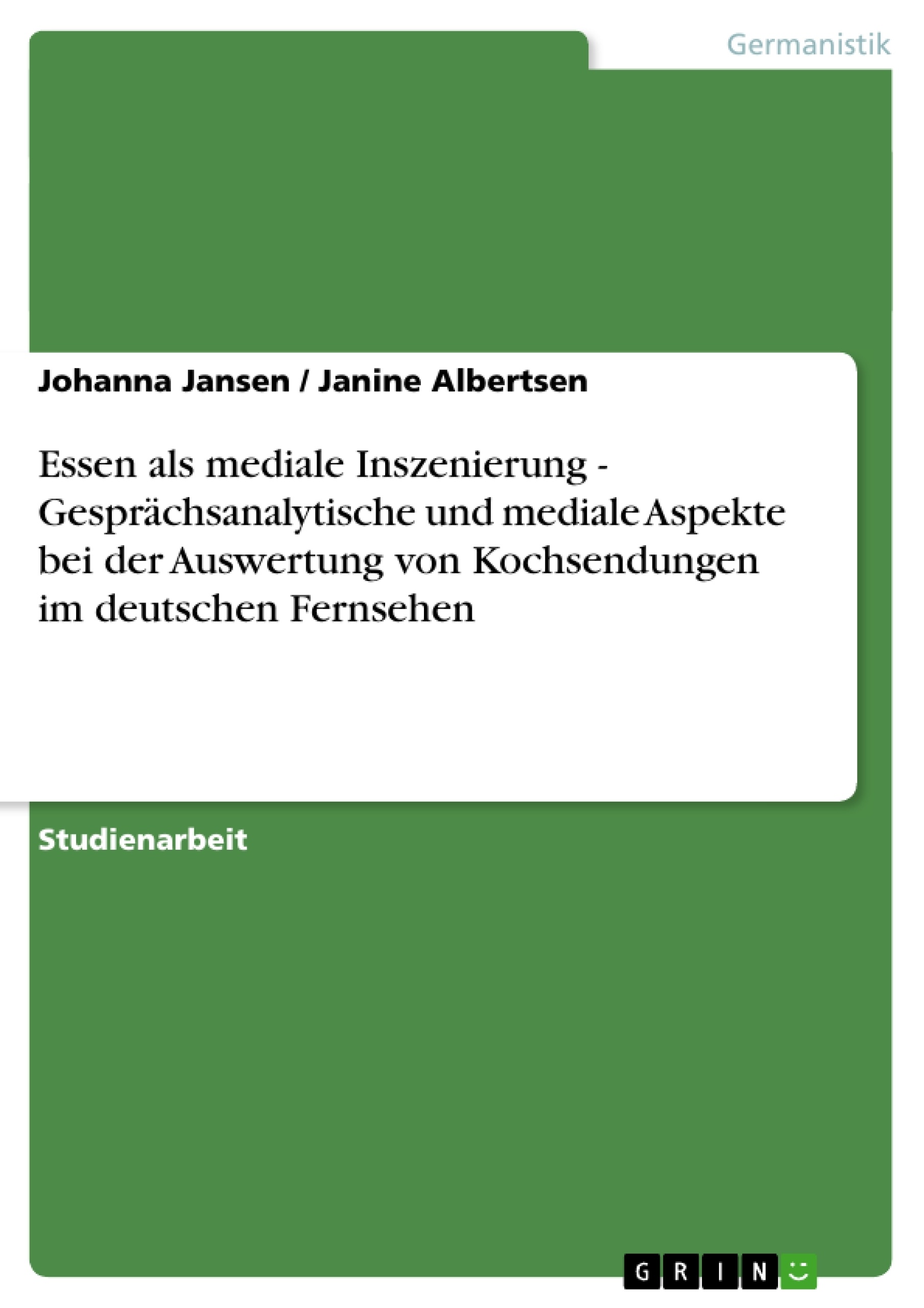Kochsendungen erhalten immer mehr Einzug in das deutsche Fernsehprogramm. Sie sind ein fester Bestandteil der Programme verschiedener Fernsehanstalten und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. So kann man mittlerweile nahezu rund um die Uhr Menschen beim Kochen zusehen. Trotzdem ergeben Umfragen, dass immer weniger Menschen regelmäßig kochen. Ob sich diese beiden Tatsachen widersprechen, muss geklärt werden.
Die Inszenierungen dieser vielen Shows sind ganz unterschiedlich. Einige finden live in einem Fernsehstudio mit Publikum statt, andere sind eher als ‚Talkshow’ konzipiert, bei manchen ist das Kochen ein Wettkampf, wieder andere sind in andere Sendungen eingebettet und dienen nahezu ausschließlich der Informationsvermittlung.
Um diese Formate genauer zu differenzieren, soll zunächst geklärt werden, was man unter den Begriffen Information und Informationssendung sowie Unterhaltung und Unterhaltungssendung versteht, und es soll festgestellt werden, in welche dieser beiden Kategorien Kochsendungen einzuordnen sind. Danach geht es darum, mediale und inhaltliche Aspekte der drei Kochsendungen „Kochen bei Kerner“, „Alfredissimo“ und „Schmeckt nicht, gibt’s nicht“ zu untersuchen und miteinander zu vergleichen. Hieran schließt sich eine kritische Betrachtung des Sendeformats Kochshow an.
Nachfolgend sollen die gesprächsanalytischen Aspekte von Kochsendungen thematisiert werden, indem zunächst der Begriff Textsorte definiert werden soll, woraufhin versucht wird, die Kochshows einer Textsorte zuzuordnen. Daraufhin werden Transkripte von „Kochen bei Kerner“ und „Alfredissimo“ aufgeführt und analysiert.
Den Abschluss bildet ein zusammenfassendes Fazit in Form einer persönlichen Schlussbetrachtung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Allgemeines über Kochsendungen
- 2.1 Information und Informationssendungen
- 2.2 Unterhaltung und Unterhaltungssendungen
- 2.3 Vorläufiges Fazit
- 3. Mediale Inszenierung
- 3.1 Definition Medium
- 3.2 Kochsendungen im Vergleich
- 3.2.1 Weitere Kochsendungen
- 3.3 Kritik an Kochshows
- 4. Gesprächsanalytische Aspekte
- 4.1 Das „ideale“ Gespräch
- 4.2 Textsorte
- 4.2.1 Das Mehrebenenmodell nach Heinemann und Viehweger
- 4.2.2 Textsorte Kochshow
- 4.2 Analysebeispiel eines Textausschnitts einer Kerner-Sendung
- 4.3 Analysebeispiel eines Textausschnitts einer Biolek-Sendung
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Kochsendungen im deutschen Fernsehen aus gesprächsanalytischer und medialer Perspektive. Ziel ist es, die verschiedenen Inszenierungsformen von Kochshows zu analysieren und deren Einordnung in die Kategorien Information und Unterhaltung zu beleuchten. Dabei werden ausgewählte Sendungen verglichen und kritisch betrachtet.
- Klassifizierung von Kochsendungen als Informations- oder Unterhaltungssendungen
- Analyse der medialen Inszenierung verschiedener Kochshow-Formate
- Gesprächsanalytische Untersuchung von ausgewählten Kochsendungen
- Vergleich verschiedener Kochsendungen und ihrer jeweiligen Stilmittel
- Kritische Auseinandersetzung mit dem Sendeformat "Kochshow"
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis zwischen der steigenden Popularität von Kochsendungen und dem gleichzeitigen Rückgang des regelmäßigen Kochens in privaten Haushalten. Sie umreißt die verschiedenen Inszenierungsformen von Kochshows und kündigt die methodischen Ansätze der Arbeit an: die Untersuchung der Kategorien Information und Unterhaltung sowie die gesprächsanalytische Betrachtung ausgewählter Sendungen.
2. Allgemeines über Kochsendungen: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte der Kochsendungen im deutschen und internationalen Fernsehen. Es beginnt mit den Anfängen im britischen und deutschen Fernsehen und zeichnet die Entwicklung bis in die Gegenwart nach. Dabei werden wichtige Persönlichkeiten der Fernsehkochszene erwähnt und unterschiedliche Stile und Formate von Kochshows skizziert. Besondere Aufmerksamkeit wird der Frage gewidmet, warum die ersten Fernsehköche überwiegend Männer waren, obwohl man eigentlich Hausfrauen als primäre Zielgruppe und somit auch als natürliche Kandidaten erwarten könnte. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere Analyse, indem es den Wandel der Fernsehkultur und die damit verbundene Entwicklung von Kochsendungen als hybride Formate aus Information und Unterhaltung aufzeigt.
2.1 Information und Informationssendungen: Dieses Unterkapitel definiert den Begriff „Information“ aus textlinguistischer Sicht und beschreibt charakteristische Merkmale informativer Texte, wie z.B. die Deskription von Prozessen und Handlungsabläufen. Es dient als theoretische Grundlage für die spätere Einordnung von Kochsendungen in die Kategorien Information und Unterhaltung. Die Analyse der textlichen Merkmale informativer Texte bildet die Basis für den Vergleich mit den untersuchten Kochshows und erlaubt eine differenziertere Einordnung.
2.2 Unterhaltung und Unterhaltungssendungen: Dieses Unterkapitel (angedeutet im Auszug) wird sich vermutlich mit der Definition und den Merkmalen von Unterhaltungssendungen befassen und somit die Gegenseite zur Informationssendung bilden. Dies ist essentiell für die Einordnung der Kochsendungen und die Diskussion darüber, ob sie primär informativ oder unterhaltend sind, oder ob eine Mischform vorliegt.
3. Mediale Inszenierung: Kapitel 3 fokussiert sich auf die mediale Gestaltung von Kochshows. Es wird eine Definition von "Medium" gegeben und ein Vergleich verschiedener Sendungen, wie "Kochen bei Kerner", "Alfredissimo" und "Schmeckt nicht, gibt's nicht", hinsichtlich ihrer Inszenierung durchgeführt. Die Analyse beleuchtet die Unterschiede in den Produktionsbedingungen, der Präsentation der Köche und der Inszenierung des Kochprozesses. Es wird auf die unterschiedlichen Strategien eingegangen, die zum Einsatz kommen, um Zuschauer zu unterhalten und zu informieren.
4. Gesprächsanalytische Aspekte: Kapitel 4 widmet sich der gesprächsanalytischen Untersuchung von Kochshows. Zuerst wird der Begriff "Textsorte" definiert und versucht, Kochshows einer bestimmten Textsorte zuzuordnen. Anschließend werden Transkripte von "Kochen bei Kerner" und "Alfredissimo" analysiert und detailliert untersucht. Die Analyse umfasst die Gesprächsstrukturen, die verwendeten Sprachmittel und die Interaktion zwischen den Gesprächspartnern. Die Ergebnisse liefern Erkenntnisse über die kommunikativen Strategien und die Gestaltung des Gesprächsflusses in Kochshows.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Kochsendungen im deutschen Fernsehen
Was ist der Gegenstand der Analyse?
Die Arbeit analysiert Kochsendungen im deutschen Fernsehen aus gesprächsanalytischer und medialer Perspektive. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Inszenierungsformen von Kochshows und deren Einordnung in die Kategorien Information und Unterhaltung.
Welche Ziele verfolgt die Analyse?
Ziel der Analyse ist es, die verschiedenen Inszenierungsformen von Kochshows zu analysieren und deren Einordnung in die Kategorien Information und Unterhaltung zu beleuchten. Ausgewählte Sendungen werden verglichen und kritisch betrachtet. Die Arbeit untersucht auch das Verhältnis zwischen der steigenden Popularität von Kochsendungen und dem gleichzeitigen Rückgang des regelmäßigen Kochens in privaten Haushalten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Analyse behandelt folgende Schwerpunkte: Klassifizierung von Kochsendungen als Informations- oder Unterhaltungssendungen; Analyse der medialen Inszenierung verschiedener Kochshow-Formate; Gesprächsanalytische Untersuchung ausgewählter Kochsendungen; Vergleich verschiedener Kochsendungen und ihrer jeweiligen Stilmittel; Kritische Auseinandersetzung mit dem Sendeformat "Kochshow".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Allgemeines über Kochsendungen (inkl. Unterkapitel zu Information und Unterhaltungssendungen), Mediale Inszenierung, Gesprächsanalytische Aspekte (inkl. Analysebeispiele von Kerner und Biolek Sendungen) und Schlussbetrachtung.
Was wird im Kapitel "Allgemeines über Kochsendungen" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte der Kochsendungen im deutschen und internationalen Fernsehen, beschreibt verschiedene Stile und Formate und untersucht den Wandel der Fernsehkultur und die Entwicklung von Kochsendungen als hybride Formate aus Information und Unterhaltung. Es wird auch die Frage nach dem Übergewicht männlicher Fernsehköche trotz weiblicher Zielgruppe behandelt.
Was wird im Kapitel "Mediale Inszenierung" behandelt?
Kapitel 3 konzentriert sich auf die mediale Gestaltung von Kochshows. Es beinhaltet eine Definition von "Medium" und einen Vergleich verschiedener Sendungen (z.B. "Kochen bei Kerner", "Alfredissimo", "Schmeckt nicht, gibt's nicht") hinsichtlich ihrer Inszenierung, Produktionsbedingungen, Präsentation der Köche und Inszenierung des Kochprozesses.
Was wird im Kapitel "Gesprächsanalytische Aspekte" behandelt?
Kapitel 4 widmet sich der gesprächsanalytischen Untersuchung von Kochshows. Es definiert den Begriff "Textsorte", ordnet Kochshows einer Textsorte zu und analysiert Transkripte von "Kochen bei Kerner" und "Alfredissimo". Die Analyse umfasst Gesprächsstrukturen, Sprachmittel und die Interaktion zwischen den Gesprächspartnern.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet gesprächsanalytische und medienwissenschaftliche Methoden. Sie analysiert die Textstrukturen, die verwendeten Sprachmittel und die Interaktion zwischen den Gesprächspartnern in den ausgewählten Kochsendungen. Sie vergleicht verschiedene Formate und untersucht deren mediale Inszenierung.
Welche Sendungen werden analysiert?
Die Analyse bezieht sich auf ausgewählte Kochsendungen, darunter explizit "Kochen bei Kerner" und "Alfredissimo" sowie implizit "Schmeckt nicht, gibt's nicht" und eine Biolek-Sendung. Die genaue Auswahl der Sendungen ist im Volltext detailliert beschrieben.
- Quote paper
- Johanna Jansen (Author), Janine Albertsen (Author), 2006, Essen als mediale Inszenierung - Gesprächsanalytische und mediale Aspekte bei der Auswertung von Kochsendungen im deutschen Fernsehen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69829