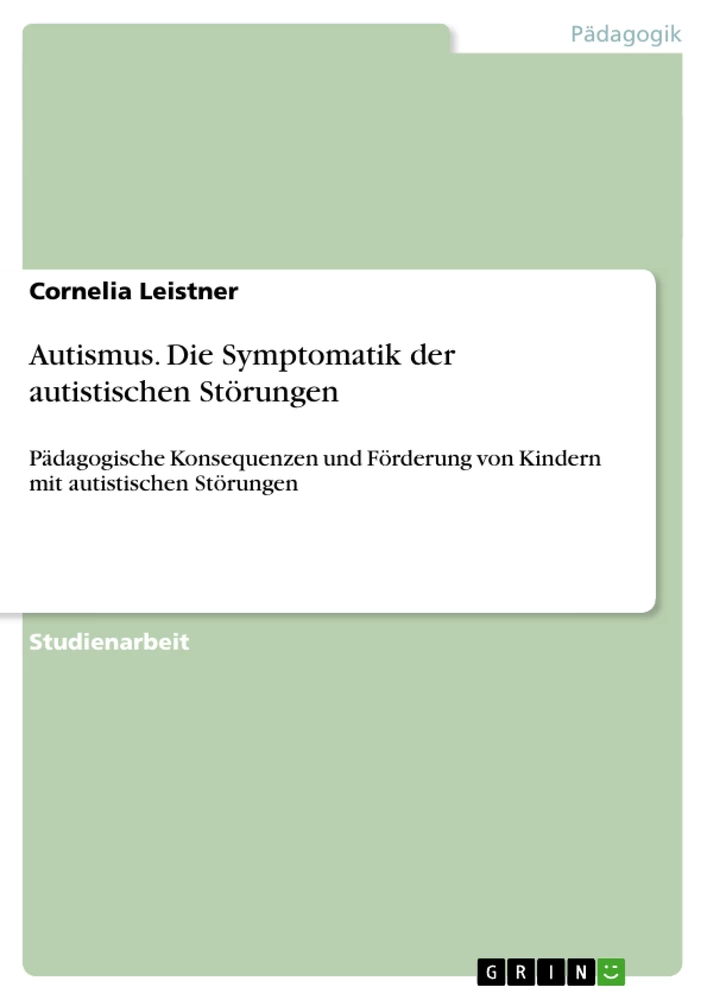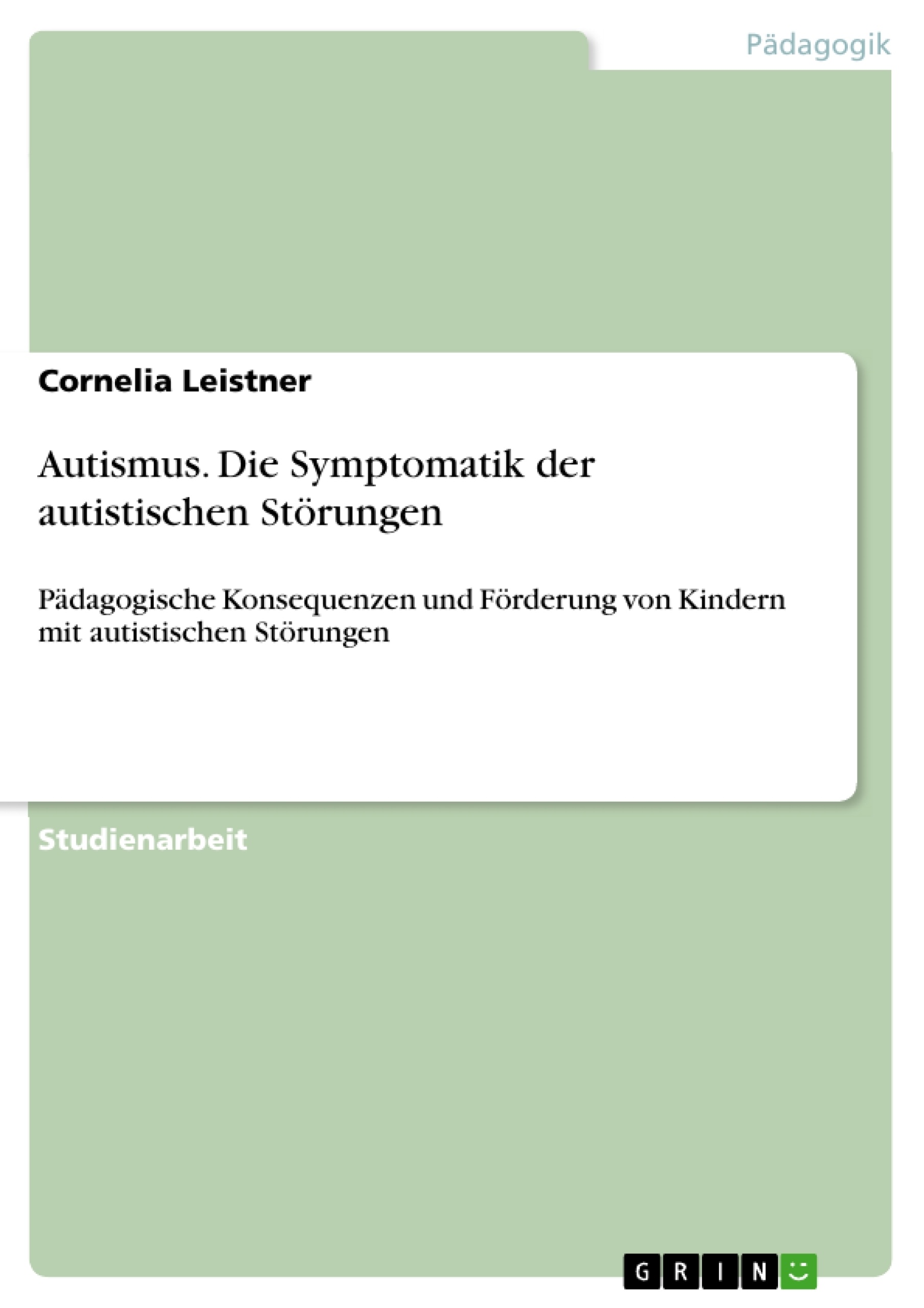Die Symptomatik der autistischen Störungen sowie die kontrovers diskutierten und sich teils ausschließenden Erklärungsmodelle üben eine hohe Faszinationskraft aus. Es bestehen immer noch Unklarheiten bezüglich der Ätiologie, der kognitiven Fähigkeiten, der Zuordnung zur Behindertenrichtung sowie sinnvoller Interventionsmaßnahmen.
Gemäß des historischen Hintergrundes unterscheidet man zwischen dem Kanner – Autismus (auch `low – functioning – autism´) und dem Asperger – Autismus (auch `high – functioning – autism).
Wing (1981) stellte eine Triade auf, nach der sie die autistische Störung durch drei Symptome definiert:
1. „ernstes Defizit beim sozialen Zusammensein;
2.Defizit in verbaler und nonverbaler Kommunikation
3. Defizit in flexiblen, phantasiegeleiteten Aktivitäten, statt dessen ein Verhaltensmuster, das von Wiederholungen und Stereotypien dominiert wird.“
Kanner: Frühkindlicher Autismus
Der frühkindliche Autismus nach Kanner definiert sich als eine schwere Entwicklungsstörung im emotionalen und motorischen Bereich sowie Kontakt- und Wahrnehmungsstörungen.
Im DSM – IV (Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen) werden folgende Kardinalsymptome bzw. Primärsymptome für frühkindlichen Autismus nach Kanner aufgeführt:
1. qualitative Abweichung in der sozialen Interaktion (eingeschränkter Gebrauch von Mimik, Gestik, Körperhaltung als Instrument sozialer Interaktion; Unfähigkeit der Beziehung zu Gleichaltrigen; Mangel an Empathie ; Mangel am sozio - emotionaler Gegenseitigkeit)
2. qualitative Abweichung im Kommunikationsmuster (verzögertes oder Ausbleiben der Sprache; Sprache ist idiosynkratisch, stereotyp oder repetitiv; Fehlen von Imitations- und Rollenspiel)
3. begrenzte, stereotypes und sich wiederholendes Repertoire von Interessen und Aktivitäten (starre Rituale und Gewohnheiten; stereotype und repetitive Manierismen, ständige Objektbeschäftigung,)
Weiterhin liegt der Beginn der Störung vor dem 3. Lebensjahr, und es zeigt sich eine Verzögerung oder abnorme Funktionsfähigkeit in den folgenden Bereichen:
a) soziale Interaktion oder
b) Sprache als Kommunikationsmittel oder
c) Symbolisches oder Phantasiespiel.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung in die Thematik
- 2. Definition und Klassifikation
- 2.1 Einleitung
- 2.2 Historischer Abriß
- 2.3 Klassische Ansätze
- 2.3.1 Kanner: Frühkindlicher Autismus
- 2.3.2 Asperger: Autistische Psychopathie
- 2.4 Kontinuum des autistischen Störungsbildes
- 2.5 Verwandte Störungsbilder
- 3. Epidemiologie
- 3.1 Prävalenz, Inzidenz, Intelligenzverteilung
- 3.1.1 Prävalenz beim Autismus nach Kanner
- 3.1.2 Prävalenz bei der Autistischen Psychopathie nach Asperger
- 3.1 Prävalenz, Inzidenz, Intelligenzverteilung
- 4. Diagnostik
- 5. Ätiologie
- 5.1 Prädisponierende Faktoren
- 5.2 Auslösende Faktoren
- 5.3 Aufrechterhaltende Faktoren
- 6. Erklärungsmodelle
- 6.1 Kognitionspsychologischer Erklärungsansatz
- 6.2 Tiefenpsychologischer Ansatz
- 6.3 Multifaktorieller Ansatz
- 6.4 Sensomotorischer Ansatz
- 6.5 Lernpsychologischer Ansatz
- 6.6 Weitere Ansätze
- 7. Therapeutische Ansätze
- 7.1 Sensomotorische Ansätze
- 7.1.1 Sensorische Integrationsbehandlung nach J. Ayres
- 7.1.2 Aufmerksamkeits-Interaktionstherapie
- 7.1.3 Weitere körpertherapeutische Behandlungen
- 7.1.4 Gestützte Kommunikation (facilitated communication)
- 7.1.5 Patterning / Neurologische Organisation
- 7.2 Lernpsychologischer Ansatz
- 7.2.1 Lerntheoretische Methode
- 7.3 Tiefenpsychologische Ansätze
- 7.3.1 Die psychische Geburt des Menschen
- 7.3.1 Bettelheims Autismustherapie
- 7.4 Lautsprachunabhängige Ansätze
- 7.4.1 Musiktherapie
- 7.4.1.1 Musiktherapie nach Juliette Alvin
- 7.4.1.2 Musiktherapie nach Getrud Orff
- 7.4.1.3 Schöpferische Musiktherapie
- 7.4.1 Musiktherapie
- 7.5 Audiosensorische Ansätze
- 7.5.1 Audiovokales Training
- 7.5.2 Kompensatorische Gehörschulung
- 7.6 Konfliktpsychologischer Ansatz
- 7.6.1 Festhaltetherapie / Forced Holding
- 7.7 Biochemische Ansätze
- 7.7.1 Vitamin- und Mineralstofftherapie
- 7.7.2 Medikamentöse Behandlung
- 7.8 Optionsmethode
- 7.9 Quantitative Hirnfunktionsanalyse und Neurofeedback
- 7.1 Sensomotorische Ansätze
- 8. Pädagogische Konsequenzen und Förderung von Kindern mit autistischen Störungen
- 8.1 Thesen einer angemessenen Förderung
- 8.1.1 Entwicklungspsychologische Förderthesen
- 8.1.2 Ökologische Förderthesen
- 8.1.3 Steinadels Förderthesen
- 8.2 Betrachtung der eigenen Rolle
- 8.3 Eigenschaften eines Helfers
- 8.4 Die Familie
- 8.5 Vorstellung eines Förderprogrammes: Der TEACCH -Ansatz
- 8.1 Thesen einer angemessenen Förderung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Autismus. Ziel ist es, ein detailliertes Verständnis der Definition, Klassifizierung, Epidemiologie, Diagnostik, Ätiologie und therapeutischen sowie pädagogischen Ansätze zu vermitteln. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Erklärungsmodelle und berücksichtigt die vielschichtigen Aspekte dieser komplexen Störung.
- Definition und Klassifikation von Autismus
- Epidemiologische Aspekte und Prävalenzraten
- Vielfalt der Erklärungsmodelle für Autismus
- Therapeutische Interventionen und Behandlungsansätze
- Pädagogische Konsequenzen und Fördermöglichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung in die Thematik: Dieses einführende Kapitel legt den Grundstein für die gesamte Arbeit und liefert einen Überblick über das Thema Autismus, seine Relevanz und die zentralen Fragestellungen, die im weiteren Verlauf behandelt werden. Es dient als Einstieg in die komplexe Thematik und bereitet den Leser auf die detaillierten Ausführungen in den folgenden Kapiteln vor.
2. Definition und Klassifikation: Dieses Kapitel definiert Autismus und beleuchtet seine verschiedenen Ausprägungen. Es gibt einen historischen Abriss der Autismusforschung, vergleicht klassische Ansätze wie die von Kanner und Asperger und diskutiert das Kontinuum des autistischen Störungsbildes sowie verwandte Störungsbilder. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Verständnisses von Autismus im Laufe der Zeit und der Vielfalt der damit verbundenen Symptome und Erscheinungsformen.
3. Epidemiologie: Dieses Kapitel befasst sich mit der Verbreitung von Autismus in der Bevölkerung. Es analysiert Prävalenz- und Inzidenzraten, untersucht die Intelligenzverteilung bei betroffenen Personen und differenziert zwischen den Prävalenzraten beim frühkindlichen Autismus nach Kanner und der autistischen Psychopathie nach Asperger. Die statistischen Daten liefern einen wichtigen Einblick in das Ausmaß der Erkrankung und ihre Relevanz für die Gesellschaft.
4. Diagnostik: Hier werden die diagnostischen Verfahren und Kriterien zur Erkennung von Autismus erläutert. Das Kapitel beschreibt die Methoden, die zur Feststellung einer autistischen Störung verwendet werden, und beleuchtet die Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der Diagnosestellung. Es betont die Bedeutung einer frühzeitigen und präzisen Diagnose für den Therapieverlauf.
5. Ätiologie: Dieses Kapitel untersucht die Ursachen von Autismus. Es unterscheidet zwischen prädisponierenden, auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren, die zur Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung beitragen. Die Erörterung verschiedener Einflussfaktoren, sowohl genetischer als auch umweltbezogener, bietet einen umfassenden Einblick in die komplexen Ursachen von Autismus.
6. Erklärungsmodelle: Hier werden verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung von Autismus vorgestellt. Kognitionspsychologische, tiefenpsychologische, multifaktorielle, sensomotorische und lernpsychologische Erklärungsmodelle werden diskutiert. Das Kapitel beleuchtet die verschiedenen Perspektiven auf die Ursachen und Mechanismen von Autismus und zeigt die Komplexität des Phänomens auf.
7. Therapeutische Ansätze: Dieses Kapitel präsentiert eine Vielzahl von Therapieansätzen für Autismus, einschließlich sensomotorischer, lernpsychologischer, tiefenpsychologischer, lautsprachunabhängiger, audiosensorischer, konfliktpsychologischer und biochemischer Methoden. Es werden verschiedene Therapieformen im Detail beschrieben, und deren jeweilige Wirkungsweise und Anwendungsmöglichkeiten werden erläutert. Der Schwerpunkt liegt auf der Bandbreite der verfügbaren Therapien und deren Anpassung an die individuellen Bedürfnisse der betroffenen Personen.
8. Pädagogische Konsequenzen und Förderung von Kindern mit autistischen Störungen: Dieses Kapitel befasst sich mit den pädagogischen Konsequenzen und Fördermöglichkeiten für Kinder mit Autismus. Es werden thesenbasierte Förderansätze diskutiert, die Rolle der Bezugspersonen hervorgehoben und ein konkretes Förderprogramm, der TEACCH-Ansatz, vorgestellt. Das Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Aspekte der pädagogischen Begleitung von Kindern mit Autismus.
Schlüsselwörter
Autismus, Autistische Psychopathie, Frühkindlicher Autismus, Kanner, Asperger, Diagnostik, Ätiologie, Erklärungsmodelle, Therapie, Pädagogik, Förderung, Prävalenz, Inzidenz, Sensomotorik, Lernpsychologie, Tiefenpsychologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Autismus - Ein umfassender Überblick
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Autismus. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, und abschließend Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Definition, Klassifizierung, Epidemiologie, Diagnostik, Ätiologie, sowie therapeutischen und pädagogischen Ansätzen zum Thema Autismus.
Welche Kapitel werden behandelt?
Das Dokument gliedert sich in acht Kapitel: 1. Einführung, 2. Definition und Klassifizierung (inklusive historischem Abriss und Vergleich klassischer Ansätze von Kanner und Asperger), 3. Epidemiologie (Prävalenz, Inzidenz, Intelligenzverteilung), 4. Diagnostik, 5. Ätiologie (prädisponierende, auslösende und aufrechterhaltende Faktoren), 6. Erklärungsmodelle (kognitionspsychologisch, tiefenpsychologisch, multifaktoriell, sensomotorisch, lernpsychologisch und weitere), 7. Therapeutische Ansätze (sensomotorisch, lernpsychologisch, tiefenpsychologisch, lautsprachunabhängig, audiosensorisch, konfliktpsychologisch, biochemisch und weitere), und 8. Pädagogische Konsequenzen und Förderung (inklusive des TEACCH-Ansatzes).
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Ziel ist es, ein detailliertes Verständnis der Definition, Klassifizierung, Epidemiologie, Diagnostik, Ätiologie und therapeutischen sowie pädagogischen Ansätze von Autismus zu vermitteln. Es beleuchtet verschiedene Erklärungsmodelle und die vielschichtigen Aspekte dieser komplexen Störung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Schwerpunkte liegen auf der Definition und Klassifizierung von Autismus, epidemiologischen Aspekten und Prävalenzraten, der Vielfalt der Erklärungsmodelle, therapeutischen Interventionen und Behandlungsansätzen sowie pädagogischen Konsequenzen und Fördermöglichkeiten.
Welche klassischen Ansätze zur Definition von Autismus werden verglichen?
Die Ansätze von Leo Kanner (Frühkindlicher Autismus) und Hans Asperger (Autistische Psychopathie) werden verglichen und in ihren historischen Kontext eingeordnet.
Welche Erklärungsmodelle für Autismus werden vorgestellt?
Das Dokument präsentiert kognitionspsychologische, tiefenpsychologische, multifaktorielle, sensomotorische und lernpsychologische Erklärungsmodelle. Zusätzliche Ansätze werden ebenfalls erwähnt.
Welche therapeutischen Ansätze werden beschrieben?
Es wird eine breite Palette an therapeutischen Ansätzen beschrieben, darunter sensomotorische Ansätze (z.B. Sensorische Integrationsbehandlung nach Ayres), lernpsychologische Methoden, tiefenpsychologische Ansätze (z.B. Bettelheims Autismustherapie), lautsprachunabhängige Ansätze (z.B. Musiktherapie), audiosensorische Ansätze, konfliktpsychologische Ansätze (z.B. Festhaltetherapie), biochemische Ansätze (z.B. Vitamin- und Mineralstofftherapie, medikamentöse Behandlung), die Optionsmethode und Neurofeedback.
Welche pädagogischen Fördermöglichkeiten werden erläutert?
Das Kapitel zur Pädagogik behandelt thesenbasierte Förderansätze (entwicklungspsychologisch, ökologisch, Steinadel), die Rolle der Bezugspersonen, Eigenschaften eines Helfers, die Bedeutung der Familie und stellt den TEACCH-Ansatz als konkretes Förderprogramm vor.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Autismus, Autistische Psychopathie, Frühkindlicher Autismus, Kanner, Asperger, Diagnostik, Ätiologie, Erklärungsmodelle, Therapie, Pädagogik, Förderung, Prävalenz, Inzidenz, Sensomotorik, Lernpsychologie, Tiefenpsychologie.
- Quote paper
- Dipl. Päd., Andragogin Cornelia Leistner (Author), 1999, Autismus. Die Symptomatik der autistischen Störungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6981