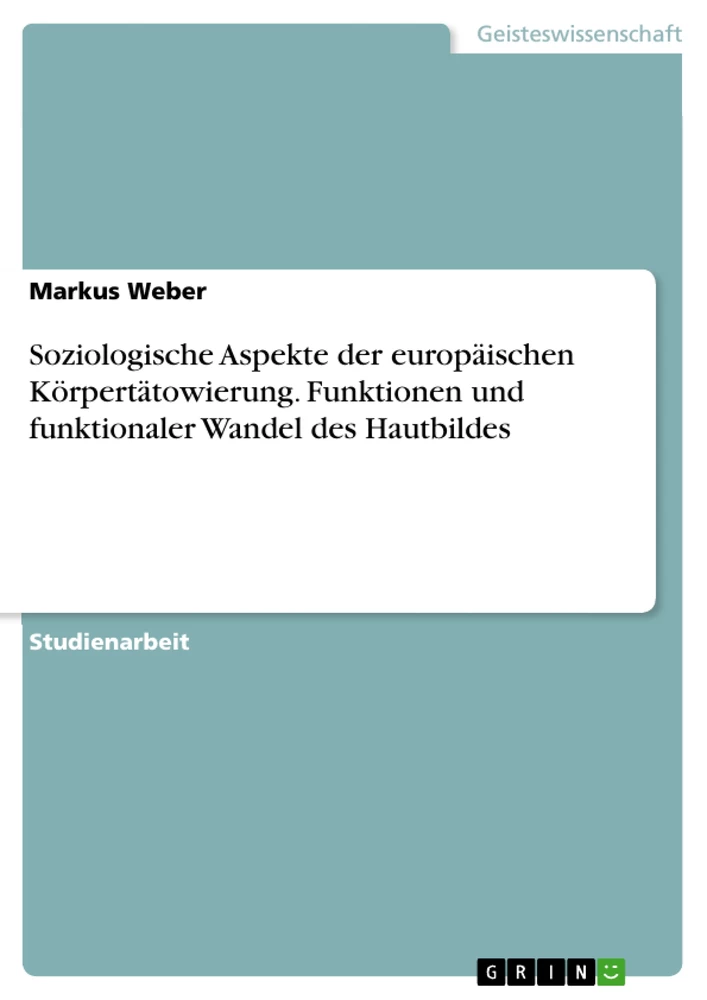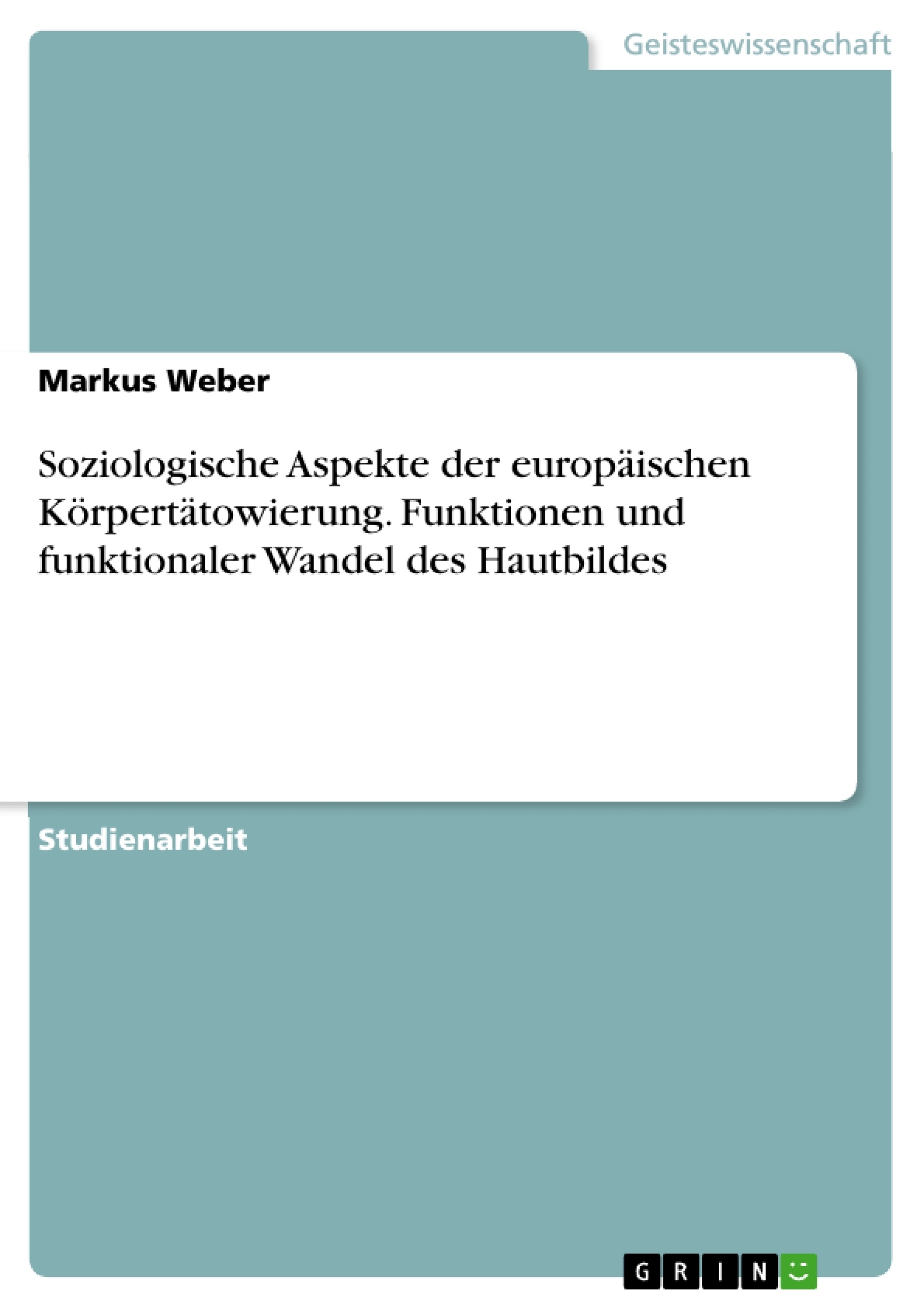„Tätowierungen und ihre Träger bilden eine Einheit. Eine sinnvolle wissenschaftliche Beschäftigung mit der Tätowierung muss also Hautbild und Träger gleichermaßen erfassen […]. Die Befragung tätowierter Personen ist also nahezu zwingend“ (Friederich 1993, S. 9).
So legt Matthias Friederich die Methodik seiner kultursoziologischen Untersuchung fest. Dieser Marschroute folgend, sollen die identitätsstiftenden und sozialen Funktionen des Hautstichs, welche in der vorliegenden Arbeit dargestellt und typologisiert werden, mittels zum einen aus der Literatur sekundäranalytisch ausgewählten und zum anderen in nicht-standardisierten Interviews selbst erhobenen Zitaten tätowierter Menschen überprüft und in ihrem lebensweltlichen Kontext dargestellt werden. Der Methodik der durchgeführten Interviews sowie deren Kritik möchte ich im folgenden Kapitel Platz einräumen.
Weiterhin erscheint es mir notwendig, im daran anschließenden Teil dem Leser eine der Arbeit angemessene kurze Einführung in die Entwicklungsgeschichte der europäischen Tätowierung zu geben, anhand derer soziale und personale Aspekte der Tätowierung erarbeitet werden sollen, bevor die Ergebnisse dieser Analyse in einem Fazit zusammenfassend resümiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Methoden(kritik)
- 3. Die Tätowierung als kulturelle Erscheinung – Begrifflichkeit, Entwicklung und Verbreitung
- 3.1. Die Tätowierung – Definition
- 3.2. Entstehung und Verbreitung der Tätowierung in Europa
- 4. Symbolvermittelte Kommunikation und Funktionsebenen der Tätowierung
- 4.1. Soziale Positionierung durch Tätowierungen
- 4.2. Die Ästhetisierung des Körpers
- 4.3. Die Sexualisierung durch Tätowierungen
- 5. Fazit
- 6. Quellen- und Literaturnachweis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht soziologische Aspekte der europäischen Körpertätowierung, insbesondere deren Funktionen und funktionalen Wandel. Sie beleuchtet die Entwicklung der Tätowierung als kulturelles Phänomen und analysiert ihre Bedeutung als Form der Selbstinszenierung und sozialen Kommunikation im Kontext des modernen Körperkults. Die Arbeit stützt sich auf Literaturrecherche und qualitative Interviews.
- Der Wandel der sozialen Bedeutung von Tätowierungen
- Die Tätowierung als Mittel der Selbstinszenierung und Identitätsbildung
- Die Rolle der Medien in der Konstruktion von Körperbildern und der Wahrnehmung von Tätowierungen
- Die Funktion von Tätowierungen in der sozialen Kommunikation und Positionierung
- Die Ästhetisierung und Sexualisierung des Körpers durch Tätowierungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung beschreibt den "neuen Körperkult" und die zunehmende Bedeutung des Körpers als Ort der Selbstinszenierung in einer virtualisierten Welt. Sie hebt die wachsende soziale Bedeutung ästhetischer Körperzeichen hervor und stellt die Tätowierung als eine Form der körperlichen Selbsterfahrung und -kommunikation vor. Die Arbeit argumentiert, dass die europäische Sozialwissenschaft sich bisher nur marginal mit diesem Phänomen auseinandergesetzt hat, obwohl Tätowierungen eine weit verbreitete kulturelle Praxis sind. Der Aufsatz wird die identitätsstiftenden und sozialen Funktionen der Tätowierung untersuchen.
2. Methoden(kritik): Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es wurden drei narrative Interviews mit tätowierten Studierenden durchgeführt. Die Auswahl der Interviewpartner ist auf ein relativ homogenes Milieu beschränkt, was die Ergebnisse beeinflusst. Die Nähe zwischen den Interviewpartnern und dem Autor könnte zu einer „kalkulierten Selbstrepräsentation“ geführt haben. Die Interviews wurden aufgezeichnet und transkribiert. Die Arbeit nutzt zusätzlich Literaturquellen und andere Interviews.
3. Die Tätowierung als kulturelle Erscheinung – Begrifflichkeit, Entwicklung und Verbreitung: Dieses Kapitel bietet einen kurzen historischen Überblick über die Entwicklung der Tätowierung in Europa. Es betonen die Notwendigkeit, die historische Entwicklung zu verstehen, um die heutigen Funktionen der Tätowierung zu analysieren. Es wird der Versuch gemacht, die Vergleichbarkeit und Unterscheidbarkeit zu früheren Funktionen aufzuzeigen. Die erschöpfende Darstellung der Historie würde jedoch den Rahmen der Arbeit sprengen.
Schlüsselwörter
Körperkult, Tätowierung, Körpermodifikation, Selbstinszenierung, soziale Kommunikation, Identität, soziale Positionierung, Ästhetisierung, Sexualisierung, qualitative Interviews, Methodenkritik, europäische Kulturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Arbeit: Soziologische Aspekte der europäischen Körpertätowierung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht soziologische Aspekte der europäischen Körpertätowierung, insbesondere deren Funktionen und funktionalen Wandel. Sie beleuchtet die Entwicklung der Tätowierung als kulturelles Phänomen und analysiert ihre Bedeutung als Form der Selbstinszenierung und sozialen Kommunikation im Kontext des modernen Körperkults.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Literaturrecherche und qualitative Interviews. Konkret wurden drei narrative Interviews mit tätowierten Studierenden durchgeführt. Die Auswahl der Interviewpartner ist auf ein relativ homogenes Milieu beschränkt, was die Ergebnisse beeinflusst. Die Nähe zwischen den Interviewpartnern und dem Autor könnte zu einer „kalkulierten Selbstrepräsentation“ geführt haben. Die Interviews wurden aufgezeichnet und transkribiert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Der Wandel der sozialen Bedeutung von Tätowierungen; Die Tätowierung als Mittel der Selbstinszenierung und Identitätsbildung; Die Rolle der Medien in der Konstruktion von Körperbildern und der Wahrnehmung von Tätowierungen; Die Funktion von Tätowierungen in der sozialen Kommunikation und Positionierung; Die Ästhetisierung und Sexualisierung des Körpers durch Tätowierungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einführung, Methodenkritik, Die Tätowierung als kulturelle Erscheinung (inkl. Definition, Entstehung und Verbreitung in Europa), Symbolvermittelte Kommunikation und Funktionsebenen der Tätowierung (inkl. soziale Positionierung, Ästhetisierung und Sexualisierung), Fazit und Quellen- und Literaturnachweis.
Welche zentralen Aspekte werden im Kapitel "Die Tätowierung als kulturelle Erscheinung" behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen kurzen historischen Überblick über die Entwicklung der Tätowierung in Europa. Es betont die Notwendigkeit, die historische Entwicklung zu verstehen, um die heutigen Funktionen der Tätowierung zu analysieren und versucht, die Vergleichbarkeit und Unterscheidbarkeit zu früheren Funktionen aufzuzeigen. Eine erschöpfende Darstellung der Historie würde jedoch den Rahmen der Arbeit sprengen.
Was wird im Fazit zusammengefasst?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen (genaue Inhalte sind aus der vorliegenden Vorschau nicht ersichtlich).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Körperkult, Tätowierung, Körpermodifikation, Selbstinszenierung, soziale Kommunikation, Identität, soziale Positionierung, Ästhetisierung, Sexualisierung, qualitative Interviews, Methodenkritik, europäische Kulturgeschichte.
Welche Limitationen der Studie werden angesprochen?
Die Beschränkung auf Interviews mit einem relativ homogenen Milieu (tätowierte Studierende) und die potentielle Nähe zwischen Interviewpartnern und Autor, die zu einer „kalkulierten Selbstrepräsentation“ führen könnte, werden als methodische Limitationen genannt.
Gibt es eine Einleitung?
Ja, die Einleitung beschreibt den "neuen Körperkult" und die zunehmende Bedeutung des Körpers als Ort der Selbstinszenierung in einer virtualisierten Welt. Sie hebt die wachsende soziale Bedeutung ästhetischer Körperzeichen hervor und stellt die Tätowierung als eine Form der körperlichen Selbsterfahrung und -kommunikation vor. Die Arbeit argumentiert, dass die europäische Sozialwissenschaft sich bisher nur marginal mit diesem Phänomen auseinandergesetzt hat.
- Quote paper
- Magister Artium Markus Weber (Author), 2003, Soziologische Aspekte der europäischen Körpertätowierung. Funktionen und funktionaler Wandel des Hautbildes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69707