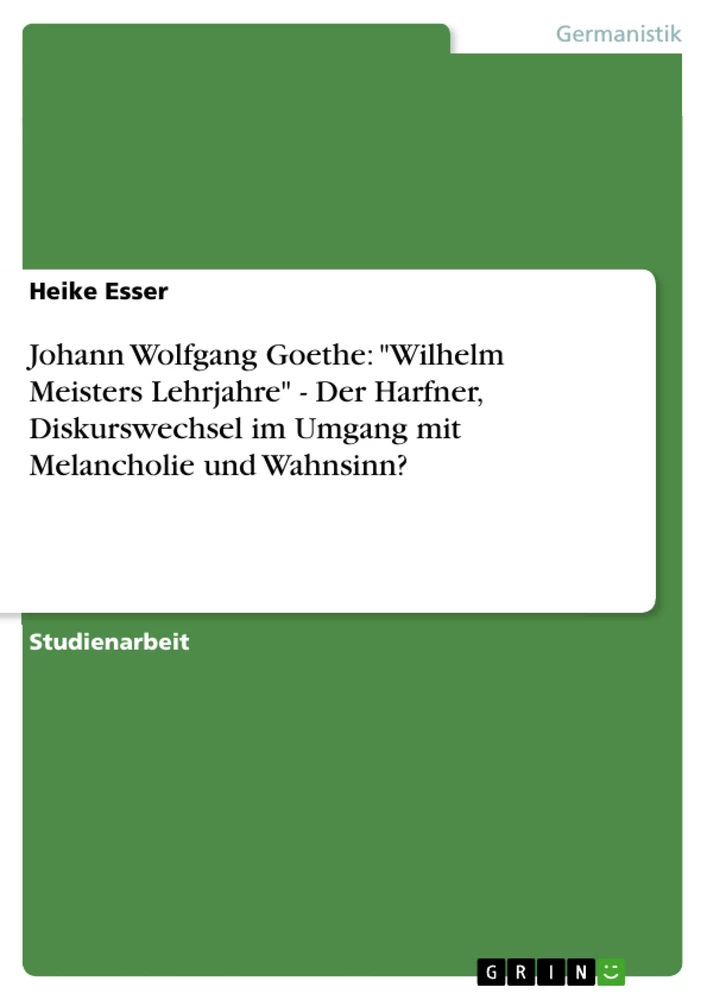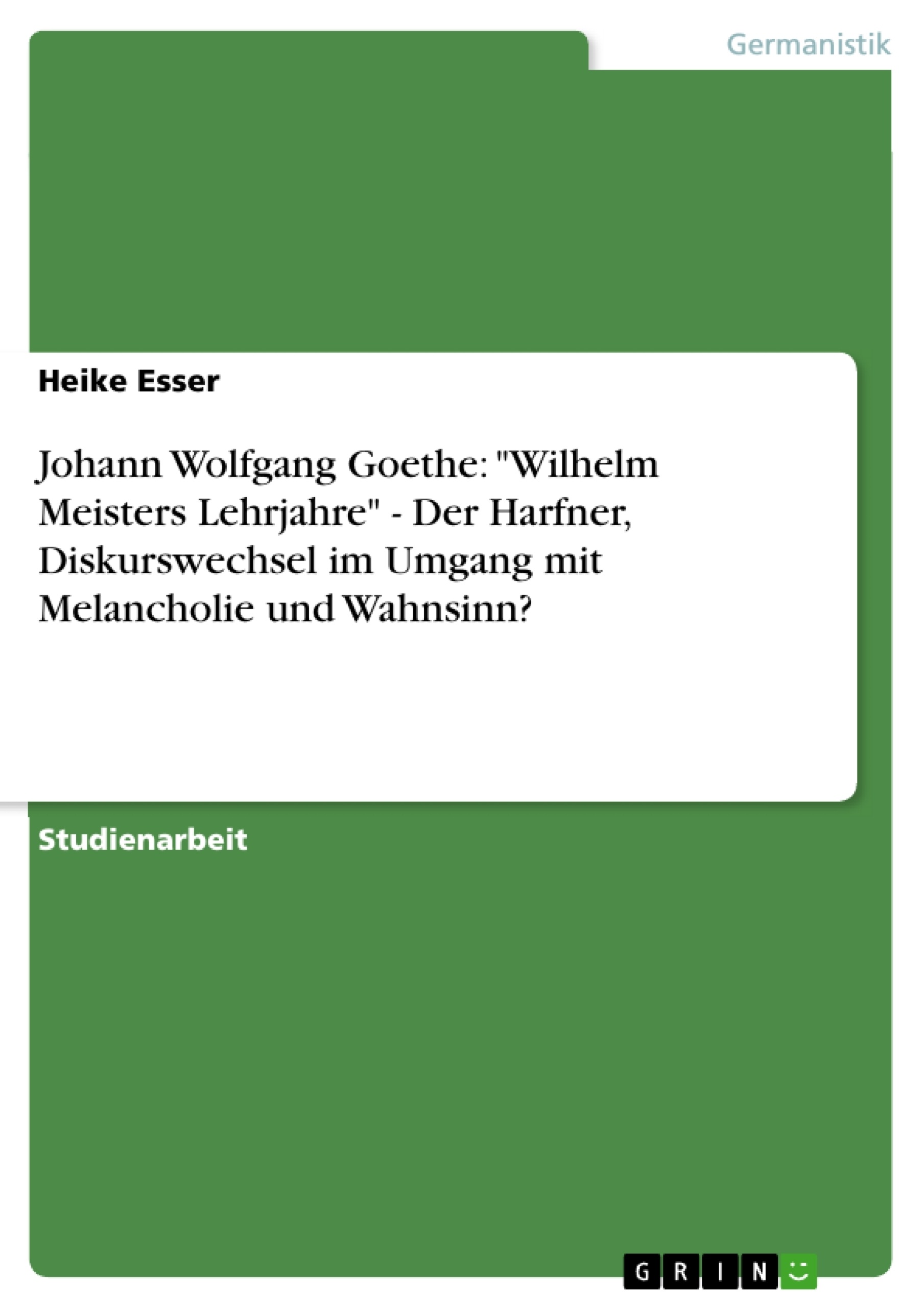Diese Arbeit setzt sich mit der erst in der jüngeren Forschung aufgeworfenen Frage auseinander, ob Goethes "Lehrjahre" einen Diskurswechsel im Umgang mit Melancholie und Wahnsinn beschreiben, und konzentriert sich dabei auf die Darstellung der Harfner-Figur.
Wie ein roter Faden durchziehen Melancholie und Wahnsinn den Roman, denn so verschiedene Figuren wie Laertes, der Graf und die Gräfin, Aurelie, Mignon, Sperata und der Harfner leiden unter melancholischen Anfällen, die sich im Falle des Harfners bis in eine Eskalation des Wahnsinns steigern. In der Krankheits- und Heilungsgeschichte des Harfners wird eine Veränderung im Umgang mit Melancholie und Wahnsinn besonders deutlich, denn bei ihm lässt sich die Entwicklung von einem melancholischen Gemütszustand über den ausbrechenden Wahnsinn bis hin zur Therapie verfolgen.
In Anlehnung an die Lebensgeschichte des Harfners teilt sich diese Arbeit in zwei Teile. Im ersten Teil stehen die europäische Melancholietradition und der Genie-Gedanke des Sturm und Drangs im Fokus und zwar im Hinblick darauf, wie und warum Goethe beides in seine Darstellung des Harfners hat einfließen lassen. Des Weiteren wird dessen Krankheitsgeschichte analysiert. Im zweiten Teil steht die Therapie des Harfners im Mittelpunkt. Der medizinische Diskurs der Melancholie und des Wahnsinns am Ende des 18. Jahrhunderts und Goethes Verhältnis zu diesem wird vorgestellt und mit der Therapie und den Therapiemaßnahmen am Harfner verglichen.
In dieser Arbeit wird nachgewiesen, dass Goethe sowohl mit der europäischen Melancholietradition als auch mit den zeitgenössischen medizinischen und psychologischen Diskursen vertraut war und belegt, dass die "Lehrjahre" und insbesondere die Darstellung des Harfners von einer intensiven Auseinandersetzung mit Melancholie und Wahnsinn, ihren Ursachen, Symptomen und Konsequenzen, geprägt wurden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Melancholie und Wahnsinn - Die Krankheitsgeschichte des Harfners
- 2.1 Goethes Bezug zur europäischen Melancholietradition
- 2.2 Das Auftreten und die Lieder des Harfners als Ausdruck der Melancholie und ihr Bezug zur Genie-Poetik
- 2.3 Die Vorstellung des Fluches als erste Zeichen des Wahnsinns
- 2.4 Die versuchte Opferung als Moment der Eskalation des Wahnsinns
- 3. Die Therapie von Melancholie und Wahnsinn beim Harfner
- 3.1 Goethe und der medizinische Diskurs zum Wahnsinn und zur Melancholie am Ende des 18. Jahrhunderts
- 3.2 Die Therapierung des Harfners nach den zentralen Grundsätzen des „moral management“
- 3.3 Die neue Rolle des Arztes in der Therapie
- 3.4 Der Wechsel des äußeren Erscheinungsbildes als finales Element der Therapie
- 4. Fazit - Goethes Roman als Beschreibung eines Diskurswechsels
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob Goethes „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ einen Diskurswechsel im Umgang mit Melancholie und Wahnsinn beschreiben. Der Fokus liegt auf der Figur des Harfners, dessen Krankheits- und Heilungsgeschichte exemplarisch für diese Thematik steht. Die Arbeit analysiert Goethes Bezug zur europäischen Melancholietradition und zum medizinischen Diskurs des 18. Jahrhunderts.
- Goethes Auseinandersetzung mit der europäischen Melancholietradition
- Die Krankheitsgeschichte des Harfners: Entwicklung von Melancholie zum Wahnsinn
- Die Therapie des Harfners im Kontext des medizinischen Diskurses des 18. Jahrhunderts
- Der Einfluss des „moral management“ auf die Therapie des Harfners
- Goethes „Lehrjahre“ als Beschreibung eines Diskurswechsels im Umgang mit Melancholie und Wahnsinn
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach einem möglichen Diskurswechsel im Umgang mit Melancholie und Wahnsinn in Goethes „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ vor. Sie hebt die Bedeutung der Harfner-Figur hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich an der Krankheits- und Heilungsgeschichte des Harfners orientiert. Der Roman wird als ein Werk beschrieben, in dem verschiedene Figuren unter melancholischen Anfällen leiden, wobei der Harfner den Höhepunkt der Eskalation bis zum Wahnsinn darstellt, im Gegensatz zu Wilhelm, der seine Melancholie überwinden kann.
2. Melancholie und Wahnsinn - Die Krankheitsgeschichte des Harfners: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des Harfners von einem melancholischen Gemütszustand bis hin zum Wahnsinn. Es beginnt mit einer kurzen Darstellung der europäischen Melancholietradition, die von der Antike bis in die Neuzeit reicht, und beleuchtet die ambivalente Bewertung der Melancholie als Krankheit und gleichzeitig als Quelle genialer Schöpferkraft. Anschließend wird die Krankheitsgeschichte des Harfners anhand verschiedener Aspekte rekonstruiert, wobei die Symptome und möglichen Ursachen seines Wahnsinns detailliert dargestellt werden. Der Höhepunkt dieser Entwicklung ist die versuchte Opferung Felix, die als endgültige Kapitulation vor dem Wahnsinn interpretiert wird.
Schlüsselwörter
Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre, Harfner, Melancholie, Wahnsinn, Genie-Poetik, europäische Melancholietradition, medizinischer Diskurs 18. Jahrhundert, moral management, Diskurswechsel.
Häufig gestellte Fragen zu Goethes "Wilhelm Meisters Lehrjahre" - Fokus Harfner
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, ob Goethes "Wilhelm Meisters Lehrjahre" einen Diskurswechsel im Umgang mit Melancholie und Wahnsinn beschreibt. Der Fokus liegt dabei auf der Figur des Harfners und seiner Krankheits- und Heilungsgeschichte als exemplarischem Fall.
Welche Aspekte der Harfner-Figur werden analysiert?
Die Analyse umfasst Goethes Bezug zur europäischen Melancholietradition, die Krankheitsgeschichte des Harfners (Entwicklung von Melancholie zum Wahnsinn), die Therapie des Harfners im Kontext des medizinischen Diskurses des 18. Jahrhunderts, den Einfluss des "moral management" auf die Therapie und schließlich die Interpretation von Goethes "Lehrjahre" als Beschreibung eines Diskurswechsels.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Krankheitsgeschichte des Harfners, ein Kapitel zu dessen Therapie und abschließend ein Fazit. Der Aufbau orientiert sich an der Krankheits- und Heilungsgeschichte des Harfners.
Welche Rolle spielt die europäische Melancholietradition?
Die Arbeit beleuchtet Goethes Bezug zur europäischen Melancholietradition von der Antike bis in die Neuzeit und deren ambivalente Bewertung von Melancholie als Krankheit und Quelle genialer Schöpferkraft. Diese Tradition bildet den Hintergrund für das Verständnis der Harfnerschen Erkrankung.
Wie wird die Krankheitsgeschichte des Harfners dargestellt?
Das Kapitel zur Krankheitsgeschichte rekonstruiert die Entwicklung des Harfners von Melancholie zum Wahnsinn anhand verschiedener Aspekte, Symptome und möglicher Ursachen. Die versuchte Opferung Felix wird als Höhepunkt und endgültige Kapitulation vor dem Wahnsinn interpretiert.
Welche Rolle spielt das "moral management" in der Therapie des Harfners?
Die Arbeit analysiert die Therapie des Harfners im Kontext des medizinischen Diskurses des 18. Jahrhunderts und untersucht den Einfluss des "moral management" auf den Therapieverlauf. Es wird die neue Rolle des Arztes in diesem Kontext beleuchtet.
Welche zentrale Forschungsfrage wird behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet, ob Goethes Roman einen Diskurswechsel im Umgang mit Melancholie und Wahnsinn beschreibt. Die Antwort wird durch die Analyse der Harfner-Figur und ihres Werdegangs gesucht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre, Harfner, Melancholie, Wahnsinn, Genie-Poetik, europäische Melancholietradition, medizinischer Diskurs 18. Jahrhundert, moral management, Diskurswechsel.
Wie wird der Roman im Ganzen betrachtet?
Der Roman wird als ein Werk beschrieben, in dem verschiedene Figuren unter melancholischen Anfällen leiden. Der Harfner repräsentiert dabei den Höhepunkt der Eskalation bis zum Wahnsinn, im Gegensatz zu Wilhelm, der seine Melancholie überwinden kann.
- Quote paper
- Heike Esser (Author), 2006, Johann Wolfgang Goethe: "Wilhelm Meisters Lehrjahre" - Der Harfner, Diskurswechsel im Umgang mit Melancholie und Wahnsinn?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69461