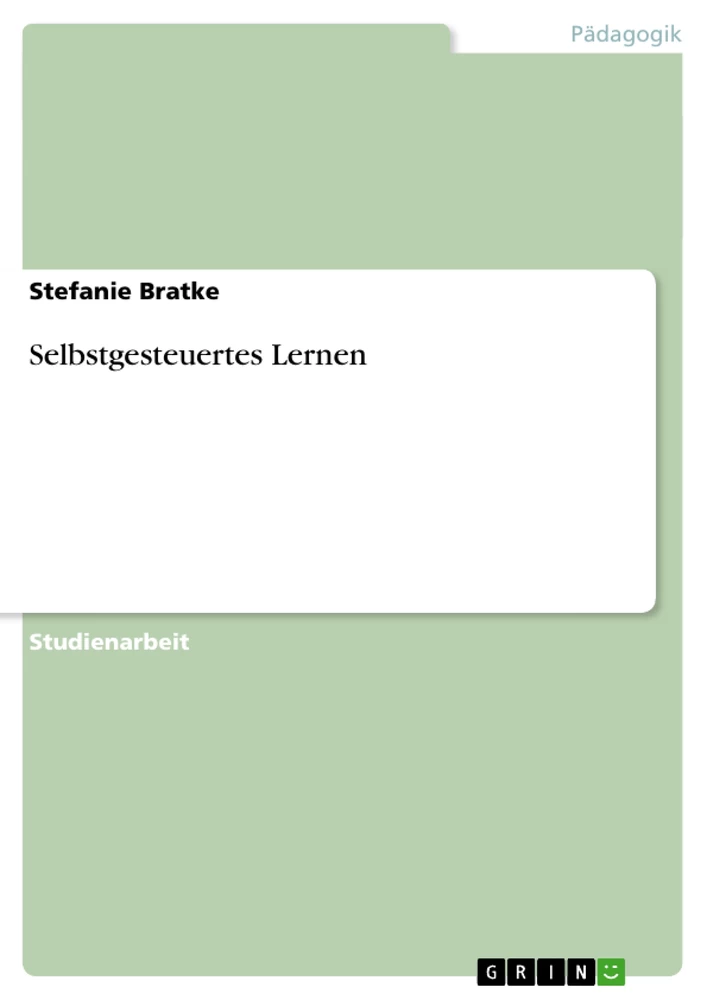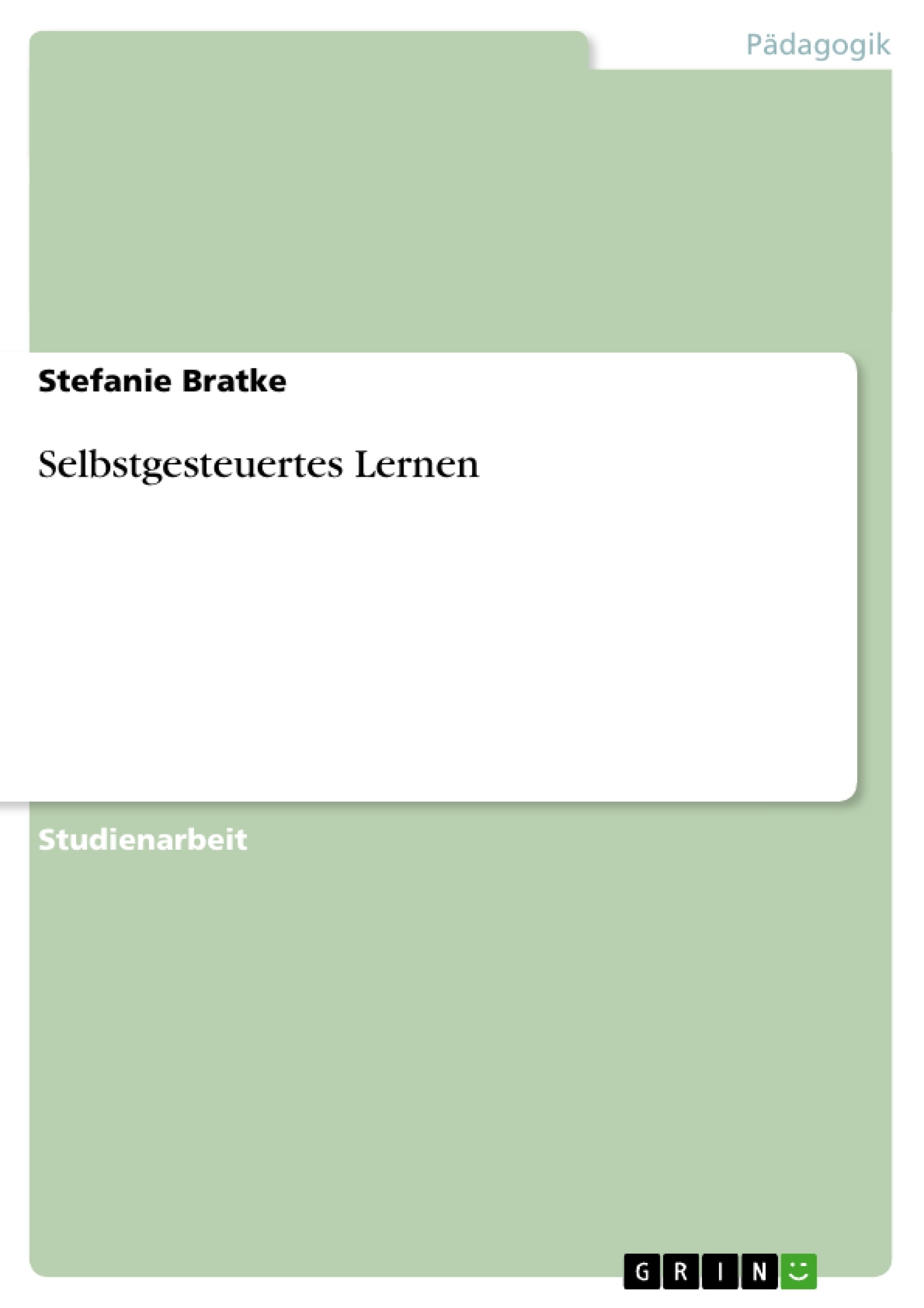Die folgende Arbeit ist eine Ausarbeitung und basiert auf dem Referat zum Thema „Selbstgesteuertes Lernen“, aus dem Seminar „Wandel der Lernkultur“. Die Basisliteratur für die Seminargestaltung und die Ausarbeitung besteht aus dem Buch Selbstgesteuertes Lernen in Theorie und Praxis von Klaus Konrad und Silke Traub.2
Die Ausarbeitung beginnt mit einer Definitionsmöglichkeit, anschließend werden die zentralen Merkmale von selbstgesteuerten Lernen aufgelistet. Nachdem nun eine Basisvorstellung geschaffen wurde, folgt eine Begründung für die Bedeutsamkeit dieser Lernform, unter anderem an Schulen. Die Umsetzungsmöglichkeiten an Schulen werden dann im weiteren Verlauf dar- und vorgestellt. Zum Abschluss werden nochmals allgemeine Grundsätze zur Förderung vom selbstgesteuerten Lernen präsentiert und als Zusatz für die praktische Anwendung, im Hinblick auf die neuen Medien, stelle ich noch das selbstgesteuerte Lernen am Computer vor.
2. Definition
Als Erstes ist festzuhalten, dass es keine einheitliche Definition von „selbstgesteuerten“ Lernen gibt.3 Deswegen werde ich mit der Begriffsklärung von Selbst beziehungsweise4 Selbstkonzept und Steuerung beginnen, um im Anschluss daran einen Definitionsversuch geben zu können.
Inhalt
1. Einleitung
2. Definition
2.1 Selbst und Selbstkonzept
2.2 Steuerung
2.3 Definitionsvorschlag
2.3.1 Konrad und Traub
2.4 Zentrale Merkmale selbstgesteuerten Lernens
3. Bedeutsamkeit selbstgesteuerten Lernens
3.1 Die vier wichtigsten Gründe
3.2 Begründungen für selbstgesteuertes Lernen in Schule
3.2.1 Bildungsplan Baden-Württemberg
4. Umsetzungsmöglichkeiten an Schulen
4.1 Unterrichtsmethoden für die Schule
4.2 Die vier Dimensionen des handlungsorientierten Unterrichts
4.3 Offener Unterricht nach Wallrabenstein
5. Allgemeine Grundsätze zur Förderung von selbstgesteuerten Lernen
6. Selbstgesteuertes Lernen am Computer
6.1 Besonderheiten beim Lernen mit dem Computer
6.2 Typen von Lernprogrammen
6.3 Einsatzformen in multimedialen Lernarrangements
6.4 Die Grenzen des Einsatzes von Lernprogrammen
6.5 Ausblick
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die folgende Arbeit ist eine Ausarbeitung und basiert auf dem Referat zum Thema „Selbstgesteuertes Lernen“, aus dem Seminar „Wandel der Lernkultur“.
Die Basisliteratur für die Seminargestaltung und die Ausarbeitung besteht aus dem Buch Selbstgesteuertes Lernen in Theorie und Praxis von Klaus Konrad und Silke Traub.[1]
Die Ausarbeitung beginnt mit einer Definitionsmöglichkeit, anschließend werden die zentralen Merkmale von selbstgesteuerten Lernen aufgelistet. Nachdem nun eine Basisvorstellung geschaffen wurde, folgt eine Begründung für die Bedeutsamkeit dieser Lernform, unter anderem an Schulen. Die Umsetzungsmöglichkeiten an Schulen werden dann im weiteren Verlauf dar- und vorgestellt. Zum Abschluss werden nochmals allgemeine Grundsätze zur Förderung vom selbstgesteuerten Lernen präsentiert und als Zusatz für die praktische Anwendung, im Hinblick auf die neuen Medien, stelle ich noch das selbstgesteuerte Lernen am Computer vor.
2. Definition
Als Erstes ist festzuhalten, dass es keine einheitliche Definition von „selbstgesteuerten“ Lernen gibt.[2] Deswegen werde ich mit der Begriffsklärung von Selbst beziehungsweise[3] Selbstkonzept und Steuerung beginnen, um im Anschluss daran einen Definitionsversuch geben zu können.
2.1 Selbst und Selbstkonzept
Alle Facetten eines Menschen bilden sein Selbst. Dieses teils unbewusste Selbst präsentiert er dann seiner Umwelt.[4] Das zum Selbst dazugehörige Selbstkonzept besteht aus kognitiven Repräsentationen der eigenen Person. Mit dem Begriff Kognition, bzw. dem hier angewendeten Adjektiv kognitiv, werden solche Prozesse und Produkte bezeichnet, die auf der Grundlage der Leistungsfähigkeit des Gehirns auf überwiegend intellektuelle, verstandesmäßige Wahrnehmungen und Erkenntnisse bezogen sind[5], wie zum Beispiel selbstbezogene Wissensbestände, Überzeugungen, Vorstellungen, Gefühle, Befindlichkeiten und Bewertungen.[6]
Diese kognitiven Repräsentationen liefern die Kriterien für die Auswahl und die Festlegung von Verhaltenszielen und für die Beurteilung von Situationen.
Alle Menschen haben ein aktives Selbstkonzept, welches sich in der Auseinandersetzung mit sozialen Erfahrungen konstituiert. Daraus folgt die Vorstellung von einem, sowohl stabilen als auch veränderlichen, eigenen Selbst.[7]
Selbstkonzepte sind dynamisch, weil Menschen stets die Gelegenheit haben Neues über die eigene Person zu lernen.[8]
Es besteht eine enge Verbindung zwischen dem Konzept der „Selbststeuerung“ und dem Konzept des „Selbstkonzeptes“, denn um sich selbst zu steuern, muss man zunächst wissen, was man selbst möchte, um schließlich auswählen und zuletzt handeln zu können.[9]
Internalisiert[10] ablaufende Prozesse der Informationsverarbeitung, die in der Verantwortung und im Rahmen der Möglichkeiten des Lernenden liegen, verlangen stets eine Beteiligung des Selbst.[11]
2.2 Steuerung
Der Begriff der Steuerung wird in dem Buch von Konrad und Traub unter anderem folgendermaßen beschrieben.
Steuerung ist die Einstellung, Erhaltung oder Veränderung der Zustände eines Systems durch externe Festlegung der Eingangsgrößen ohne Rückkopplung. Diese Definition stammt jedoch eher aus dem technischen Bereich.[12]
Der Duden 1989 versteht unter dem Begriff des Steuerns Folgendes, „sich zielstrebig in eine bestimmte Richtung bewegen“, „eine bestimmte Richtung einschlagen“ oder „für einen bestimmten Ablauf sorgen“.[13]
2.3 Definitionsvorschlag
2.3.1 Konrad und Traub
Einer der Definitionsversuche für selbstgesteuertes Lernen stammt von Klaus Konrad und Silke Traub:
Sebstgesteuertes Lernen ist eine Form des Lernens, bei der die Person in Abhängigkeit von der Art ihrer Lernmotivation selbstbestimmt eine oder mehrere Selbststeuerungsmaß- nahmen (kognitiver, volitionaler oder verhaltensmäßiger Art) ergreifen und den Fortgang des Lernprozesses selbst (metakognitiv) überwacht, reguliert und bewertet.[14]
[...]
[1] Klaus Konrad, Silke Traub: Selbstgesteuertes Lernen in Theorie und Praxis, S. 9-29, 46-51.
[2] vgl. ebd. S.
[3] Das Wort wird im Folgenden nur noch mit bzw. abgekürzt verwendet.
[4] vgl. ebd. S.9.
[5] http://de.wikipedia.org/wiki/Kognitiv Stand 29.01.2006
[6] vgl. Klaus Konrad, Silke Traub: Selbstgesteuertes Lernen in Theorie und Praxis, S.9.
[7] vgl. Klaus Konrad, Silke Traub: Selbstgesteuertes Lernen in Theorie und Praxis, S.10.
[8] vgl. ebd. S.10.
[9] vgl. ebd. S.10.
[10] Definition: Sich zu eigen machen
[11] vgl. Klaus Konrad, Silke Traub: Selbstgesteuertes Lernen in Theorie und Praxis, S.10.
[12] vgl. ebd. S.10.
[13] vgl. ebd. S.10-11.
[14] Klaus Konrad, Silke Traub: Selbstgesteuertes Lernen in Theorie und Praxis, S.13.
- Quote paper
- Stefanie Bratke (Author), 2006, Selbstgesteuertes Lernen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69323