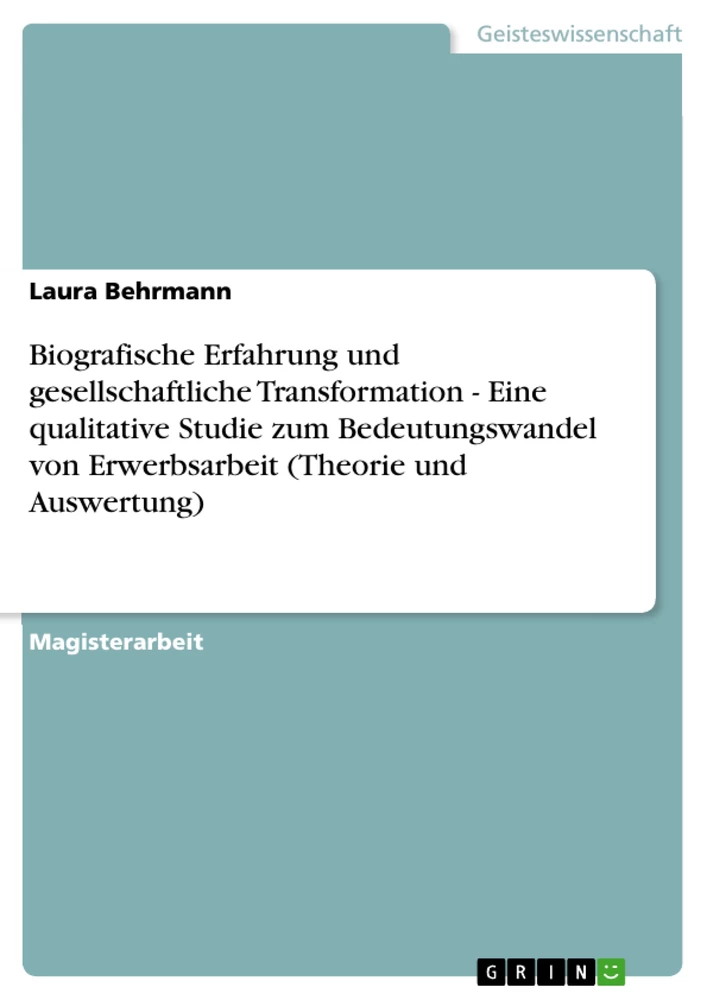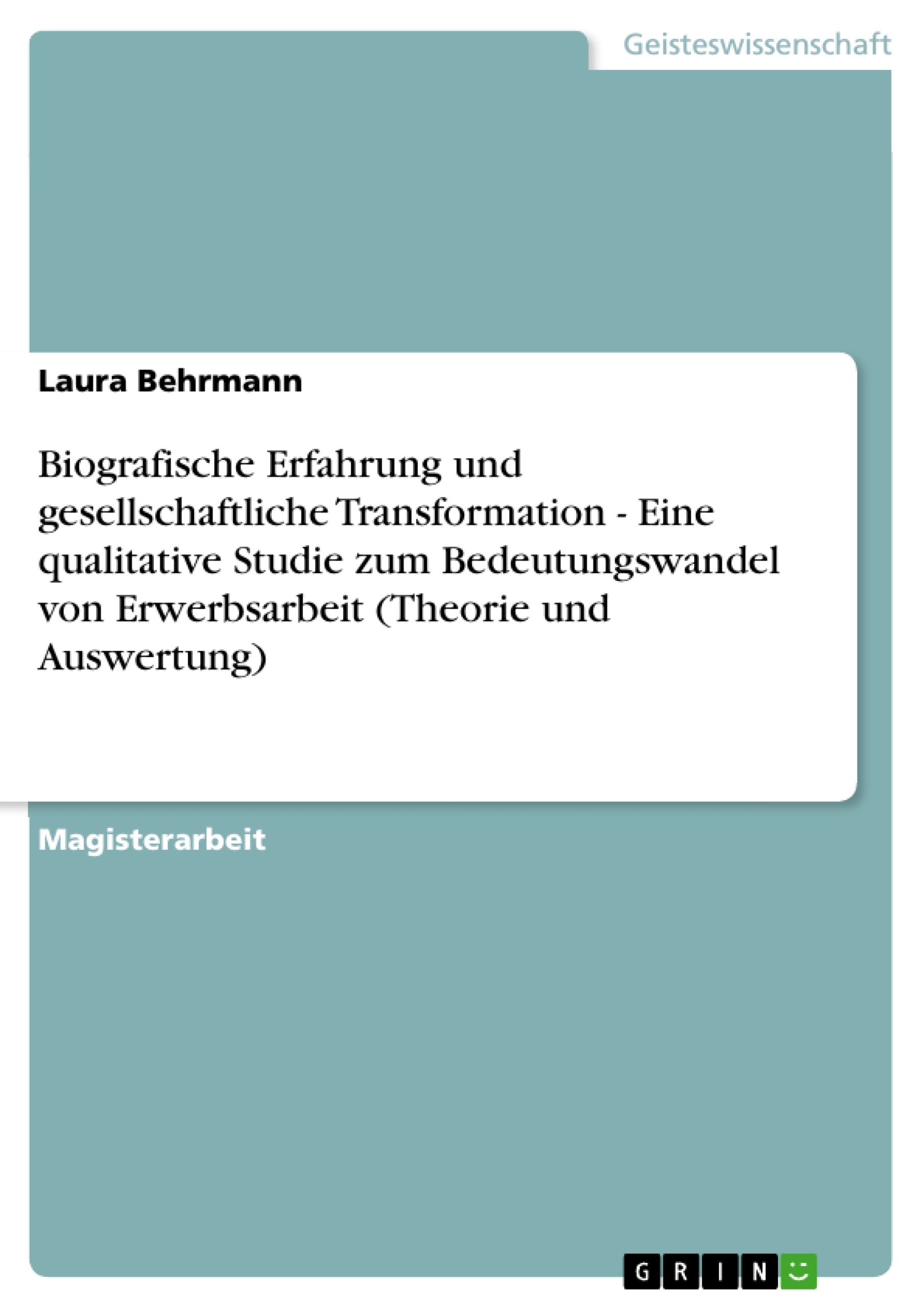Die hohe Bedeutung von Arbeit kommt in diesen Sätzen zum Ausdruck: im marxistischleninistischen Wörterbuch aus der Systemperspektive, in den subjektiven Aussagen der ehemaligen DDR-Bürger und Ostdeutschen aus ihrer lebensweltlichen Erfahrung. Der hohe Wert von Arbeit stand auch jenseits der Beschwörungen von Arbeiterklasse, Arbeitskollektiv und Arbeitsmoral lange außer Frage. Die Vollbeschäftigung und deren dauerhafte Sicherung waren
Hauptziel der Politik in den ‚kapitalistischen’ und den ‚sozialistischen’ Staaten. Wenn auch mit unterschiedlichen Mitteln wurden in allen ‚Industriegesellschaften’ Formen der Produktion und Arbeitsorganisation durchgesetzt. Allen gemeinsam war das Ziel, durch ständige Steigerung der Arbeitsproduktivität ein dauerhaftes Wachstum zu schaffen. Dieses sollte allgemeinen Wohlstand schaffen und soziale Sicherung ermöglichen. In den industriegesellschaftlichen Arbeits- und Lebensweisen schien sich eine ‚Konvergenz’ abzuzeichnen. Das war eine Idee, die in der und durch die sozialwissenschaftliche Literatur Verbreitung fand. In der Realität verlor sie mit dem Ölpreisschock in den 70er Jahren an Gültigkeit. Höchst unterschiedliche Bedingungen zeichneten sich ab: Statt der Vollbeschäftigung wurde in vielen westlichen Staaten, so auch in der Bundesrepublik, strukturelle Arbeitslosigkeit zum Dauerzustand. Dahrendorf konstatierte das „Entschwinden der Arbeitsgesellschaft“, und die Deutsche Gesellschaft für Soziologie diagnostizierte 1982 die „Krise der Erwerbsgesellschaft“. Themen, die seitdem Dauerbrenner der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Literatur sind. Die sozialistischen Gesellschaften gerieten darüber in Vergessenheit. Zwar herrschte dort weiterhin Vollbeschäftigung, von einer Systemkonkurrenz, die in den 60er Jahren noch in Aussicht gestellt wurde, konnte man aber nicht mehr sprechen: Große und wachsende Rückstände in der wirtschaftlichen Produktivität gingen einher mit einer abnehmenden Qualität der Konsumgüter und Versorgungsproblemen. So begegneten sich, als sich 1989 die Grenzen öffneten, zwei Gesellschaften. Sie wussten nur noch wenig voneinander, und ihre Lebensweisen unterschieden sich dort beträchtlich wo man glaubte, sich nahe zu stehen: Im Alltag industriegesellschaftlicher Erwerbsarbeit. Missverständnisse häuften sich und die mit der ‚Wende’ geweckten Erwartungen wurden –vor allem auf dem Arbeitsmarkt – herbe enttäuscht. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Ansatzpunkte
- ,Arbeit in den Systemen
- ,Arbeit' in Narrationen
- Fragen und Interessen
- Forschungsstand
- ,Arbeit und ,Biografie' – Begriffliche Orientierungen
- Bedeutungsgehalt von Arbeit
- Arbeit als wesentliches Moment der Daseinserfüllung
- Vergesellschaftungsfunktionen der Arbeit
- Eingrenzung des Begriffs ,Beruf'
- ,Biografie' im Wandel
- Bedeutungsgehalt von Arbeit
- Die Arbeitsgesellschaft DDR
- Die Arbeitswelt der DDR
- Das DDR-Erwerbssystem
- Institutionelle Vorrausetzungen des Erwerbslebens
- Der Betrieb als Zentrum der Arbeitsgesellschaft
- ,,Das spezifische Zeit- und Sozialregime“
- Verhaltene Freizeit
- ,,Einheit\" Familie
- Vorherbestimmte Bahnen?
- Die Arbeitswelt der DDR
- ,,Der beschleunigte Wandel“
- Ein historisches Ereignis und seine Auswirkungen
- Transformation
- Der Wandel unter der Lupe
- Der Wandel am Arbeitsplatz
- Der Wechsel des Berufs
- Der Ausschluss aus dem Erwerbsleben
- Ein Überblick zum Arbeitsmarkt 1989 bis 1994
- Die Familie als Lückenbüßer?
- Die Ostdeutschen im vereinigten Deutschland
- Der Wandel geht weiter
- Der Arbeitsmarkt nach 1994
- Problemgruppen des Arbeitsmarktes
- Der Untersuchungsort Potsdam
- Die Sozialstruktur
- Auf der Suche nach neuen Formen der sozialen Einbindung
- ,,Ostdeutsche Identität“?
- Die Situation am Arbeitsplatz und in der Freizeit
- Familie als Netzwerk
- Jugend in Ostdeutschland
- Bildung nach der Vereinigung
- Das Themenfeld der Untersuchung
- Subjektives Erfahren der Arbeitswelten
- Methodische Überlegungen
- Vorzüge der qualitativen Methode
- Das Erhebungsinstrument: narratives Interview mit Leitfaden
- Der Leitfaden
- Der Aufbau des Leitfadens
- Die Erprobung des Leitfadens
- Der Einsatz des Leitfadens im Interview
- Feldzugang
- Die Gesprächssituation
- Die Auswertung
- Schwierigkeiten und Fazit
- Regelmäßigkeiten und Besonderheiten
- Eine erste Abstraktion
- Erwerbslaufbahn und Arbeitslosigkeitserfahrung
- Die Erwachsenen vor und nach der Wende
- Die jungen Erwachsenen nach der Wende
- Arbeitsmarktverhalten und Chancenbewertung auf dem Arbeitsmarkt
- Soziale Einbindung und Alltagsgestaltung
- Familie und Partnerschaft
- Freunde und Kollegen
- Thematisierung des Geschlecht
- Freizeitverhalten
- Bindung an die Heimat
- Selbst- und Gesellschaftsbild
- Das,,Spiel“ zwischen den Erwachsenen und jungen Erwachsenen
- Typisierung von Arbeit
- Eine zweite Abstraktion: Typenbildung
- Typ 1: Arbeiten mit Gemeinschaft
- Die Funktion des Typs in der DDR-Gesellschaft
- Das Arbeitsverhalten im Wandel
- Das Leiden des Typs in der Moderne
- Zusammenfassende Beschreibung des Typs
- Typ 2: Arbeiten als Tätigsein
- Die Funktion des Typs in der Moderne
- Das Arbeitsverhalten
- Das Leiden des Typs an der Arbeit
- Zusammenfassende Darstellung und Aussichten
- Typ 3: Arbeiten gegen Lohn
- Die Beschreibung des Typs
- Die Funktion von Arbeit
- Das Arbeitsverhalten
- Das Leiden an der Arbeit
- Zusammenfassende Darstellung
- Die Typen im Wandel
- Typen von Arbeit und Gesellschaftssysteme
- Typen und die Arbeitsgesellschaft
- Die Typen und das „Ende der Arbeitsgesellschaft“
- Wie,,Avantgardistisch“ sind diese Typen?
- Arbeit in der Erwerbsbiografie neu denken
- Ein vorläufiger Abschluss
- Literaturverzeichnis
- Tabellen
- Tabelle 1 ,,Merkmale der Interviewten“
- Tabelle 2 ,,Typen des Arbeitens“
- Abkürzungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Bedeutungswandel von Erwerbsarbeit im Kontext gesellschaftlicher Transformation. Der Fokus liegt auf der subjektiven Erfahrung von Arbeit in der ehemaligen DDR und im vereinigten Deutschland. Die qualitative Studie analysiert, wie sich die Arbeitsbiografien von Ostdeutschen durch die Wende und die darauffolgende Transformation verändert haben.
- Die Bedeutung von Arbeit im Lebenslauf von Menschen in der ehemaligen DDR
- Die Auswirkungen der gesellschaftlichen Transformation auf die Arbeitswelt in Ostdeutschland
- Der Wandel von Arbeitserfahrungen und Berufsbiografien
- Die Herausforderungen der Arbeitsmarktintegration nach der Wende
- Subjektive Erfahrungen von Arbeit, Identität und sozialer Einbindung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Hausarbeit beginnt mit einer Definition des Begriffs ,Arbeit' und seiner Bedeutung für die Lebensgestaltung. Sie untersucht die institutionellen Rahmenbedingungen und Arbeitsstrukturen in der DDR und analysiert die Auswirkungen der Wende auf die Arbeitswelt in Ostdeutschland.
Die Untersuchung analysiert die subjektiven Erfahrungen von Arbeit in der Erwerbsbiografie anhand von narrativen Interviews. Sie untersucht, wie sich die Arbeitswelt für Ostdeutsche nach der Wende verändert hat, welche Herausforderungen und Chancen sich für sie ergeben haben und wie sie mit der neuen Situation umgehen.
Die Arbeit betrachtet auch die Rolle der Familie und der sozialen Einbindung in der Lebensgestaltung von Ostdeutschen im vereinigten Deutschland. Sie analysiert, wie sich die Lebensumstände, die Arbeitsbedingungen und die sozialen Beziehungen von Ostdeutschen nach der Wende verändert haben.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Arbeit und der Biographie im Kontext der gesellschaftlichen Transformation in Ostdeutschland. Die Untersuchung befasst sich mit Begriffen wie Arbeitsgesellschaft, Erwerbsbiografie, Transformation, Arbeitsmarktintegration, Identität und soziale Einbindung.
- Quote paper
- M.A. Laura Behrmann (Author), 2006, Biografische Erfahrung und gesellschaftliche Transformation - Eine qualitative Studie zum Bedeutungswandel von Erwerbsarbeit (Theorie und Auswertung), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69226