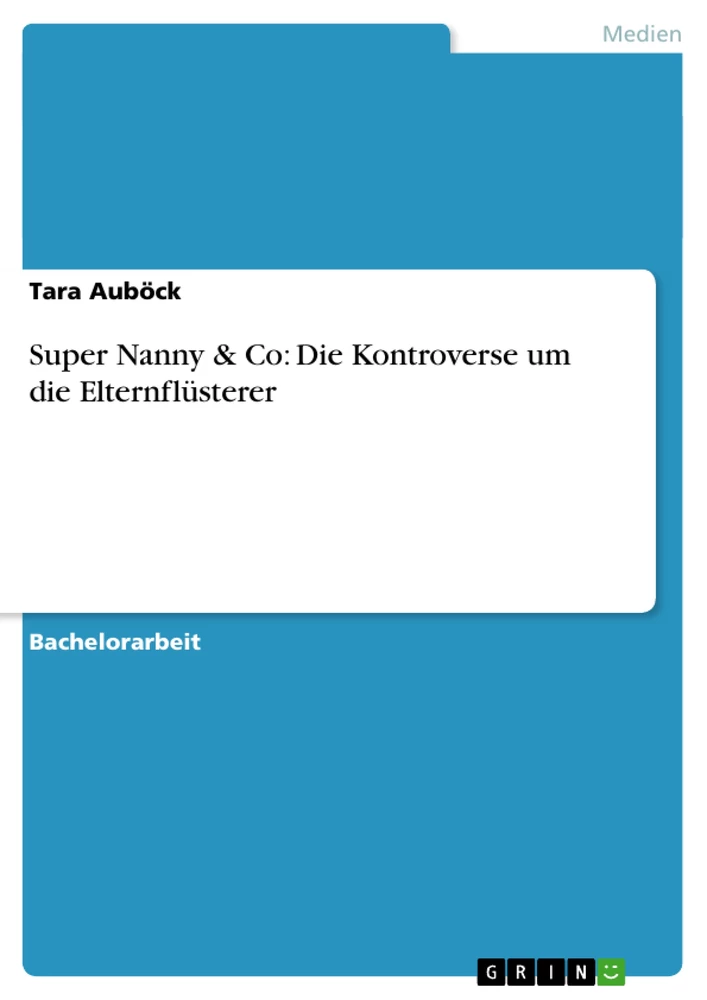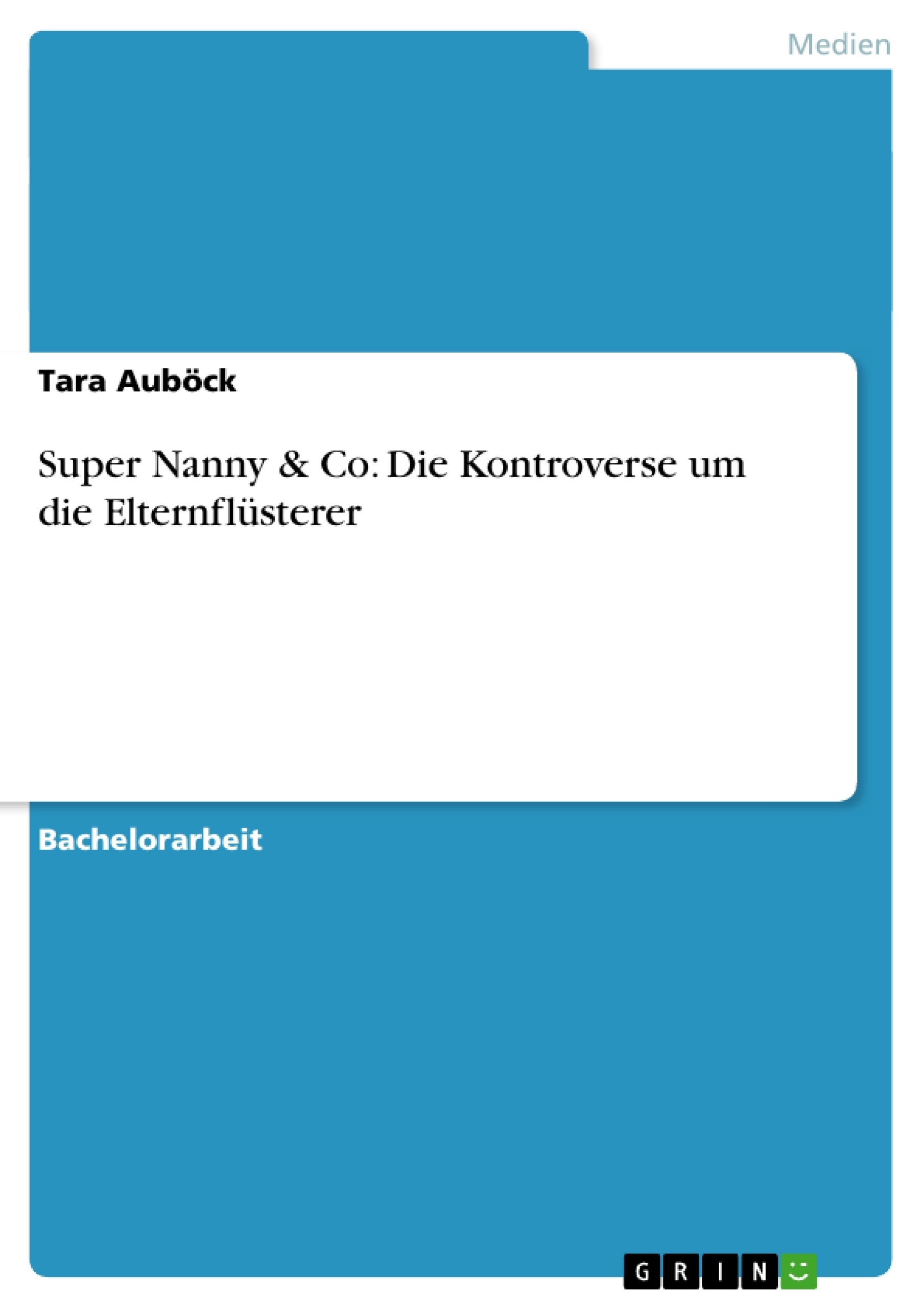Seit Herbst 2004 verzeichnen Sendungen wie „Die Super Nanny“ (RTL) und „Die Supermamas“ (RTL2) in welchen Diplompädagoginnen und -psychologinnen Familien in Erziehungsfragen unterstützen, exorbitante Quotenerfolge.
Die Sendungen treffen einen Nerv: Sie lassen uns an Dramen teilhaben, die sich in manchen Familien abspielen und zeigen, wie Eltern bisweilen mit der Kindererziehung überfordert sind. Für diesen Impetus sollte man diesen Sendungen durchaus dankbar sein: War es nicht längst an der Zeit, darüber nachzudenken, wie kompetent die Eltern unserer Zeit für die Kindererziehung sind? Die PISA – Studien haben ja nicht nur die Mängel in unserem Schul- und Bildungssystem aufgedeckt sondern auch dargelegt, wie stark Eltern die schulischen (Miss-)erfolge ihrer Kinder beeinflussen. Die Wissenschaften zeigen, dass gerade die ersten Lebensjahre eines Kindes in der Familie darüber entscheiden, wie es sich weiterentwickeln wird.
Deutlich zu erkennen ist ein Unterschied der gegebenen Ratschläge im jeweiligen Herkunftsland, so wird in Großbritannien viel mehr Wert auf Strenge und Respekt den Erziehenden gegenüber gelegt, in Deutschland dafür die typisch deutsche „Gründlichkeit“ hochgehalten und in Österreich bei den Super Nannys Velasquez und Edinger zwar das Thema des „Grenzen Setzens“ angesprochen, wichtig hier aber auch das „miteinander“ und nicht „gegeneinander“ von Eltern und Kindern.
Kinder haben von Anfang an eine eigene Persönlichkeit und sind somit menschlich und sozial kompetente Partner ihrer Eltern, so müssen also auch die Eltern lernen, das Verhalten ihrer Kinder in Botschaften zu übersetzen.
Denn wie Experten im Gleichklang mit den Super Nannys feststellt: Erziehung ist ein Entwicklungsprozess – für die Eltern ebenso wie für die Kinder.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsfragen
- Hypothesen
- Ideale Erziehungsmethoden
- Ausgangssituation in den Familien
- Desperate Parents? Erschwerende Erziehungsfaktoren
- Voraussetzungen medialer Erziehungsberatung
- Kritik am „Super Nanny“ – Format
- Erziehungsberatung via Fernsehen – Warum die „Super Nanny“ kein Weg ist
- Mögliche Folgen von Sendungsformaten wie „Super Nanny“
- „Super Nanny“ im Kontext moderner Erziehung
- Familienregeln
- Ambulante Familien-&Erziehungshilfen und Beratung durch Fernsehsendungen im Vergleich
- Familienberatung im Kontext der medialen Präsentation
- Schnelligkeit von Veränderung-Nachhaltigkeit von Veränderung
- Konzept Eltern – Coaching
- Experteninterview Sabine Edinger
- Experteninterview Sandra Velásquez
- Experteninterview Brigitte Goldmann
- Fazit & Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Fernsehsendung „Super Nanny“ und ähnliche Formate im Kontext moderner Erziehung. Ziel ist es, den propagierten Erziehungsstil zu analysieren, die Ausgangssituation der Familien zu beleuchten und die Effektivität sowie die potenziellen Risiken dieser Art von medialer Erziehungsberatung zu bewerten.
- Analyse des in „Super Nanny“ propagierten Erziehungsstils im Vergleich zu anderen Ansätzen.
- Untersuchung der Herausforderungen, denen Eltern in der heutigen Gesellschaft gegenüberstehen.
- Bewertung der Effektivität und der potenziellen negativen Folgen von medialer Erziehungsberatung.
- Vergleich der Ansätze verschiedener Länder (Großbritannien, Deutschland, Österreich).
- Einbezug alternativer Erziehungsmethoden (z.B. Waldorf-Pädagogik).
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und begründet die Arbeit anhand von Zitaten der österreichischen „Super Nannys“ und der hohen Einschaltquoten der Sendungen. Sie stellt die zentralen Forschungsfragen und die Relevanz des Themas im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion um Erziehungsfragen heraus.
Forschungsfragen: Dieses Kapitel formuliert die zentralen Forschungsfragen der Arbeit. Es wird untersucht, wie sich der in den Sendungen propagierte Erziehungsstil von anderen unterscheidet, welche Ausgangssituationen die Familien aufweisen und welche Faktoren die Erziehung erschweren. Ein weiterer Fokus liegt auf der Analyse der Erwartungen des Publikums an das Format und der tatsächlichen Motivation der Zuschauer, solche Sendungen zu verfolgen. Die Interviews mit den „Super Nannys“ und einer Waldorf-Pädagogin werden als Methode zur Klärung der Forschungsfragen vorgestellt.
Hypothesen: (Anmerkung: Der bereitgestellte Text enthält keine explizite Formulierung von Hypothesen. Diese Zusammenfassung würde also im fertigen Dokument durch eine Beschreibung der im Text implizierten oder abgeleiteten Hypothesen ersetzt werden müssen.)
Ideale Erziehungsmethoden: (Anmerkung: Der bereitgestellte Text bietet zu diesem Kapitel keine Informationen. Diese Zusammenfassung muss entsprechend ergänzt werden.)
Ausgangssituation in den Familien: (Anmerkung: Der bereitgestellte Text bietet zu diesem Kapitel keine Informationen. Diese Zusammenfassung muss entsprechend ergänzt werden.)
Desperate Parents? Erschwerende Erziehungsfaktoren: (Anmerkung: Der bereitgestellte Text bietet zu diesem Kapitel keine Informationen. Diese Zusammenfassung muss entsprechend ergänzt werden.)
Voraussetzungen medialer Erziehungsberatung: (Anmerkung: Der bereitgestellte Text bietet zu diesem Kapitel keine Informationen. Diese Zusammenfassung muss entsprechend ergänzt werden.)
Kritik am „Super Nanny“ – Format: Dieses Kapitel analysiert die Kritik an dem „Super Nanny“-Format, die sowohl vom Deutschen Kinderschutzbund als auch von den Kinderfreunden Österreichs geäußert wird. Die Kritikpunkte zielen auf die potenzielle Degradierung von Kindern zu Objekten der Unterhaltung und die zweifelhafte Qualität der Ratschläge aufgrund der fehlenden Berücksichtigung der Einzigartigkeit jeder Familie. Der Beitrag erwähnt auch eine Sendung über den Verlust der Kindheit als exemplarischen Medienbericht über mangelnde Erziehungskompetenz heutiger Eltern und betont die Notwendigkeit, die Wahrnehmung der Rezipienten hinsichtlich der Wirkung der Sendungen zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Super Nanny, mediale Erziehungsberatung, Erziehungsstil, Familienprobleme, Elternkompetenz, Kinderschutz, Waldorf-Pädagogik, Fernsehen, Erziehungsfragen, Sozialisation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Analyse des Fernsehformats „Super Nanny“
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit analysiert das Fernsehformat „Super Nanny“ und ähnliche Sendungen im Kontext moderner Erziehung. Sie untersucht den propagierten Erziehungsstil, die Ausgangssituation der Familien, die Effektivität und die potenziellen Risiken dieser Form der medialen Erziehungsberatung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Analyse des in „Super Nanny“ propagierten Erziehungsstils im Vergleich zu anderen Ansätzen, Untersuchung der Herausforderungen für Eltern in der heutigen Gesellschaft, Bewertung der Effektivität und potenzieller negativer Folgen medialer Erziehungsberatung, Vergleich der Ansätze verschiedener Länder (Großbritannien, Deutschland, Österreich) und Einbezug alternativer Erziehungsmethoden (z.B. Waldorf-Pädagogik).
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Die Arbeit untersucht, wie sich der in den Sendungen propagierte Erziehungsstil von anderen unterscheidet, welche Ausgangssituationen die Familien aufweisen und welche Faktoren die Erziehung erschweren. Ein weiterer Fokus liegt auf der Analyse der Erwartungen des Publikums und der Motivation der Zuschauer, solche Sendungen zu verfolgen.
Wie werden die Forschungsfragen untersucht?
Die Arbeit nutzt Interviews mit den „Super Nannys“ und einer Waldorf-Pädagogin als Methode zur Klärung der Forschungsfragen. Zusätzlich wird die Kritik am Format „Super Nanny“ analysiert, unter anderem aus der Sicht des Deutschen Kinderschutzbundes und der Kinderfreunde Österreichs.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Forschungsfragen, Hypothesen, idealen Erziehungsmethoden, Ausgangssituation in den Familien, erschwerenden Erziehungsfaktoren, Voraussetzungen medialer Erziehungsberatung, Kritik am „Super Nanny“-Format, Erziehungsberatung via Fernsehen, möglichen Folgen von Sendungsformaten wie „Super Nanny“, „Super Nanny“ im Kontext moderner Erziehung, Familienregeln, Vergleich ambulanter Familien-&Erziehungshilfen und Fernsehsendungen, Familienberatung im Kontext medialer Präsentation, Schnelligkeit und Nachhaltigkeit von Veränderung, Eltern-Coaching und Experteninterviews (Sabine Edinger, Sandra Velásquez, Brigitte Goldmann), sowie Fazit und Nachwort.
Welche Kritikpunkte am „Super Nanny“-Format werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert Kritikpunkte wie die potenzielle Degradierung von Kindern zu Objekten der Unterhaltung und die zweifelhafte Qualität der Ratschläge aufgrund der fehlenden Berücksichtigung der Einzigartigkeit jeder Familie. Die Notwendigkeit, die Wahrnehmung der Rezipienten hinsichtlich der Wirkung der Sendungen zu untersuchen, wird ebenfalls betont.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Super Nanny, mediale Erziehungsberatung, Erziehungsstil, Familienprobleme, Elternkompetenz, Kinderschutz, Waldorf-Pädagogik, Fernsehen, Erziehungsfragen, Sozialisation.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die bereitgestellte HTML-Datei enthält eine Zusammenfassung der Einleitung und des Kapitels zur Kritik am „Super Nanny“-Format. Die Zusammenfassungen der anderen Kapitel sind jedoch unvollständig und müssen ergänzt werden.
Wo finde ich mehr Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die vollständigen Informationen zu den einzelnen Kapiteln sind im vollständigen Dokument der Arbeit enthalten, das über den ursprünglichen Quelle bezogen werden kann.
- Quote paper
- Tara Auböck (Author), 2007, Super Nanny & Co: Die Kontroverse um die Elternflüsterer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69207