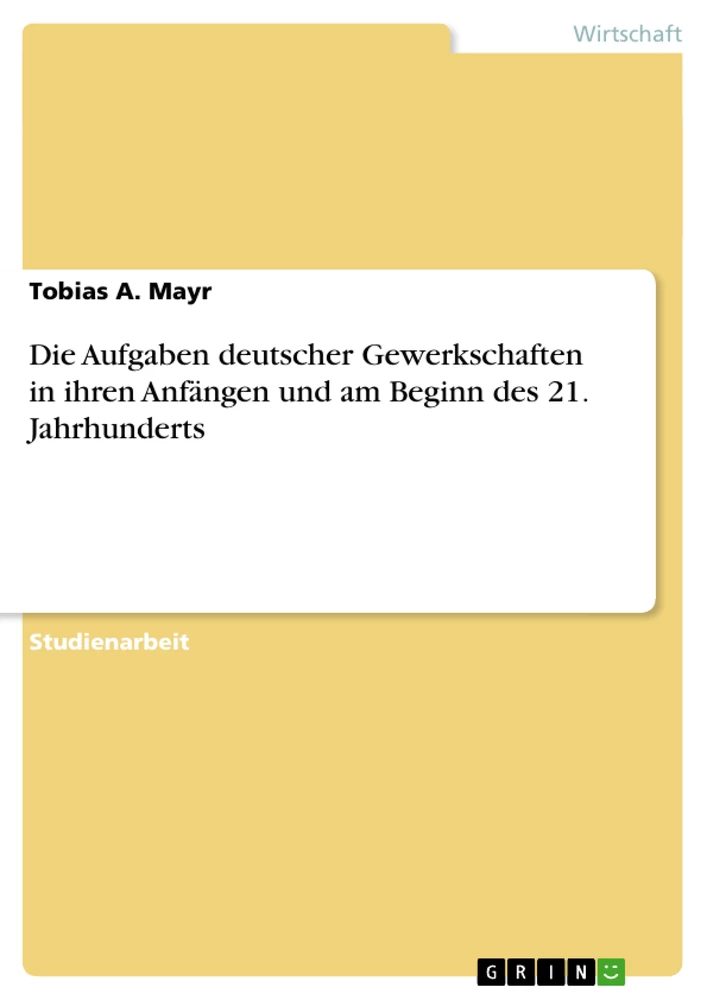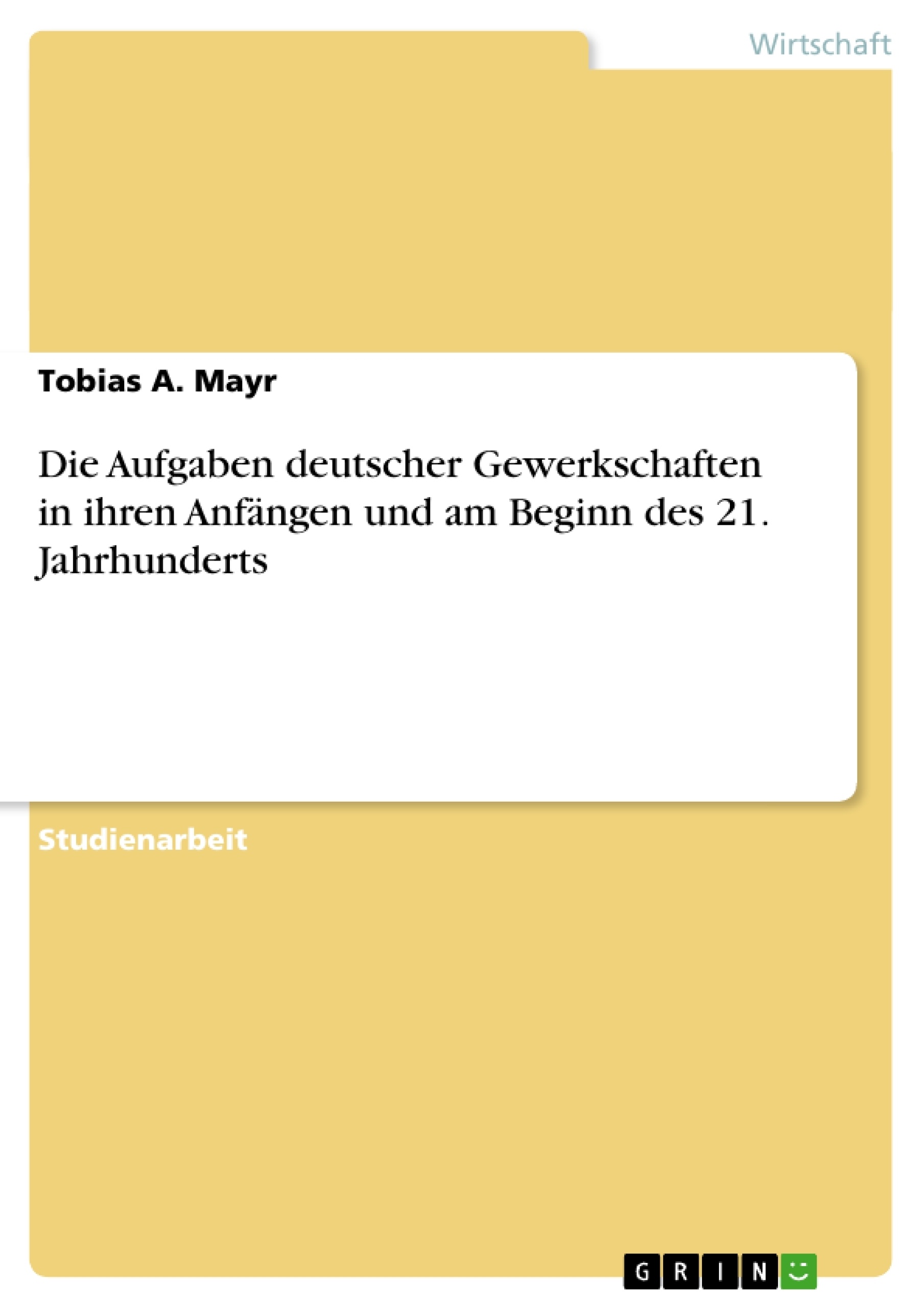1. Einleitung
Die Wirtschaft in Deutschland unterliegt seit Jahren einem starken Wandel. Besonders seit Beginn der 1980er Jahre nimmt die Globalisierung zu und wirkt sich auf die Standortbedingungen in Deutschland aus. Während sich die Wirtschaft internationalisiert hat und sich der Standort Deutschland mit anderen Produktionsstandorten in Europa und der Welt vergleichen lassen muss, scheint sich bei den deutschen Gewerkschaften kein Wandel hinsichtlich ihrer Ideologie und der Arbeitsweise vollzogen zu haben. In den Anfangsjahren der Gewerkschaftsbewegung war steter Wandel eine Kernbedingung um bestehen zu können, auch die Übernahme sozialer Aufgaben durch den Staat konnten diese überstehen.
Die Gewerkschaften befinden sich in einer Krise, verlieren zunehmend das Vertrauen ihrer Mitglieder und Rückhalt in der Gesellschaft. Die Standortfrage der Unternehmen und Massenarbeitslosigkeit in Deutschland engen den Spielraum der Gewerkschaften weiter ein. Die Aufgaben der Gewerkschaften haben sich im Lauf der Geschichte ge-wandelt und sind immer konkret von den Kontextfaktoren in der Gesellschaft und Wirtschaft abhängig.
Die Bildung der Gewerkschaften lässt sich nicht ohne eine Betrachtung der Kontextsituation erklären. Also ist eine Beschreibung der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Situation in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hilfreich, um die Gründe für das Zustandekommen von Gewerkschaften und deren Aufgaben zu verstehen.
Die Aufgaben der Gewerkschaften leiten sich aus diesen Kontextfaktoren ab und erklären die Bildung und den schwierigen Aufstieg der Gewerkschaften zu den heutigen Institutionen. Hierbei müssen die Aufgaben der Gewerkschaft stets einer Anpassung an die wirtschaftliche, politische und soziale Situation unterliegen, um bestehende Mitglieder halten zu können und neue Mitglieder hinzuzugewinnen. Mit dem Thema der Mitgliedschaft bei Gewerkschaften hat sich Mancur Olson in seinem Buch „Die Logik kollektiven Handelns“ auf knapp 30 Seiten beschäftigt und die Gruppengröße sowie Anreizbildung als Determinanten des Erfolges von Gewerkschaften genannt.
Daher soll die Bewertung der Aufgaben der Gewerkschaften unter Berücksichtigung von Olsons Theorie erfolgen und insbesondere die Aspekte der Kollektivgüter, der selektiven Anreize und der Freerider Problematik betrachtet werden. Hierfür wird kurz Olsons Logik kollektiven Handelns vorgestellt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mancur Olsons Logik kollektiven Handelns
- Anfänge der Gewerkschaften
- Kontextsituation
- Aufgaben
- Bewertung
- Gewerkschaften am Beginn des 21. Jahrhunderts
- Kontextsituation
- Aufgaben
- Bewertung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und die Aufgaben deutscher Gewerkschaften, von ihren Anfängen bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts. Sie analysiert den Wandel der kontextuellen Rahmenbedingungen und deren Einfluss auf die gewerkschaftlichen Aufgaben. Dabei wird auch die Theorie von Mancur Olson zum kollektiven Handeln herangezogen.
- Wandel der Aufgaben deutscher Gewerkschaften im Zeitverlauf
- Einfluss wirtschaftlicher, politischer und sozialer Kontextfaktoren
- Anwendbarkeit der Theorie von Mancur Olson auf die Entwicklung der Gewerkschaften
- Herausforderungen für Gewerkschaften im Kontext von Globalisierung und Arbeitslosigkeit
- Die Rolle von kollektiven Gütern und selektiven Anreizen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den starken Wandel der deutschen Wirtschaft, insbesondere seit den 1980er Jahren durch die Globalisierung. Sie stellt die These auf, dass die deutschen Gewerkschaften im Gegensatz zur Wirtschaft keinen vergleichbaren Wandel in Ideologie und Arbeitsweise vollzogen haben und sich in einer Krise befinden. Die Arbeit untersucht die Aufgaben der Gewerkschaften im historischen Kontext und beleuchtet deren Abhängigkeit von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Faktoren. Die Notwendigkeit der Anpassung an veränderte Bedingungen, um Mitglieder zu gewinnen und zu halten, wird hervorgehoben.
Mancur Olsons Logik kollektiven Handelns: Dieses Kapitel präsentiert die Theorie von Mancur Olson zur Logik des kollektiven Handelns. Olson widerlegt die Annahme, dass größere Gruppen automatisch handlungsfähiger sind und kollektive Güter effizienter bereitstellen. Er betont den Einfluss der Gruppengröße auf die Bereitschaft zur Mitwirkung und die Problematik von Trittbrettfahrern (Freerider). Die Bedeutung von selektiven Anreizen zur Überwindung des Freerider-Problems in großen Gruppen wird herausgestellt, ebenso wie der Unterschied zwischen kleinen und großen Gruppen hinsichtlich Transparenz und Sanktionsmöglichkeiten. Die Theorie bildet die Grundlage für die spätere Bewertung der Gewerkschaftsaufgaben.
Anfänge der Gewerkschaften: Dieses Kapitel beschreibt die Kontextsituation der Gewerkschaftsbildung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, indem es die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Bedingungen analysiert. Die daraus abgeleiteten Aufgaben der Gewerkschaften werden erläutert, und die Schwierigkeiten beim Aufstieg zu den heutigen Institutionen werden beleuchtet. Die Zusammenfassung unterstreicht die Notwendigkeit der Anpassung gewerkschaftlicher Aufgaben an die jeweilige gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation.
Gewerkschaften am Beginn des 21. Jahrhunderts: Das Kapitel analysiert die Kontextsituation der Gewerkschaften zu Beginn des 21. Jahrhunderts, wobei die Herausforderungen durch Globalisierung, Standortkonkurrenz und Arbeitslosigkeit im Fokus stehen. Es untersucht die veränderten Aufgaben der Gewerkschaften und wertet die Situation anhand der zuvor vorgestellten Theorie von Mancur Olson aus, unter Berücksichtigung der Problematik von kollektiven Gütern und selektiven Anreizen.
Schlüsselwörter
Deutsche Gewerkschaften, Kollektives Handeln, Mancur Olson, Globalisierung, Arbeitsmarkt, Standortkonkurrenz, Kollektivgüter, Selektive Anreize, Freerider-Problem, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Gewerkschaftskrise.
FAQ: Entwicklung und Aufgaben deutscher Gewerkschaften
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und Aufgaben deutscher Gewerkschaften von ihren Anfängen bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts. Sie analysiert den Wandel der kontextuellen Rahmenbedingungen und deren Einfluss auf die gewerkschaftlichen Aufgaben im Lichte der Theorie von Mancur Olson zum kollektiven Handeln.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den Wandel der Aufgaben deutscher Gewerkschaften im Zeitverlauf, den Einfluss wirtschaftlicher, politischer und sozialer Kontextfaktoren, die Anwendbarkeit der Theorie von Mancur Olson, die Herausforderungen durch Globalisierung und Arbeitslosigkeit sowie die Rolle von kollektiven Gütern und selektiven Anreizen.
Welche Theorie wird angewendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Mancur Olsons Theorie des kollektiven Handelns. Diese Theorie untersucht die Problematik der Bereitstellung kollektiver Güter und den Einfluss von Gruppengröße, Trittbrettfahrern (Freeridern) und selektiven Anreizen auf die Handlungsfähigkeit von Gruppen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Mancur Olsons Theorie, Kapitel zu den Anfängen der Gewerkschaften und zu den Gewerkschaften am Beginn des 21. Jahrhunderts sowie ein Fazit. Jedes Kapitel analysiert die jeweilige Kontextsituation, die Aufgaben der Gewerkschaften und deren Bewertung.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt den starken Wandel der deutschen Wirtschaft seit den 1980er Jahren und stellt die These auf, dass die deutschen Gewerkschaften im Gegensatz dazu keinen vergleichbaren Wandel vollzogen haben und sich in einer Krise befinden. Die Notwendigkeit der Anpassung an veränderte Bedingungen wird hervorgehoben.
Was ist der Inhalt des Kapitels zu Mancur Olson?
Dieses Kapitel präsentiert Olsons Theorie des kollektiven Handelns, die die Problematik von Trittbrettfahrern und die Bedeutung selektiver Anreize zur Überwindung dieses Problems in großen Gruppen erläutert. Der Unterschied zwischen kleinen und großen Gruppen hinsichtlich Transparenz und Sanktionsmöglichkeiten wird ebenfalls behandelt.
Was wird in den Kapiteln zu den Anfängen und zum Beginn des 21. Jahrhunderts behandelt?
Diese Kapitel analysieren die jeweiligen Kontextsituationen (wirtschaftlich, politisch, sozial), die daraus resultierenden Aufgaben der Gewerkschaften und bewerten diese im Lichte der Theorie von Mancur Olson. Das Kapitel zum Beginn des 21. Jahrhunderts fokussiert auf die Herausforderungen durch Globalisierung, Standortkonkurrenz und Arbeitslosigkeit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter umfassen: Deutsche Gewerkschaften, Kollektives Handeln, Mancur Olson, Globalisierung, Arbeitsmarkt, Standortkonkurrenz, Kollektivgüter, Selektive Anreize, Freerider-Problem, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Gewerkschaftskrise.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die deutschen Gewerkschaften aufgrund mangelnder Anpassung an den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel vor großen Herausforderungen stehen. Die Theorie von Mancur Olson liefert ein hilfreiches analytisches Werkzeug zur Bewertung der Situation.
- Quote paper
- Tobias A. Mayr (Author), 2006, Die Aufgaben deutscher Gewerkschaften in ihren Anfängen und am Beginn des 21. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69105