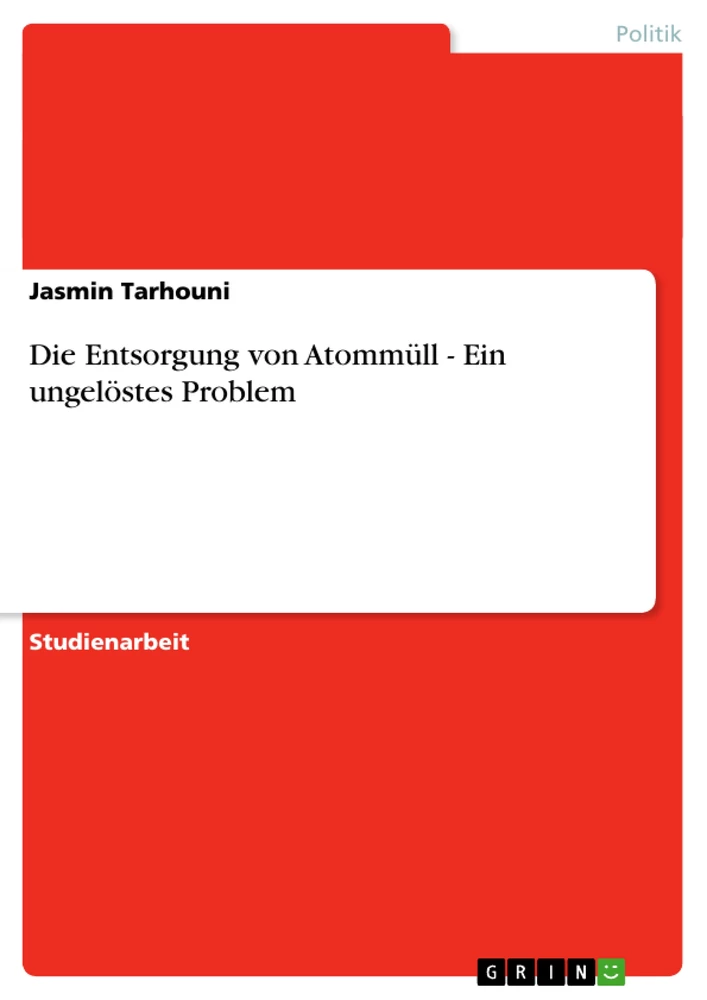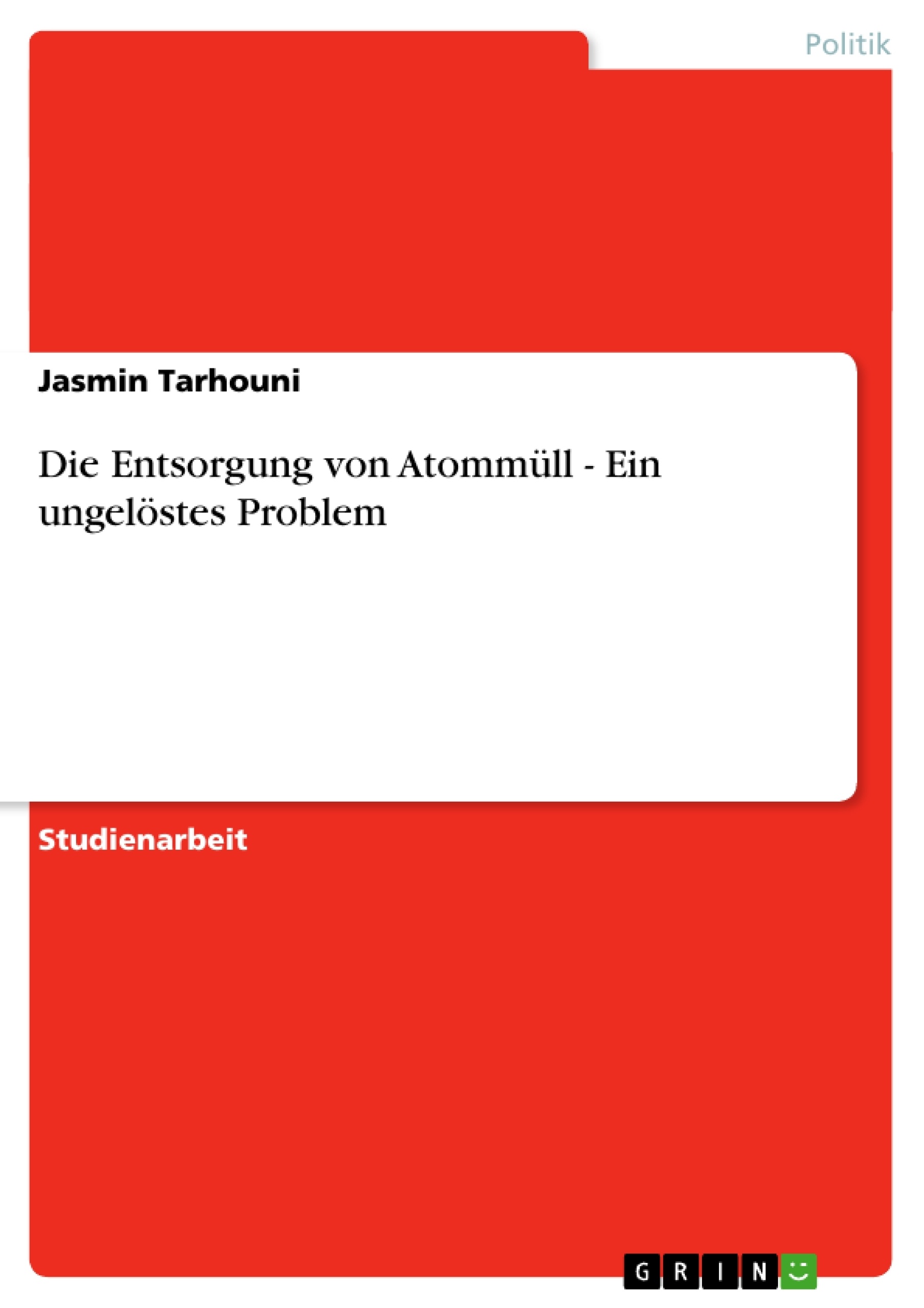Im Dezember des Jahres 1942 gelang dem italienischen Physiker Enrico Fermi ein Experiment, das die Relation der Menschheit zur Natur mit seiner Wissenschaft grundlegend ändern sollte. Fermi gelang es in einem geheimen unterirdischen Militärlabor in Chicago (USA) genügend Uran zusammenzubringen, um eine Kernspaltung auszulösen. Durch die Spaltung des Atoms wurde jene Energie freigesetzt, die alle Materie zusammenhält. Es folgte eine naturwissenschaftliche Revolution, die Bereiche wie das Militärwesen und die Medizin beeinflusste. Das Verlangen nach „billiger“ Elektrizität schien optimal befriedigt.
Doch seit dem Einsatz der Kernenergie in den 1950er Jahren hat die Technologie ein immenses bis dato ungelöstes Problem hinterlassen, den radioaktiven Abfall. Die Entsorgung des radioaktiven Abfalls, die die sichere Beseitigung desgleichen bezeichnet, bildet einen Kern des gesellschaftlichen Konflikts im Kontext mit der zivilen als auch militärischen Nutzung der Atomenergie. Die Debatte um zivile Wertstoffe wie Plutonium, welches nicht mehr durch den zivilen Markt absorbiert werden kann, wird von der Frage beherrscht, wie jene Plutoniumbestände beseitigt werden können? Die Kernenergie wird weiterhin global betrieben. Keines der Länder, die sich für die Energieform der Atomkraft entschieden hat, bietet akzeptable und nachhaltige Lösung für das Beseitigungsproblem des radioaktiven Abfalls. Die geologische Endlagerung scheint momentan das letzte Glied der Entsorgungskette zu sein.
Um sich mit der Thematik der Entsorgung des Atommülls zu befassen, bedarf es der Definition ebensolchen. Die Begriffsbestimmung und Klassifizierung des radioaktiven Mülls ist im zweiten Kapitel dieser wissenschaftlichen Arbeit nachzulesen. Ebenso enthält dieser Abschnitt die Darstellung der Genese des Abfalls, vom Abbau der chemischen Stoffe bis zur Entsorgung und dem daraus entstehenden Anfall des Abfalls. Welche Entsorgungswege resp. -lösungen im Rahmen des Atomgesetzes gegeben sind, veranschaulicht das dritte Kapitel. Die Lagerung als Option des Entsorgungskreislaufes soll detailliert im vierten Abschnitt dieser Hausarbeit betrachtet werden. Eine Abgrenzung zwischen Zwischen- und Endlager ist dabei obligatorisch. Verdeutlicht wird die Funktion eines Zwischenlagers, mit einer optionalen zukünftigen Nutzung als Endlager am Beispiel des Salzstocks Gorleben. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Abfallbegriff und die Herkunft des Abfalls
- 2.1 Definition der radioaktiven Abfälle
- 2.2 Die Herkunft des radioaktiven Abfalls
- 2.3 Die Abfallmengen
- 3. Die Optionen zur Abfallbeseitigung der radioaktiven Wertstoffe
- 4. Die Lagerung als Station des Entsorgungskreislaufs – eine Standortanalyse
- 4.1 Das Zwischenlager
- 4.2 Das Endlager
- 4.3 Der Standort Salzstock Gorleben
- 5. Die Gefahren der (unfreiwilligen) Proliferation
- 6. Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Problem der Atommüllentsorgung. Ziel ist es, die Herausforderungen bei der Beseitigung radioaktiver Abfälle zu beleuchten und verschiedene Lösungsansätze zu diskutieren. Die Arbeit konzentriert sich auf die Definition und Klassifizierung von Atommüll, die verfügbaren Entsorgungsoptionen, die Rolle der Lagerung (Zwischen- und Endlagerung), und die damit verbundenen Gefahren, insbesondere im Hinblick auf Proliferation.
- Definition und Klassifizierung radioaktiver Abfälle
- Entsorgungsoptionen für radioaktive Wertstoffe
- Zwischen- und Endlagerung von Atommüll
- Standortanalyse potentieller Endlager (z.B. Gorleben)
- Gefahren der Proliferation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Atommüllentsorgung ein und hebt die Bedeutung des Problems im Kontext der zivilen und militärischen Nutzung der Kernenergie hervor. Sie stellt die zentrale Frage nach nachhaltigen Lösungen für die Beseitigung radioaktiver Abfälle und kündigt die Struktur der Arbeit an, die sich mit der Definition von Atommüll, Entsorgungsoptionen, Lagerung und Proliferationsrisiken auseinandersetzt. Der Bezug auf Enrico Fermis Experiment unterstreicht den historischen Kontext der Kernenergie und ihres Abfallproblems. Die Einleitung etabliert den Konflikt zwischen dem Bedarf an Kernenergie und dem Problem der dauerhaften und sicheren Entsorgung des anfallenden Mülls als zentrales Thema der Arbeit.
2. Der Abfallbegriff und die Herkunft des Abfalls: Dieses Kapitel definiert den Begriff „radioaktiver Abfall“ juristisch und im allgemeinen Sprachgebrauch. Es differenziert zwischen schwach- und mittel- sowie hochradioaktiven Abfällen und erläutert deren Eigenschaften, insbesondere die Halbwertszeit der Radioisotope. Die Herkunft des Abfalls wird von der Gewinnung der Rohstoffe bis zur Entstehung des Endprodukts beschrieben. Das Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten der Abfallklassifizierung und die Herausforderungen bei der Handhabung und Entsorgung der verschiedenen Abfallarten. Die Quantifizierung der Abfallmengen, insbesondere des schwach- und mittel-aktiven Mülls (SMAA), wird ebenfalls thematisiert und unterstreicht die Größenordnung des Problems. Die unterschiedlichen Behandlungsmethoden für SMAA, inklusive der Verfestigung und oberirdischen Endlagerung, werden vorgestellt.
3. Die Optionen zur Abfallbeseitigung der radioaktiven Wertstoffe: (Dieses Kapitel wird aufgrund fehlender Informationen in der Textausgabe nicht zusammengefasst.)
4. Die Lagerung als Station des Entsorgungskreislaufs – eine Standortanalyse: Dieses Kapitel behandelt die Lagerung von radioaktivem Abfall als zentrale Komponente des Entsorgungskreislaufs. Es unterscheidet zwischen Zwischen- und Endlagerung und analysiert deren jeweilige Funktionen und Anforderungen. Der Salzstock Gorleben wird als Beispiel für einen potenziellen Endlagerstandort detailliert betrachtet, wobei die Vor- und Nachteile dieser Option im Kontext von Sicherheit und Langzeitspeicherung erörtert werden. Das Kapitel vertieft die Aspekte der Langzeitsicherheit und der Standortwahl unter Berücksichtigung geologischer Faktoren und anderer relevanter Kriterien.
5. Die Gefahren der (unfreiwilligen) Proliferation: (Dieses Kapitel wird aufgrund fehlender Informationen in der Textausgabe nicht zusammengefasst.)
Schlüsselwörter
Atommüllentsorgung, radioaktiver Abfall, Kernenergie, Endlagerung, Zwischenlagerung, Gorleben, Proliferation, Halbwertszeit, Radioisotope, SMAA, HAA, Entsorgungskreislauf.
FAQ: Atommüllentsorgung - Eine umfassende Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht umfassend das Problem der Atommüllentsorgung. Sie beleuchtet die Herausforderungen bei der Beseitigung radioaktiver Abfälle und diskutiert verschiedene Lösungsansätze.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Definition und Klassifizierung von Atommüll, die verfügbaren Entsorgungsoptionen, die Rolle der Lagerung (Zwischen- und Endlagerung), und die damit verbundenen Gefahren, insbesondere im Hinblick auf Proliferation. Es werden verschiedene Abfalltypen (schwach-, mittel- und hochradioaktiv) und deren Eigenschaften behandelt, sowie die Quantifizierung der Abfallmengen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Abfallbegriff und Herkunft, Entsorgungsoptionen, Lagerung (mit Schwerpunkt Gorleben als potentiellen Endlagerstandort), und die Gefahren der Proliferation. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse des jeweiligen Themas.
Was wird unter „radioaktivem Abfall“ verstanden?
Die Arbeit definiert den Begriff „radioaktiver Abfall“ juristisch und im allgemeinen Sprachgebrauch und differenziert zwischen verschiedenen Abfalltypen nach ihrer Radioaktivität und Halbwertszeit. Die Herkunft des Abfalls wird von der Rohstoffgewinnung bis zum Endprodukt nachvollzogen.
Welche Entsorgungsoptionen werden diskutiert?
Die Arbeit erwähnt verschiedene Entsorgungsoptionen für radioaktive Wertstoffe, jedoch sind detaillierte Informationen dazu in der vorliegenden Textausgabe nicht verfügbar.
Welche Rolle spielt die Lagerung?
Die Lagerung (Zwischen- und Endlagerung) wird als zentrale Komponente des Entsorgungskreislaufs behandelt. Die Arbeit analysiert die Funktionen und Anforderungen beider Lagerungsarten und untersucht detailliert den Salzstock Gorleben als potenziellen Endlagerstandort, inklusive einer Bewertung von Vor- und Nachteilen.
Welche Gefahren werden im Zusammenhang mit Atommüllentsorgung diskutiert?
Ein Schwerpunkt liegt auf den Gefahren der (unfreiwilligen) Proliferation im Zusammenhang mit der Lagerung und dem Umgang mit radioaktiven Abfällen. Detaillierte Informationen zu diesem Aspekt fehlen jedoch in der vorliegenden Textausgabe.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Atommüllentsorgung, radioaktiver Abfall, Kernenergie, Endlagerung, Zwischenlagerung, Gorleben, Proliferation, Halbwertszeit, Radioisotope, SMAA, HAA, Entsorgungskreislauf.
Welche Informationen fehlen in der vorliegenden Textausgabe?
Detaillierte Informationen zu den Entsorgungsoptionen für radioaktive Wertstoffe und zu den Gefahren der Proliferation fehlen in der vorliegenden Textausgabe.
- Quote paper
- Jasmin Tarhouni (Author), 2007, Die Entsorgung von Atommüll - Ein ungelöstes Problem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68917