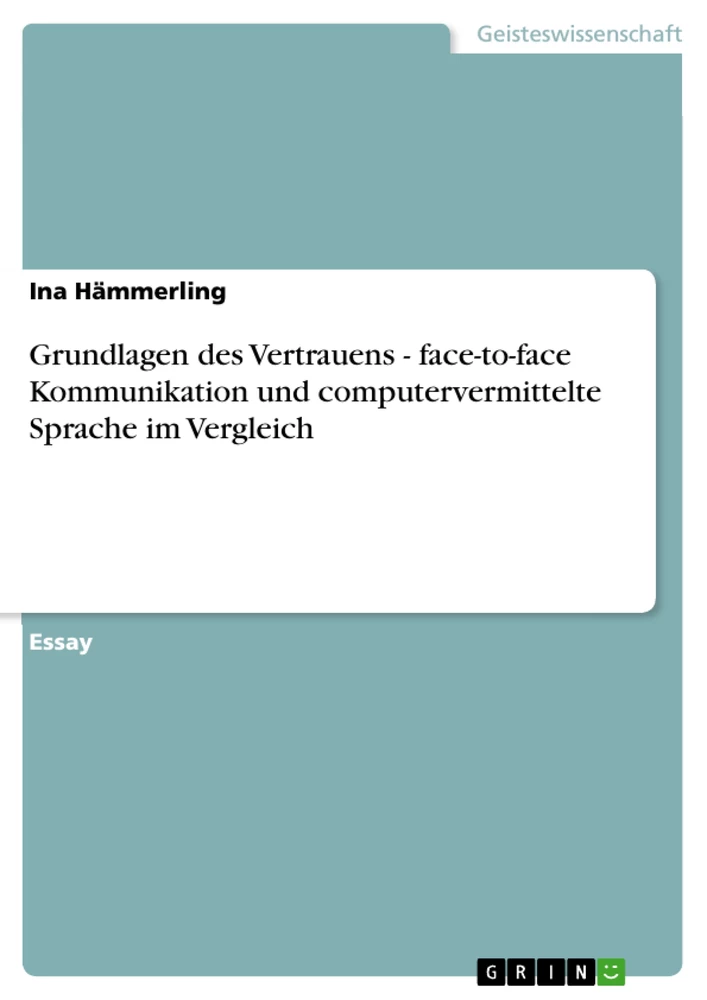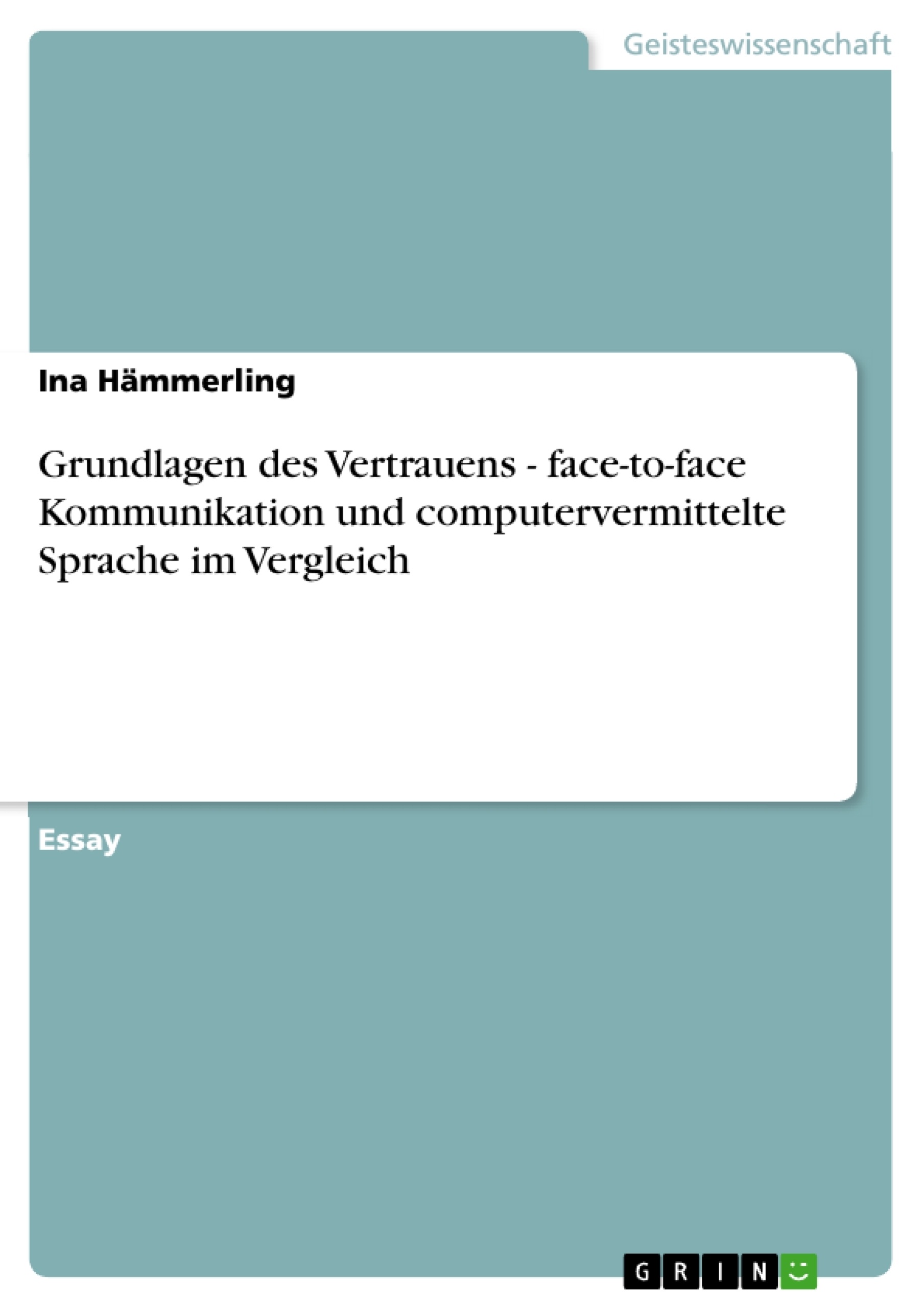„Archetyp der zwischenmenschlichen Kommunikation“1 ist die face-to-face Kommunikation, die für uns die natürlichste Art der Kommunikation darstellt. Die miteinander kommunizierenden Individuen können sich gegenseitig wahrnehmen, aufeinander eingehen und dadurch mit Gestik und Mimik, also mit allen Sinnen, interagieren. Kleidung, Habitus oder Selbstdarstellung verraten dem Gegenüber kulturelle und soziale Ähnlichkeiten oder Unterschiede. Sprachliche Mittel wie Ironie, Unverständnis oder Misstrauen können mit
Hervorhebung der Stimme kenntlich gemacht werden und zeigen so dem Gesprächspartner auch ohne weitere Erklärungen, dass man zum Beispiel etwas humorvoll gemeint hat. Einfach formuliert kann man also bei der face-to-face Kommunikation von einer idealen Verständigungsform reden, die alle denkbaren Prozesse innerhalb einer Kommunikation mit einschließt. Die Gesprächspartner bewegen sich somit in einem kognitiv-sozialen Rahmen, in dem sie auch ohne Worte kommunizieren können, denn Körpersprache versteht jeder. Eine weitere wichtige Rolle spielt der erste Eindruck, den unser Gegenüber auf uns hat. Hierbei greifen wir automatisch auf vorangegangene Erfahrungen zurück, vergleichen also unseren aktuellen Gesprächspartner mit ehemaligen, die sich ähnlich verhalten haben und machen uns so in kürzester Zeit ein Bild. Abhängig davon ob dieses Bild positiv oder negativ ausfällt, finden wir unser Gegenüber sympathisch oder unsympathisch und treten ihm somit entweder mit Vertrauen oder Skepsis gegenüber.
Inhaltsverzeichnis
- Grundlagen des Vertrauens - face-to-face Kommunikation und computervermittelte Sprache im Vergleich
- Mit der Erfindung technischer Kommunikationshilfsmittel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen face-to-face Kommunikation und computervermittelter Kommunikation, insbesondere im Hinblick auf den Aufbau von Vertrauen. Es wird analysiert, inwieweit computervermittelte Sprache die face-to-face Kommunikation reproduzieren kann und welche Rolle dabei nonverbale Kommunikation spielt.
- Vertrauensbildung in face-to-face Kommunikation
- Reproduktion von face-to-face Kommunikation in der computervermittelten Sprache
- Rolle nonverbaler Kommunikationselemente
- Lügen und Täuschung in verschiedenen Kommunikationsformen
- Soziale Interaktion und Vertrauensaufbau in Online-Gemeinschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Grundlagen des Vertrauens - face-to-face Kommunikation und computervermittelte Sprache im Vergleich: Die Arbeit beginnt mit der Beschreibung der face-to-face Kommunikation als Archetyp zwischenmenschlicher Interaktion, die durch den Einsatz aller Sinne, Körpersprache und unmittelbarer Wahrnehmung gekennzeichnet ist. Hierbei spielt der erste Eindruck und die Interpretation nonverbaler Signale eine entscheidende Rolle für die Vertrauensbildung. Die Arbeit stellt die Hypothese auf, dass die Vertrauensbildung in der face-to-face Kommunikation aufgrund der Vielzahl an verfügbaren Kommunikationskanälen effizienter verläuft.
Mit der Erfindung technischer Kommunikationshilfsmittel: Dieser Abschnitt analysiert die computervermittelte Kommunikation im Kontext des Vertrauensaufbaus. Es wird der Unterschied zwischen face-to-face Kommunikation und computervermittelter Kommunikation hinsichtlich der Möglichkeiten der Informationsübermittlung und der Herausforderungen bei der Interpretation von Botschaften im Internet herausgestellt. Der Text vergleicht Studien, die die Häufigkeit von Lügen in verschiedenen Kommunikationsformen untersuchen und hinterfragt die Annahme, dass im Internet häufiger gelogen wird. Die Rolle von Online-Plattformen und deren Einfluss auf die Vertrauensbildung wird ebenfalls diskutiert, wobei ein Unterschied zwischen geschäftlichen und privaten Online-Plattformen hinsichtlich des Vertrauensaufbaus gemacht wird. Die Bedeutung von Emoticons und Abkürzungen sowie die Entstehung der „Netikette“ als online-spezifisches Regelwerk werden erläutert. Schließlich wird der Einfluss von Gruppenzugehörigkeit und gemeinsamer Lebensform auf die Vertrauensbildung im Internet betont.
Schlüsselwörter
Face-to-face Kommunikation, Computervermittelte Kommunikation, Vertrauen, Nonverbale Kommunikation, Vertrauensbildung, Lügen, Emoticons, Netikette, Online-Gemeinschaften, Soziale Interaktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Grundlagen des Vertrauens - face-to-face Kommunikation und computervermittelte Sprache im Vergleich
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen face-to-face Kommunikation und computervermittelter Kommunikation, insbesondere im Hinblick auf den Aufbau von Vertrauen. Sie analysiert, inwieweit computervermittelte Sprache die face-to-face Kommunikation reproduzieren kann und welche Rolle dabei nonverbale Kommunikation spielt.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Vertrauensbildung in face-to-face Kommunikation, die Reproduktion von face-to-face Kommunikation in computervermittelter Sprache, die Rolle nonverbaler Kommunikationselemente, Lügen und Täuschung in verschiedenen Kommunikationsformen sowie soziale Interaktion und Vertrauensaufbau in Online-Gemeinschaften.
Wie wird die face-to-face Kommunikation beschrieben?
Die face-to-face Kommunikation wird als Archetyp zwischenmenschlicher Interaktion beschrieben, gekennzeichnet durch den Einsatz aller Sinne, Körpersprache und unmittelbarer Wahrnehmung. Der erste Eindruck und die Interpretation nonverbaler Signale spielen eine entscheidende Rolle für die Vertrauensbildung.
Wie wird die computervermittelte Kommunikation im Kontext des Vertrauensaufbaus analysiert?
Der Abschnitt zur computervermittelten Kommunikation analysiert die Unterschiede zur face-to-face Kommunikation bezüglich Informationsübermittlung und Interpretation von Botschaften. Er vergleicht Studien zur Häufigkeit von Lügen in verschiedenen Kommunikationsformen, diskutiert den Einfluss von Online-Plattformen auf die Vertrauensbildung (unterschiedlich für geschäftliche und private Plattformen), die Bedeutung von Emoticons und Abkürzungen, die „Netikette“ und den Einfluss von Gruppenzugehörigkeit und gemeinsamer Lebensform auf den Vertrauensaufbau im Internet.
Welche Hypothese wird aufgestellt?
Die Arbeit stellt die Hypothese auf, dass die Vertrauensbildung in der face-to-face Kommunikation aufgrund der Vielzahl an verfügbaren Kommunikationskanälen effizienter verläuft.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Face-to-face Kommunikation, Computervermittelte Kommunikation, Vertrauen, Nonverbale Kommunikation, Vertrauensbildung, Lügen, Emoticons, Netikette, Online-Gemeinschaften, Soziale Interaktion.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst mindestens zwei Kapitel: "Grundlagen des Vertrauens - face-to-face Kommunikation und computervermittelte Sprache im Vergleich" und "Mit der Erfindung technischer Kommunikationshilfsmittel".
Welche Rolle spielen nonverbale Kommunikationselemente?
Nonverbale Kommunikationselemente spielen eine entscheidende Rolle bei der Vertrauensbildung in der face-to-face Kommunikation und beeinflussen die Interpretation von Botschaften in der computervermittelten Kommunikation. Die Arbeit untersucht, inwieweit diese Elemente in der computervermittelten Kommunikation reproduziert werden (z.B. durch Emoticons).
Wie wird die Frage nach Lügen und Täuschung behandelt?
Die Arbeit untersucht die Häufigkeit von Lügen in verschiedenen Kommunikationsformen und hinterfragt die Annahme, dass im Internet häufiger gelogen wird. Sie betrachtet Lügen und Täuschung im Kontext der Vertrauensbildung sowohl in face-to-face als auch in computervermittelten Interaktionen.
- Quote paper
- Ina Hämmerling (Author), 2005, Grundlagen des Vertrauens - face-to-face Kommunikation und computervermittelte Sprache im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68889