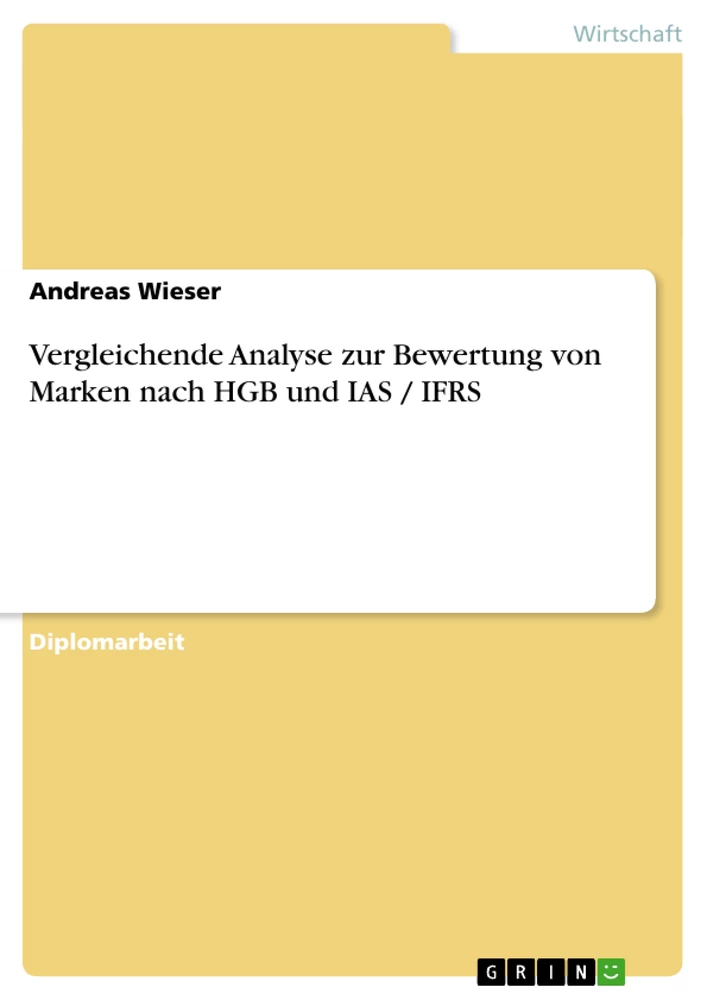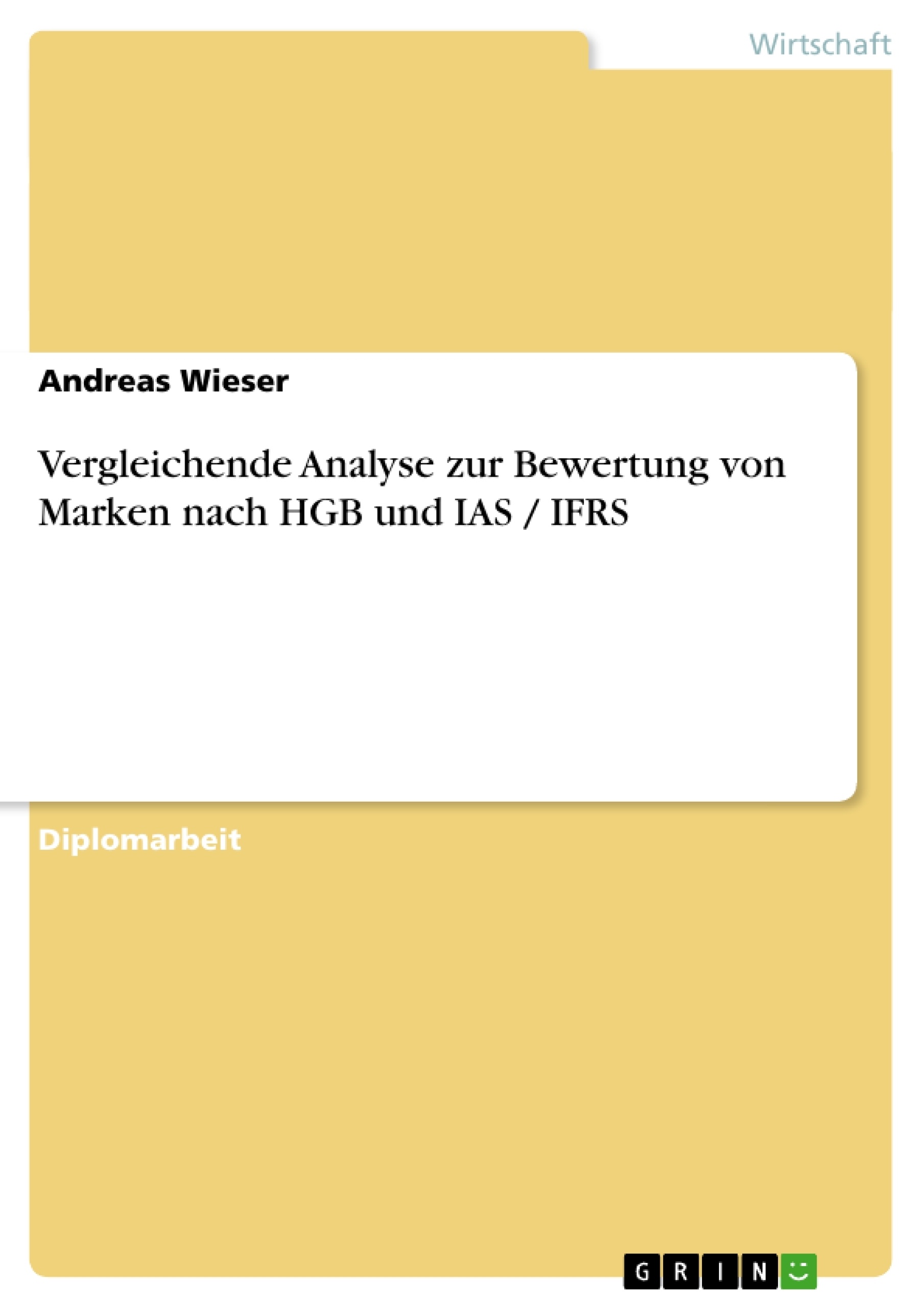Im Zuge der wachsenden Bedeutung immaterieller Werte wird immer weniger Vermögen in der Bilanz abgebildet. Auch unter Berücksichtigung der vorher angeführten Entwicklungstendenzen und Erweiterungen im Rahmen der klassischen Bilanzierung wäre die Bilanz allerdings nicht in der Lage zahlreiche immaterielle Werttreiber des Unternehmens adäquat abzubilden.
Vor dem Hintergrund der vermehrten Forderung nach einer transparenten und wertschöpfungsorientierten Unternehmensführung ist die monetäre Markenbewertung ein wichtiges Instrument, um einen der wertvollsten Vermögensbestandteile eines Unternehmens besser zu verstehen und zu managen. Dies bedarf einer Neuorientierung und -positionierung des Rechnungswesens in seiner Funktion als Managementunterstützungsinstrument. Wird das Wertschöpfungspotenzial von Marken richtig verstanden und erfasst, können Marken als Assets für die Stärkung der Bilanz, die Kapitalbeschaffung, die Steueroptimierung sowie in Mergers & Acquisitions und weiteren finanziellen Transaktionen zunehmend eine ihrer Bedeutung entsprechende Rolle einnehmen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung in die Themenstellung
- 1.1 Zielsetzung und Vorgehensweise
- 1.1.1 Entwicklung der Problemstellung
- 1.1.2 Abgrenzung des Themengebietes
- 1.1.3 Aufbau der Arbeit
- 1.2 Rechtliche Grundlagen
- 1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände nach HGB
- 1.2.2 Immaterielle Vermögenswerte nach IFRS
- 1.2.3 Wirtschaftsgüter in der Steuerlehre
- 1.2.4 Marken im Markengesetz
- 1.3 Abschlüsse und Bereiche des Rechnungswesens
- 1.3.1 Einzelabschluss und Konzernabschluss
- 1.3.2 Internes und externes Rechnungswesen
- 1.4 Bestandteile des Jahresabschlusses
- 1.4.1 Bestandteile des Jahresabschlusses nach HGB
- 1.4.2 Bestandteile des Jahresabschlusses nach IFRS
- 1.5 Internationalisierung der deutschen Rechnungslegung
- 2 Bilanzierungsfähigkeit von Marken
- 2.1 Bilanzierungsfähigkeit nach HGB
- 2.2 Bilanzierungsfähigkeit nach IFRS
- 3 Bewertung von Marken
- 3.1 Analyse von Markenbewertungsverfahren
- 3.1.1 Wert und Preis
- 3.1.2 Anlässe zur Markenbewertung
- 3.1.3 Markenwertberechnung
- 3.1.4 Bewertungsverfahren und -methoden
- 3.2 Zugangsbewertung von Marken
- 3.2.1 Zugangsbewertung nach HGB
- 3.2.1.1 Anschaffungskosten
- 3.2.1.1.1 Isolierter Erwerb
- 3.2.1.1.2 Sachgesamtheit
- 3.2.1.2 Herstellungskosten
- 3.2.2 Zugangsbewertung nach IFRS
- 3.2.2.1 Isolierter Erwerb
- 3.2.2.2 Sachgesamtheit
- 3.3 Folgebewertung von Marken
- 3.3.1 Folgebewertung nach HGB
- 3.3.1.1 Planmäßige Abschreibung
- 3.3.1.2 Außerplanmäßige Abschreibung
- 3.3.1.3 Zuschreibungen
- 3.3.2 Folgebewertung nach IFRS
- 3.3.2.1 Planmäßige Folgebewertung
- 3.3.2.2 Außerplanmäßige Folgebewertung
- 3.3.2.3 Zuschreibung
- 3.3.2.4 Neubewertung zu Verkehrswerten
- 4 Entwicklungstendenzen und Fazit
- 4.1 Aktivierungsmöglichkeiten selbstgeschaffener Marken
- 4.1.1 Gründung einer Tochtergesellschaft
- 4.1.2 Sale-and-Lease-Back-Verfahren
- 4.2 Darstellung von selbsterstellten Marken im Jahresabschluss
- 4.2.1 Darstellung von selbsterstellten Marken in der Bilanz
- 4.2.1.1 Ansatz als Rechnungsabgrenzungsposten
- 4.2.1.2 Aktivierung als Bilanzierungshilfe
- 4.2.2 Darstellung von selbsterstellten Marken in der GuV
- 4.2.3 Darstellung selbsterstellter Marken im Anhang
- 4.2.4 Darstellung selbsterstellter Marken im Lagebericht
- 4.3 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der vergleichenden Analyse der Bewertung von Marken nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) und den International Accounting Standards (IAS) / International Financial Reporting Standards (IFRS). Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Bilanzierungsfähigkeit und Bewertung von Marken aufzuzeigen und die Entwicklungstendenzen in diesem Bereich zu analysieren.
- Bilanzierungsfähigkeit von Marken nach HGB und IFRS
- Bewertung von Marken nach verschiedenen Verfahren und Methoden
- Zugangs- und Folgebewertung von Marken
- Aktivierungsmöglichkeiten selbstgeschaffener Marken
- Darstellung von Marken im Jahresabschluss
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Problemstellung ein und erläutert die rechtlichen Grundlagen der Markenbewertung. Es werden die relevanten Vorschriften des HGB, der IFRS und des Markengesetzes dargestellt, sowie die unterschiedlichen Bereiche des Rechnungswesens (internes und externes Rechnungswesen, Einzelabschluss und Konzernabschluss) beleuchtet. Kapitel 2 befasst sich mit der Bilanzierungsfähigkeit von Marken nach HGB und IFRS. Dabei werden die Kriterien für die Aktivierung von Marken im Jahresabschluss untersucht. Kapitel 3 analysiert verschiedene Markenbewertungsverfahren und -methoden und betrachtet sowohl die Zugangs- als auch die Folgebewertung von Marken. Schließlich werden in Kapitel 4 die Entwicklungstendenzen in der Markenbewertung diskutiert und ein Fazit gezogen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Markenbewertung, HGB, IFRS, Bilanzierungsfähigkeit, Zugangsbewertung, Folgebewertung, Abschreibung, Zuschreibung, Markenwertberechnung, immaterielle Vermögenswerte, Jahresabschluss, Entwicklungstendenzen.
- Quote paper
- Andreas Wieser (Author), 2007, Vergleichende Analyse zur Bewertung von Marken nach HGB und IAS / IFRS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68875