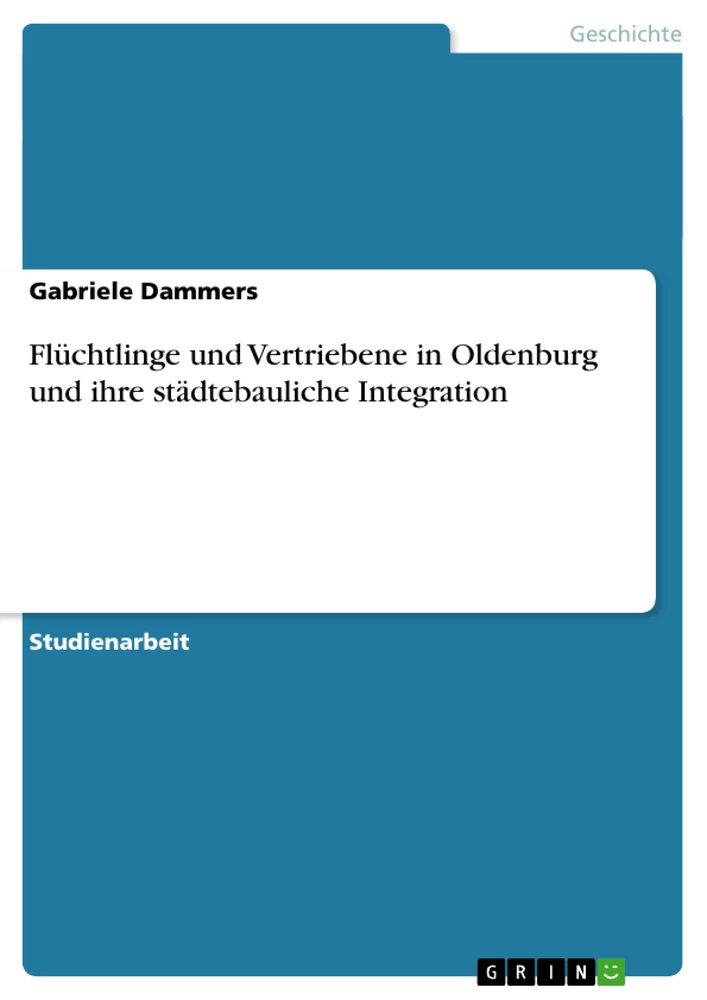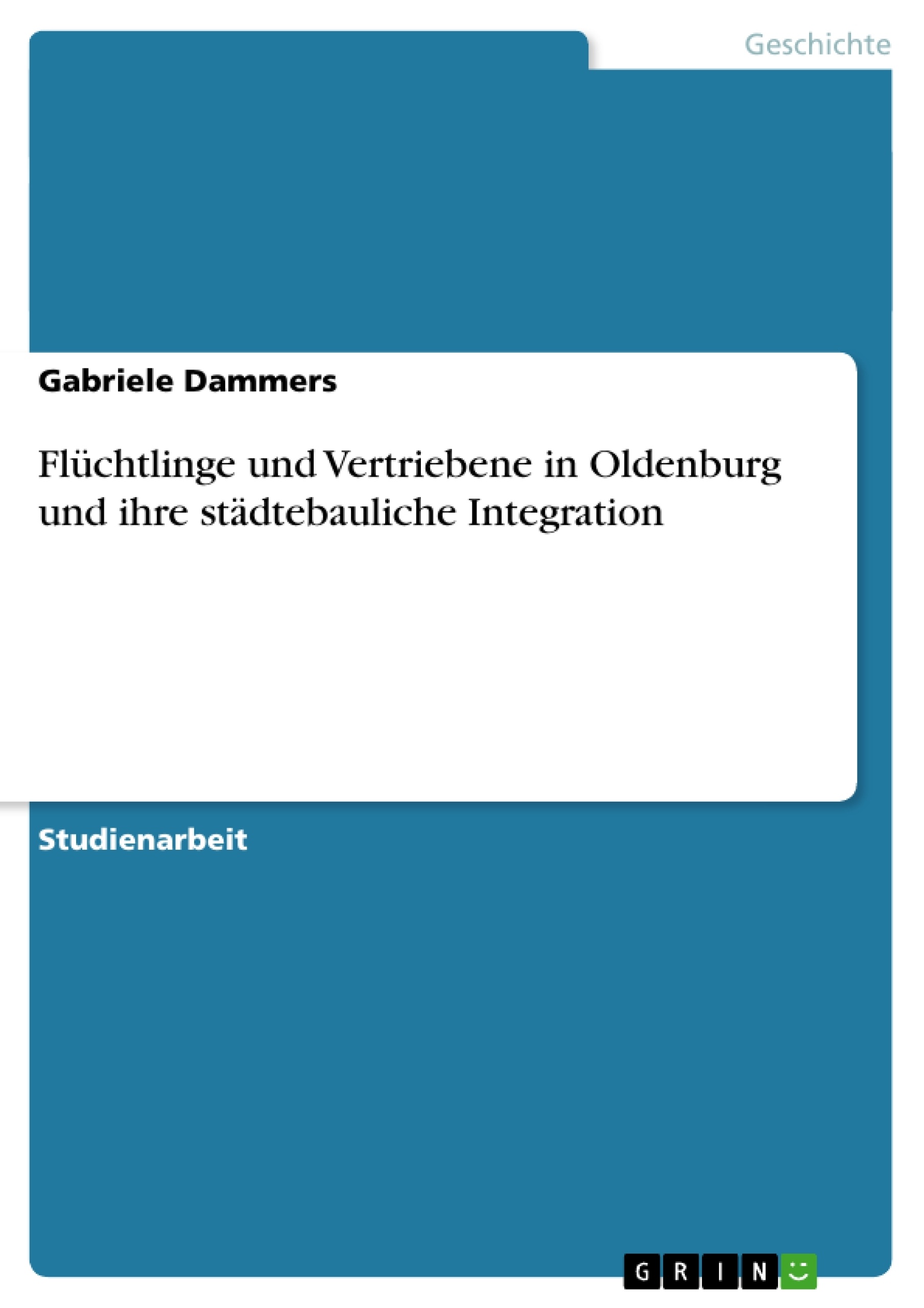»Die nach dem Zweiten Weltkrieg durch Zerstörung und Flüchtlingsströme ausgelöste Wohnungsnot war Anlaß, die Stadtentwicklungspolitik bis Anfang der 70er Jahre darauf auszurichten, für möglichst viele Menschen innerhalb kürzester Zeit möglichst viele Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Diese Neubautätigkeiten waren neben den Wiederaufbau zerstörter Stadtteile geprägt durch die Neugründung
von Stadtteilen sowie Schaffung von zusätzlichem Wohnraum für eine wachsende Bevölkerung (…). «
Auch die Stadt Oldenburg war geprägt durch diese Stadtentwicklungspolitik, allerdings gab es im Gegensatz zu den meisten Städten keine größeren Zerstörungen von Wohnraum. Es wird davon ausgegangen, dass es nur geringere Zerstörungen gab. Besonders betroffen war Oldenburg jedoch von einem starken Bevölkerungsanstieg durch Flüchtlinge und Vertriebene. Die Zahl der Einwohner Oldenburgs erhöhte sich drastisch.
In dieser Hausarbeit möchte ich mich daher mit der Fragestellung „Wie wurde der starke Bevölkerungsanstieg durch Vertriebene und Flüchtlinge in Oldenburg städtebaulich bewältigt?“ auseinandersetzen.
Ich möchte diese Thematik gerne unter dem Begriff „Integration“ betrachten. Von Seggern spricht über „Phasen der partiellen Integration“ der Flüchtlinge in Oldenburg. Er beschreibt drei Stufen der Integration: Zunächst die „ökonomische Integration“, die Vertriebene sollten in dieser Phase in den Oldenburger Arbeitsmarkt aufgenommen worden sein. Die nächste Phase ist die „soziale Integration“, in dieser Phase stand die Schaffung von Wohnraum im Mittelpunkt. Die letzte Phase sollte die „politische Integration“ sein. In meinen Ausführungen werde ich mich in erster Linie mit der sozialen Integration und deren Schwerpunkt „Schaffung von Wohnraum“ beschäftigen.
Bevor ich mich dieser eigentlichen Fragestellung widme, stelle ich zwei Exkurse voran. Der Erste soll einen Überblick über die generelle Thematik „Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg“ schaffen. Im zweiten Exkurs werde ich kurz auf die Situation von Oldenburg nach dem Zweite Weltkrieg eingehen. Diesen Exkursen folgt dann der Hauptteil dieser Arbeit, dort versuche ich die Leitfrage dieser Arbeit zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Flucht und Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg
- Erste Pläne für eine Vertreibung
- „Wilde Vertreibungen“
- Kommunike / Potsdamer Abkommen
- Umgang mit deutschen Minderheiten in Jugoslawien und Rumänien
- Gesamtbetrachtung
- Oldenburg am Ende des Zweiten Weltkrieges
- Flüchtlinge und Vertriebene in Oldenburg
- Unterbringung in bereits vorhandenen Gebäuden
- Unterbringung in Privatquartieren
- Unterbringung in Lagern und Massenunterkünften
- Unterbringung in bereits vorhandenen Gebäuden
- Schaffung von neuem Wohnraum
- Förderung durch öffentliche Träger
- Sozialer Wohnungsbau-Fonds als Maßnahme der Kommune
- Maßnahmen von Bund und Land
- Private Initiativen
- Städtebauliche Umsetzung
- Kleinsiedlungsbau
- Sozialer Wohnungsbau
- Gartenstadt (Ohmsteder Esch)
- Förderung durch öffentliche Träger
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die städtebauliche Bewältigung des starken Bevölkerungsanstiegs durch Vertriebene und Flüchtlinge in Oldenburg nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie fokussiert sich auf den Begriff der Integration, insbesondere auf die „soziale Integration“, die mit der Schaffung von Wohnraum verbunden ist.
- Städtebauliche Herausforderungen durch Flüchtlingsströme
- Soziale Integration von Vertriebenen und Flüchtlingen
- Schaffung von neuem Wohnraum in Oldenburg
- Öffentliche und private Initiativen zum Wohnungsbau
- Städtebauliche Entwicklungen und Veränderungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Forschungsfrage, den Forschungsstand und die Gliederung der Arbeit dar. Sie beleuchtet die besondere Situation Oldenburgs im Vergleich zu anderen Städten und führt den Begriff der Integration ein.
- Das Kapitel „Flucht und Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg“ gibt einen allgemeinen Überblick über die Thematik, beleuchtet die ersten Vertreibungspläne, „wilde Vertreibungen“ und die Rolle des Potsdamer Abkommens.
- Der zweite Exkurs widmet sich der Situation Oldenburgs am Ende des Zweiten Weltkriegs und verdeutlicht die Bedeutung der Flüchtlingsströme für die Stadtentwicklung.
- Das Kapitel „Flüchtlinge und Vertriebene in Oldenburg“ behandelt die Unterbringung der Flüchtlinge, sowohl in Privatquartieren als auch in Lagern und Massenunterkünften.
- Das Kapitel „Schaffung von neuem Wohnraum“ beleuchtet die Rolle von öffentlichen Trägern und privaten Initiativen im Wohnungsbau. Es werden verschiedene städtebauliche Ansätze wie Kleinsiedlungsbau, Sozialer Wohnungsbau und Gartenstadt (Ohmsteder Esch) vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themenbereiche Flüchtlingsintegration, Wohnungsbau, städtebauliche Entwicklung, Oldenburg, Nachkriegszeit, soziale Integration, Vertreibung, Flucht, und die Rolle von öffentlichen und privaten Akteuren in der städtebaulichen Planung. Die Arbeit befasst sich mit der Bewältigung der städtebaulichen Herausforderungen im Kontext der Nachkriegszeit, insbesondere im Hinblick auf die Integration von Vertriebenen und Flüchtlingen.
- Quote paper
- Gabriele Dammers (Author), 2005, Flüchtlinge und Vertriebene in Oldenburg und ihre städtebauliche Integration, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68867