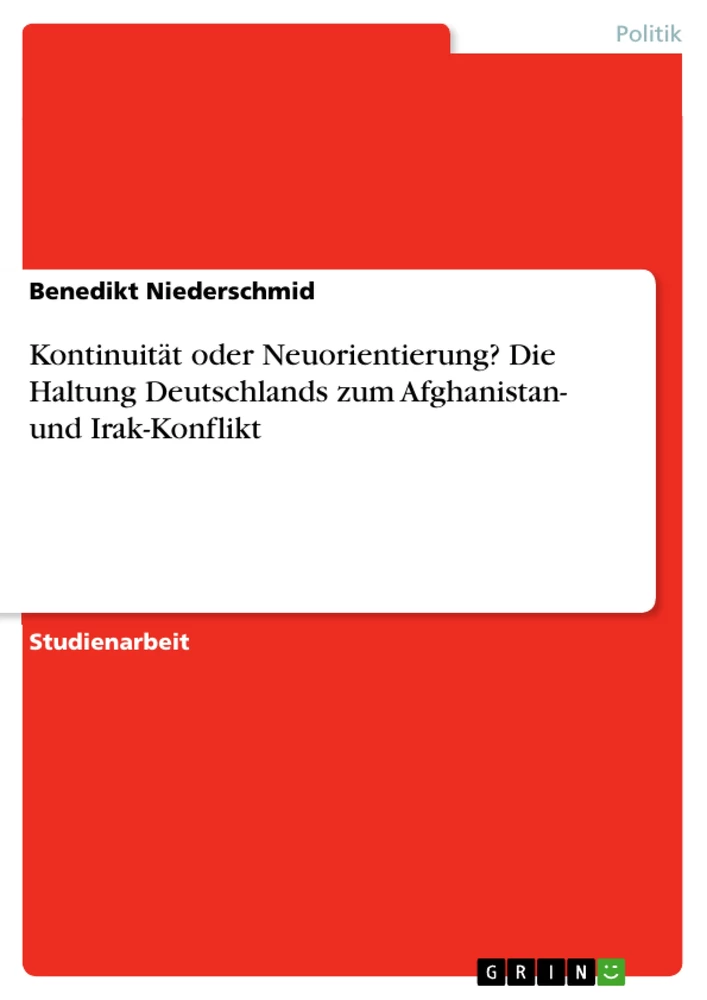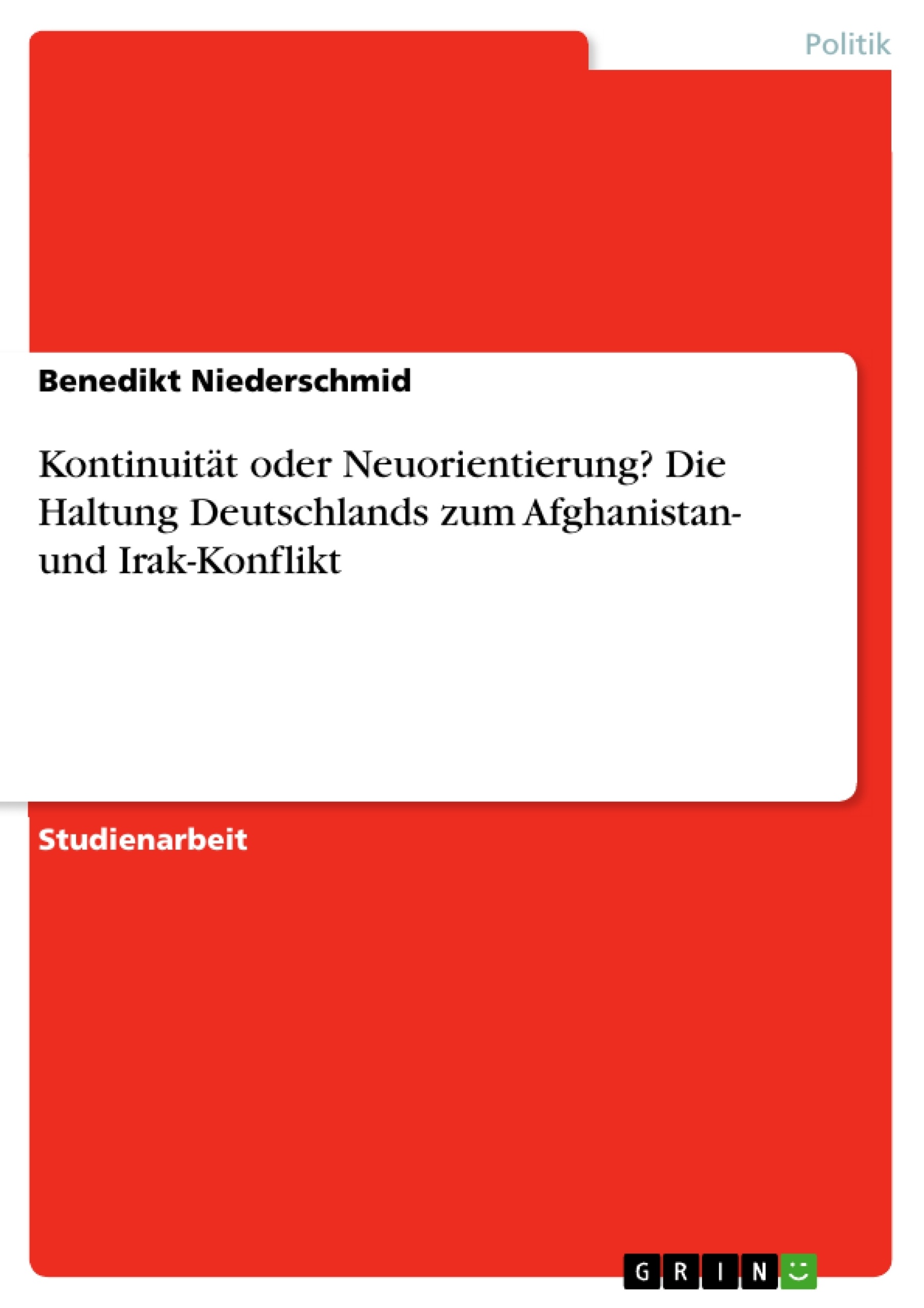Der terroristische Anschlag auf die „Twin Towers“ in New York und die über 3000 Menschen, die die Attentäter mit in den Tod rissen, ließen eine verunsicherte Welt zurück und ein Amerika, dass Vergeltung wollte. Nur ging es diesmal nicht gegen eine Nation, ein Volk oder einen Nationalstaat. Als Gegner sah man sich einem „unsichtbaren“ Feind gegenüber, dem international operierenden Terror-Netzwerk al-Qaida, jene Organisation des arabischen Millionärserben Osama bin Laden, die sich im Heiligen Krieg gegen die Ungläubigen im Westen befindet und dezentral in vielen Ländern kleine Zellen unterhält. Mit der Projizierung der al-Qaida-Verbrechen auf das Taliban-Regime in Afghanistan versuchte die USA eine Normalisierung des Unnormalen und auf eine neue Bedrohung mit den bewährten Mitteln zu antworten. Seitdem befindet sich die Welt im Kriegszustand, dem „Jahrhundertkrieg“ gegen den Terrorismus, der bereits zwei militärische Auseinandersetzungen zur Folge hatte. Im ersten, kurz nach den Anschlägen, gegen Afghanistan, war Deutschland Teil einer nach den Anschlägen geschmiedeten Koalition gegen den Terror und nahm aktiv am Kriegsgeschehen teil. Gegen den Irak zog sich Deutschland aus dieser Koalition zurück und gehörte mit Frankreich zur Speerspitze der Länder, die gegen den Krieg votierten - auf den ersten Blick aus wahltaktischen Gründen und gegen den Willen der USA, die im Irak auf einen präventiv herbeigeführten Regimewechsel pochten und dabei auf eine breite Allianz des Westens gehofft hatten, möglichst noch mit einem Mandat des Sicherheitsrates ausgestattet.
Durch die Weigerung, sich an diesem Krieg zu beteiligen, zog sich die Regierung in Berlin den Unwillen Washingtons zu, das die deutsche Diplomatie fortan schlichtweg ignorierte. Warum wurde mit den transatlantischen Beziehungen die wichtigste Konstante deutscher Außenpolitik in dieser Form belastet? Die allgemeine Antwort darauf liegt im Prinzip auf der Hand: Die Gewichtung der deutschen, außenpolitischen Handlungsmaximen und Interessen musste sich in irgendeiner Weise verlagert haben.
Nach dem zweiten Weltkrieg stand immer die Berechenbarkeit und Verlässlichkeit im Mittelpunkt deutscher Außenpolitik. Die Kontinuität in den für die Vertretung Deutschlands nach außen im Rahmen der Pariser Verträge im Jahr 1954 vereinbarten Prämissen war bis zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Länder außenpolitischer Imperativ der Nachkriegsregierungen, dabei ist es einerlei, ob sie von SPD oder CDU gestellt wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Determinierung der Grundsätze deutscher Außenpolitik
- Normative Grundlagen
- Vier außenpolitische Säulen
- Außenpolitische Neuorientierung
- Die Koalitionsverträge
- Zivile Krisenprävention
- Uneingeschränkte Solidarität - der Afghanistan-Konflikt
- Die uneingeschränkte Solidarität
- Lippenbekenntnis Multilateralität?
- Deutschland im Krieg
- Sieg der Diplomatie - die „UN Talks on Afghanistan“
- Aus Prinzip Nein? Der Irak-Konflikt
- Nein im Wahlkampf
- Die deutsche Haltung
- Multilateralität Ade?
- Kritik am,,deutschen Weg"
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Haltung Deutschlands zum Afghanistan- und Irak-Konflikt im Kontext der deutschen Sicherheits- und Außenpolitik von 1949 bis zur Gegenwart. Sie beleuchtet die Kontinuität und mögliche Neuorientierung der deutschen Außenpolitik vor dem Hintergrund dieser Konflikte und untersucht, ob die deutsche Haltung eine innere Logik verfolgt.
- Die normativen Grundlagen und zentralen Interessen deutscher Außenpolitik
- Die außenpolitische Neuorientierung der Regierung Schröder/Fischer
- Die deutsche Positionierung im Afghanistan-Konflikt und ihre Auswirkungen auf das transatlantische Bündnis
- Die deutsche Haltung zum Irak-Konflikt und die damit verbundenen Kritikpunkte
- Die Rolle der Multilateralität in den deutschen Entscheidungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und beschreibt den Kontext des internationalen Kampfes gegen den Terrorismus nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Es stellt die Frage, ob die deutsche Außenpolitik im Zuge der Konflikte in Afghanistan und im Irak einer Neuorientierung unterworfen wurde oder ob die Kontinuität der traditionellen Handlungsmaximen gewahrt blieb.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Determinierung der Grundsätze deutscher Außenpolitik. Es beschreibt die normativen Grundlagen, die vier zentralen Säulen der deutschen Außenpolitik und die außenpolitische Neuorientierung der Regierung Schröder/Fischer.
Das dritte Kapitel untersucht die deutsche Haltung zum Afghanistan-Konflikt. Es thematisiert die uneingeschränkte Solidarität, das Lippenbekenntnis zur Multilateralität, die deutsche Kriegsbeteiligung und den Erfolg der Diplomatie im Rahmen der „UN Talks on Afghanistan“.
Das vierte Kapitel analysiert die deutsche Positionierung im Irak-Konflikt. Es beleuchtet das Nein im Wahlkampf, die deutsche Haltung zur Kriegsbeteiligung, den Verfall der Multilateralität und die Kritik am „deutschen Weg“.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der deutschen Sicherheits- und Außenpolitik, wie der deutschen Staatsräson, der europäischen Integration, den normativen Grundlagen der deutschen Außenpolitik, der transatlantischen Beziehungen, dem Afghanistan- und Irak-Konflikt, der Multilateralität, der Kriegsbeteiligung, der zivilen Krisenprävention und der deutschen Neuorientierung in der Weltpolitik.
- Quote paper
- Benedikt Niederschmid (Author), 2004, Kontinuität oder Neuorientierung? Die Haltung Deutschlands zum Afghanistan- und Irak-Konflikt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68851