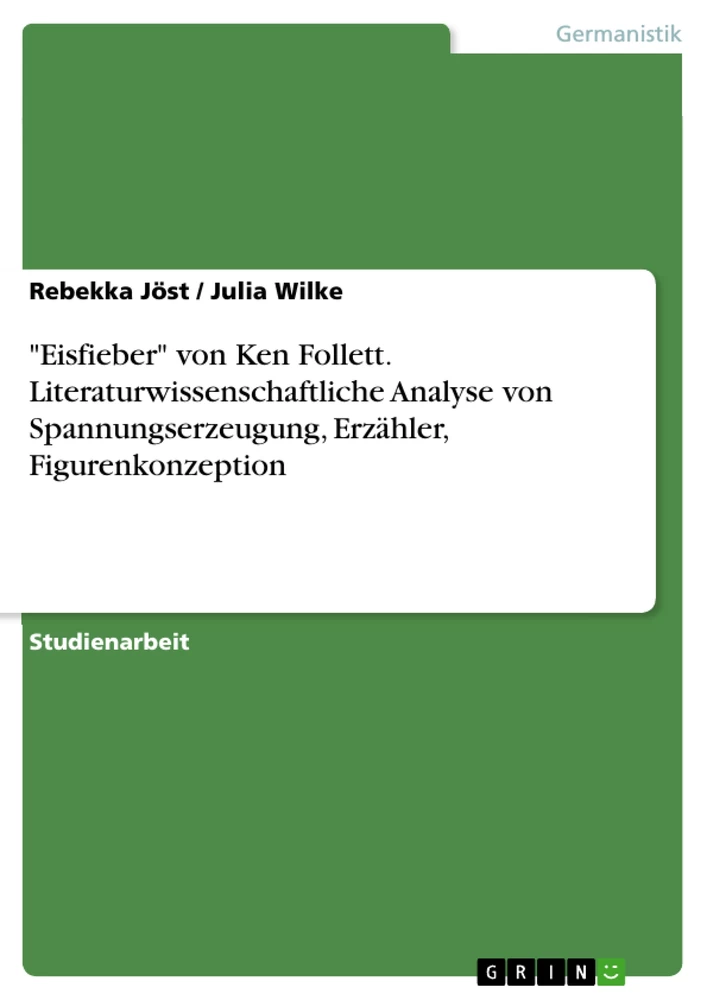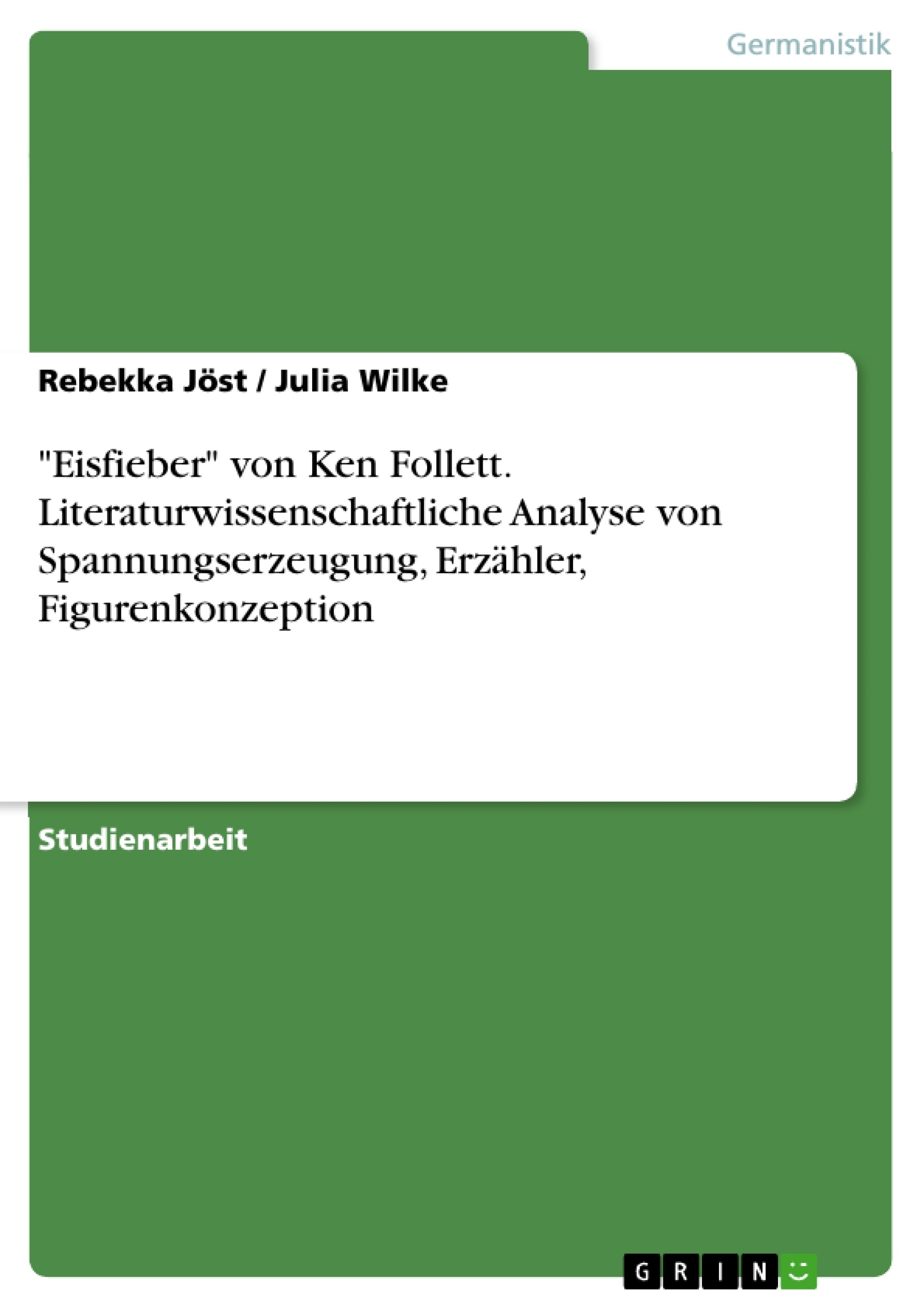Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit dem aktuellsten Roman des Bestsellerautors Ken Follett, „Eisfieber“.
Die englische Originalausgabe trägt den Titel „Whiteout“ und ist im Jahr 2004 erschienen. Die deutsche Ausgabe wurde von Till R. Lohmeyer und Christel Rost aus dem britischen Englisch übersetzt und wird seit September 2005 durch den Gustav Lübbe Verlag publiziert.
Der Roman umfasst 461 Seiten, welcher sich in drei Teile („Heiligabend“, „Erster Weihnachtsfeiertag“, „Zweiter Weihnachtsfeiertag“) plus Epilog („Erster Weihnachtsfeiertag ein Jahr später“) untergliedern lässt. Teil Eins umfasst 20 Kapitel, Teil Zwei 31. Der „Zweite Weihnachtsfeiertag“ besteht lediglich aus einem Kapitel. Die einzelnen Abschnitte sind nach der jeweiligen Uhrzeit benannt. Daraus ergibt sich eine Kongruenz aus Erzählzeit und Erzählter Zeit.
Der Originaltitel „Whiteout“ wurde unglücklich mit „Eisfieber“ übersetzt. „Mit dem englischen Begriff White-Out bezeichnet man in der Meteorologie die extreme Helligkeit, die bei dünner Bewölkung und einer Neuschneeauflage (z.B. im Hochgebirge oder auch in den Polregionen) zu beobachten ist. Die Ursache für die extreme Helligkeit liegt in der starken diffusen Reflexion des Sonnenlichts an den Schneekristallen und der Bewölkung. Der Begriff White-Out bezieht sich dabei speziell darauf, dass durch die extreme diffuse Reflexion jegliche Konturen der Landschaft verloren gehen können, was eine völlige Orientierungslosigkeit zur Folge haben kann.“(http://www.top-wetter.de/lexikon/w/whiteout.htm) Dieser Prozess spielt in Folletts Roman eine zentrale Rolle: er ist dafür verantwortlich, dass sich der Handlungsverlauf zuspitzt und sich zum Klimax steigert. Die deutsche Übersetzung lässt keinen direkten Zusammenhang von Titel und Handlung zu. [...]
Der Roman soll aus literaturwissenschaftlicher Sicht analysiert werden. Das Augenmerk soll dabei besonders auf die Techniken der Spannungserzeugung, die Bestimmung des Erzählers sowie die Figurenkonzeption gelegt werden, um herauszufinden, welche Faktoren Leselust erzeugen und einen Roman damit zum Bestseller machen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Autor
- Inhalt
- Stoff und Thema
- Stoff
- Thema
- Textanfang
- Bestimmung des Erzählers
- Erzählsystem nach Jürgen H. Petersen 1993
- Erzählform
- Erzählverhalten
- Standort des Erzählers
- Erzählperspektive
- Erzählhaltung
- Sprachliche Besonderheiten
- Figuren
- Figurenkonzeption
- Toni Gallo
- Kit Oxenford
- Stanley Oxenford
- Miranda versus Olga
- Textende
- Spannung
- LeseLust?
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Ken Folletts Roman „Eisfieber“ aus literaturwissenschaftlicher Perspektive. Der Fokus liegt auf der Spannungserzeugung, der Bestimmung des Erzählers und der Figurenkonzeption, um zu untersuchen, welche Faktoren Leselust erzeugen und einen Roman zum Bestseller machen können.
- Analyse der Techniken der Spannungserzeugung
- Bestimmung des Erzählers und seiner Rolle im Roman
- Untersuchung der Figurenkonzeption und deren Einfluss auf die Handlung
- Zusammenhang zwischen den genannten Aspekten und dem Erfolg des Romans
- Bedeutung der deutschen Übersetzung des Titels im Kontext der Handlung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Arbeit und erläutert die Relevanz des Romans "Eisfieber" im Werk von Ken Follett. Sie stellt den Originaltitel "Whiteout" und dessen Bedeutung im Kontext der Handlung dar. Kapitel 2 beschreibt den Autor Ken Follett und seine Karriere, während Kapitel 3 den Inhalt des Romans "Eisfieber" zusammenfasst. Kapitel 4 befasst sich mit dem Stoff und Thema des Romans und erläutert die relevanten Aspekte des britischen Englisch, das im Roman verwendet wird.
Schlüsselwörter
Ken Follett, Eisfieber, Whiteout, Spannungserzeugung, Erzähler, Figurenkonzeption, Leselust, Bestseller, Stoff, Thema, Figuren, Handlung, Übersetzung, Sprache, Literaturwissenschaft.
- Arbeit zitieren
- Rebekka Jöst (Autor:in), Julia Wilke (Autor:in), 2006, "Eisfieber" von Ken Follett. Literaturwissenschaftliche Analyse von Spannungserzeugung, Erzähler, Figurenkonzeption, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68772