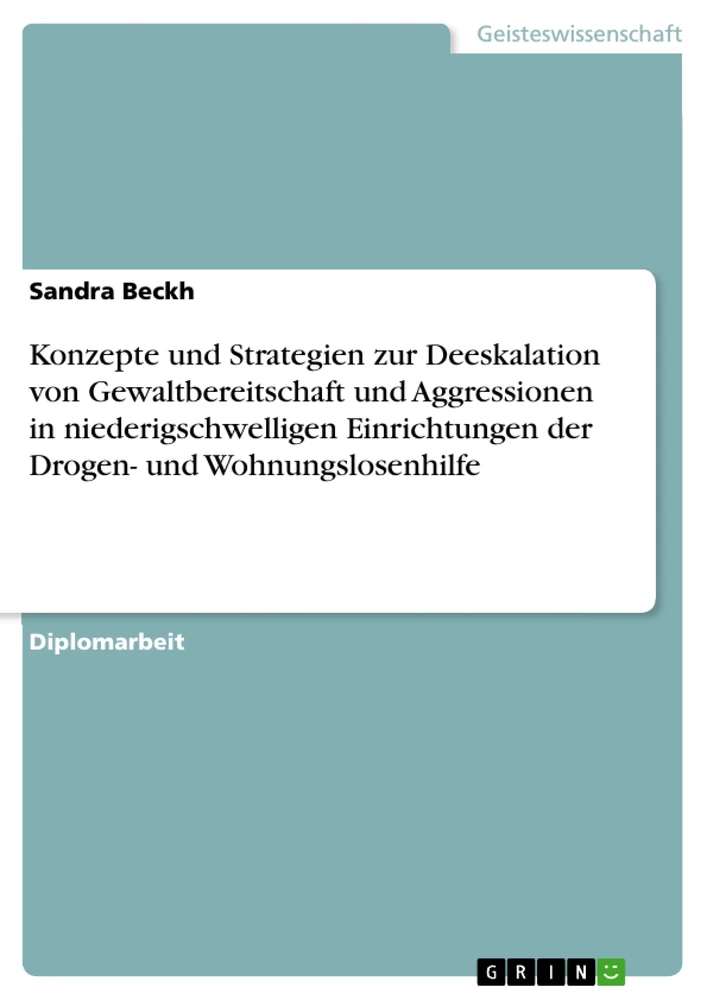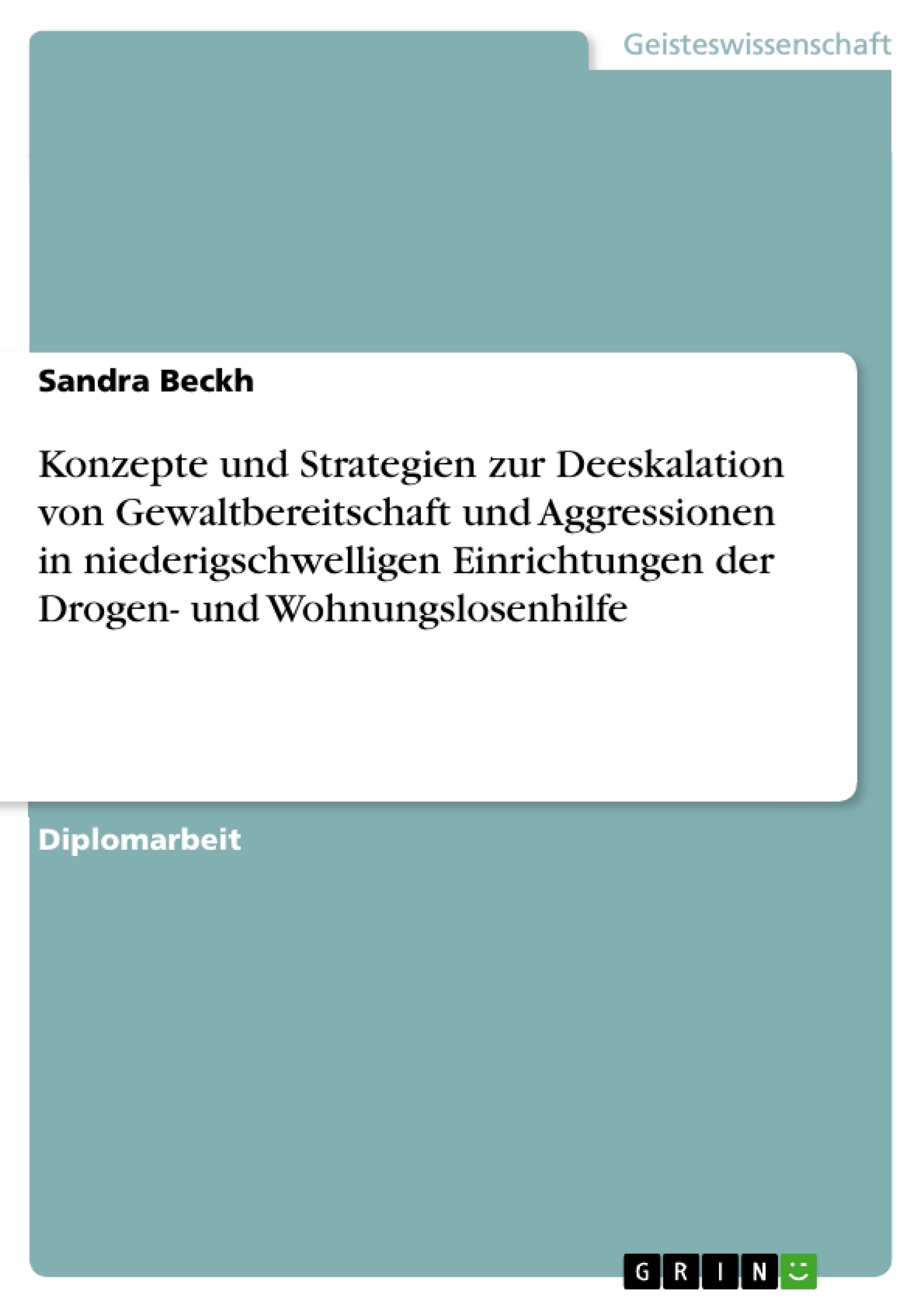Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche Strategien und Konzepte es zur Prävention von Gewalttätigkeit in niedrigschwelligen Einrichtungen der Sucht- und Wohnungslosenhilfe gibt und stellt Techniken vor, die in eskalierenden Situationen eingesetzt werden können.
Ein großer Teil der Arbeit beschäftigt sich mit grundlegenden Konzepten über die Entstehung von Aggressionen und aggressivem Verhalten und mit dem Ablauf von Gewalttaten. Außerdem wird auf die Auswirkungen von Erregung auf die innerpsychischen Vorgänge während eines Konfliktes und deren sichtbare Auswirkungen im Verhalten eingegangen. Auf Basis dieser Theorien wird ein Modell (das ‚Belastungsmodell’) zur Ableitung von Ansatzpunkten zur Prävention und Deeskalation entwickelt. Besonderer Wert wird auf die Darstellung der Lebenssituation des Klientels gelegt, da diese einen wichtigen Einfluss auf das Gewaltpotential darstellt.
Aus diesen Grundlagen werden zielgruppenspezifische präventive Rahmenbedingungen abgeleitet, welche sowohl die räumliche Gestaltung als auch deeskalierende Angebote beinhalten und spezielle Anforderungen an das Verhalten der Mitarbeiter stellen. Zusätzlich werden Techniken und Grundsätze für das Handeln im Konfliktfall ausführlich vorgestellt und einige Inhalte für ein Deeskalationstraining vorgeschlagen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- PROBLEMSTELLUNG
- ZIELSETZUNG
- VORGEHENSWEISE
- BEGRIFFSBESTIMMUNG
- Problematik bei der Definition
- Definitionen
- Formen aggressiven Verhaltens
- PRÄVALENZ
- GRUNDLEGENDES ÜBER AGGRESSION UND GEWALT
- MODELLE ZUR ENTSTEHUNG GEWALTTÄTIGEN VERHALTENS
- KLASSISCHE PSYCHOLOGISCHE THEORIEN
- Aggression als angeborene Verhaltensdisposition
- Aggression als Reaktion auf Umweltreize
- Aggressives Verhalten als Folge von Lernprozessen
- KLASSISCHE SOZIOLOGISCHE THEORIEN ABWEICHENDEN VERHALTENS
- Die Anomietheorie
- Subkulturtheorien
- Theorien des differentiellen Lernens
- Die Theorie der Neutralisierungstechniken
- Die Etikettierungstheorie (labeling approach)
- Die Selbstkontrolltheorie
- SOZIALPSYCHOLOGISCHE THEORIEN
- NEUERE ANSÄTZE ZUR ERKLÄRUNG VON GEWALTTÄTIGKEIT
- GEWALT ALS KONFLIKTLÖSUNGSSTRATEGIE
- ABLAUF VON KONFLIKTEN
- Ablauf der Rechenschaftsepisode
- Die Eskalationstreppe
- SEELISCHE FAKTOREN IM KONFLIKTGESCHEHEN
- Auswirkungen von Konflikten auf die seelischen Faktoren
- Auswirkungen auf das Verhalten, dessen Funktionen und Effekte
- GEWALTTATEN UNTER DEM ASPEKT DER EMOTIONALEN ERREGUNG
- Biologische Basics und Erregungsindikatoren
- Differenzierung aggressiven Verhaltens anhand der beteiligten Erregung
- ABLAUF VON GEWALTTATEN
- VORAUSSETZUNGEN FÜR GEWALT
- DER ABLAUF GEWALTSAMER VORFÄLLE
- Die Angriffsphasen
- Warnhinweise auf die Eskalationsphase
- Zusammenfassung
- MÖGLICHE ANSÄTZE ZUR DEESKALATION
- DIE LEBENSSITUATION DES KLIENTELS & DEREN AUSWIRKUNGEN AUF DAS GEWALTPOTENTIAL
- DIE LEBENSSITUATION DER ZIELGRUPPE
- AUSWIRKUNGEN DER LEBENSREALITÄT AUF DIE GEWALTBEREITSCHAFT
- ZUSAMMENFASSENDE WERTUNG
- FOLGERUNGEN & HANDLUNGSANWEISUNGEN FÜR DIE PRAXIS
- PRÄVENTION DURCH GESTALTUNG DER RAHMENBEDINGUNGEN
- PRÄVENTION ALS AUFGABE DER MITARBEITER
- STRATEGIEN FÜR DEN KONFLIKTFALL
- ANSÄTZE FÜR EIN DEESKALATIONSTRAINING
- SCHLUSSGEDANKEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Prävention von Gewalttätigkeit in niedrigschwelligen Einrichtungen der Sucht- und Wohnungslosenhilfe. Sie untersucht Strategien und Konzepte zur Vermeidung von Gewalt und stellt Techniken vor, die in eskalierenden Situationen eingesetzt werden können.
- Die Arbeit analysiert Modelle zur Entstehung von Aggression und gewalttätigem Verhalten.
- Sie beleuchtet den Ablauf von Gewalttaten und die Rolle von emotionaler Erregung.
- Die Arbeit untersucht die Lebenssituation der Zielgruppe und deren Einfluss auf das Gewaltpotential.
- Sie entwickelt präventive Rahmenbedingungen und Handlungsstrategien für Mitarbeiter im Konfliktfall.
- Die Arbeit beinhaltet Ansätze für ein Deeskalationstraining.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik von Gewalt in niedrigschwelligen Einrichtungen der Sucht- und Wohnungslosenhilfe dar und beschreibt die Zielsetzung und Vorgehensweise der Arbeit. Sie definiert den Begriff „Aggression“ und erläutert Formen aggressiven Verhaltens. In Kapitel 2 werden verschiedene Modelle zur Entstehung von gewalttätigem Verhalten aus der Psychologie und Soziologie vorgestellt. Kapitel 3 untersucht Gewalt als Konfliktlösungstrategie, wobei der Ablauf von Konflikten und die Auswirkungen von Konflikten auf die seelischen Faktoren und das Verhalten beleuchtet werden. Kapitel 4 befasst sich mit dem Ablauf von Gewalttaten und identifiziert Voraussetzungen und Phasen gewaltsamer Vorfälle. Kapitel 5 stellt verschiedene Ansätze zur Deeskalation vor. In den Kapiteln 6 bis 8 wird die Lebenssituation der Zielgruppe (Drogensüchtige und Wohnungslose) und deren Einfluss auf das Gewaltpotential untersucht. Kapitel 9 und 10 befassen sich mit Präventionsmaßnahmen durch Gestaltung der Rahmenbedingungen und durch das Verhalten der Mitarbeiter. Kapitel 11 beschreibt Strategien für den Konfliktfall und Kapitel 12 gibt Ansätze für ein Deeskalationstraining.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Gewalt, Deeskalation, Sucht- und Wohnungslosenhilfe, Deeskalationstraining und Deeskalationsstrategien.
- Quote paper
- Sandra Beckh (Author), 2005, Konzepte und Strategien zur Deeskalation von Gewaltbereitschaft und Aggressionen in niederigschwelligen Einrichtungen der Drogen- und Wohnungslosenhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68763