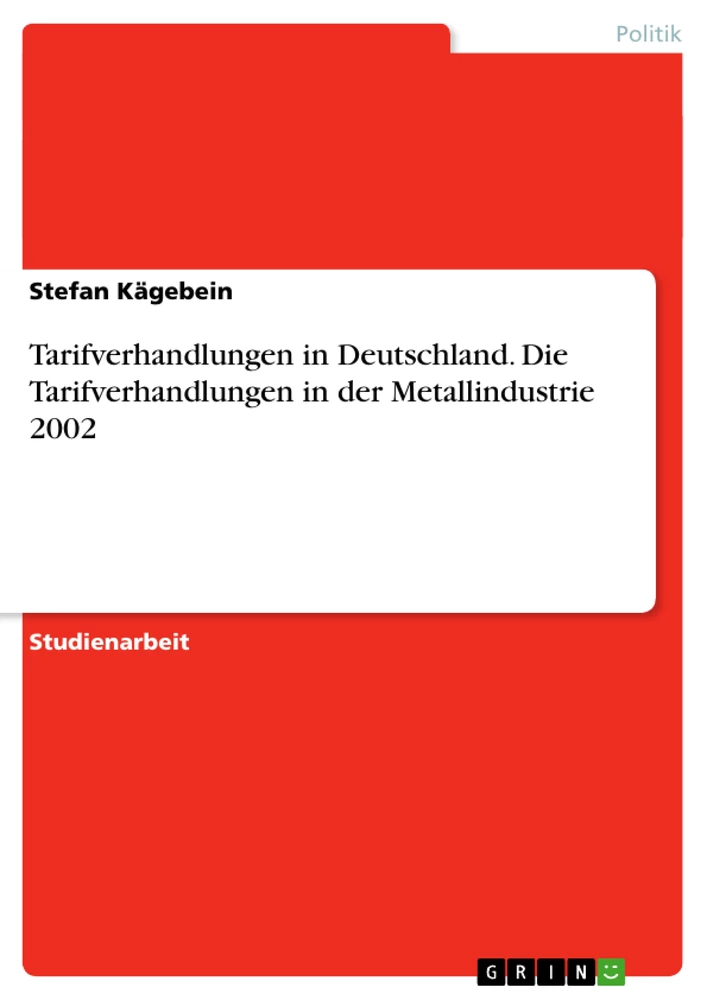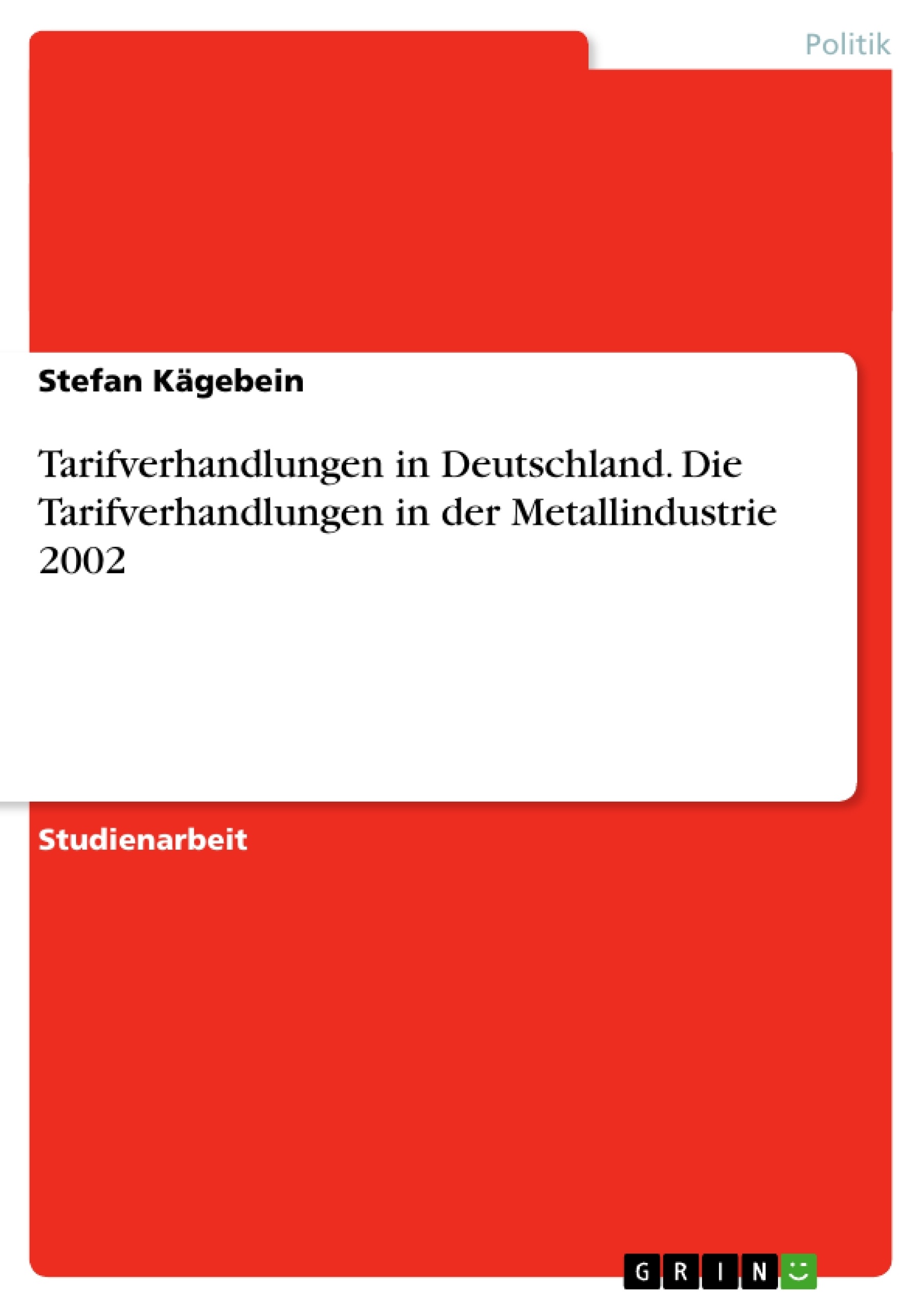Der Unterschied zwischen Arbeit und Kapital, zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, ist seit der Industrialisierung im 18. und 19. Jahrhundert vorhanden. Dieser Unterschied, also die verschiedenen Besitzverhältnisse an Produktionsmitteln, ist seit dem ein stetiger Anlass von Konflikten gewesen. Welche friedlich oder auch mit Gewalt ausgetragen wurden.
Die Schwierigkeit, die die Frage nach der Verteilung von Gewinnen aufwirft, steht auch heute noch zur Diskussion. Im einundzwanzigsten Jahrhundert sind die Dimensionen jedoch andere als noch vor 200 Jahren. Handelte es sich dort weithin um sehr elementare, essentielle Dinge, die das reine Überleben sichern sollten, so sind es im späten zwanzigsten sowie im einund- zwanzigsten Jahrhundert Fragen, die sich mit der Erhaltung der bereits erstrittenen Errungen- schaften und deren Ausbau beschäftigen. Eine "Soziale Frage", wie sie in beschriebener Vergangenheit mit ihrem konkreten Inhalt zur Beantwortung stand, ist heute und in jener Form nicht mehr existent. Die ,,great transformation", wie Karl Polanyi die Wandlung hin zur Marktwirtschaft bezeichnete, und die damit verbundenen Probleme, stehen heute nicht mehr zur Debatte. Neue Aufgaben und Probleme in veränderter Form sind zu lösen. Hierfür steht das Synonym der "Neuen Sozialen Frage".
Beispielhafte Punkte einer solchen Debatte und auch Gegenstand von Tarifverhandlungen sind vielmehr Elemente wie die Frage nach mehr Verteilungsgerechtigkeit. Die Berück- sichtigung von Inflationsraten oder die Forderung, auf Grund von Lohnzurückhaltung mehr Arbeitsplätze zu schaffen, treten ebenfalls auf. Damit eng verbunden ist die Diskussion um die Kaufkrafttheorie.
Da diese Aspekte, welche nicht die einzigen sind, in Lohnverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden thematisiert werden, ist der Komplex Tarifverhandlungen Thema der folgenden Ausführungen.
In wie weit Tarifverhandlungen und somit u.a. die Lohnhöhe und die Schaffung von Arbeitsplätzen durch Auseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern sowie durch andere Rigiditäten beeinflusst werden, soll Leitfrage der folgenden Betrachtungen sein.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Vorbetrachtungen
- 1.1. geschichtlicher Hintergrund
- 1.2. Begriffe
- 2. Der Nominallohn
- 2.1. Einflüsse auf die Nominallohnhöhe
- 2.2. theoretischer Ansatz
- 3. Aktion und Reaktion
- 3.1. Kaufkrafttheorie
- 3.2. Lohnquote
- 4. Lohnverhandlungen
- 4.1. Einflussfaktoren
- 4.2. praktische Verhandlungen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Tarifverhandlungen in Deutschland, insbesondere mit den Verhandlungen in der Metallindustrie im Jahr 2002. Sie untersucht, wie diese Verhandlungen von Auseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern sowie von anderen Rigiditäten beeinflusst werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage, inwiefern Tarifverhandlungen die Lohnhöhe und die Schaffung von Arbeitsplätzen beeinflussen.
- Die Entstehung und Entwicklung von Tarifverhandlungen im Kontext der industriellen Revolution
- Die Bedeutung der Tarifautonomie und ihre Rolle im deutschen System der Arbeitsbeziehungen
- Die Einflussfaktoren auf die Nominallohnhöhe, insbesondere die Kaufkrafttheorie
- Die Rolle von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden in Tarifverhandlungen
- Die praktische Verhandlungsphase im Beispiel der Metallindustrie in Baden-Württemberg im Frühjahr 2002
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Thematik der Tarifverhandlungen vor und erläutert deren Relevanz in der heutigen Zeit. Sie stellt die Leitfrage der Arbeit und skizziert den Aufbau der Arbeit.
- Im ersten Kapitel werden die historischen Wurzeln von Tarifverhandlungen beleuchtet. Die Entstehung der Industriellen Revolution und die daraus resultierende „Soziale Frage“ werden als Ausgangspunkt für die Entstehung von Arbeitnehmervertretungen und dem System der Tarifverhandlungen betrachtet.
- Kapitel zwei fokussiert auf den Nominallohn und dessen Einflussfaktoren. Der theoretische Ansatz wird am Beispiel Deutschlands erläutert.
- Kapitel drei behandelt die Rigiditäten, die sich Gewerkschaften und Arbeitgeber selber setzen. Die Kaufkrafttheorie und die Lohnquote werden als Beispiele für diese Rigiditäten herangezogen.
- Kapitel vier untersucht die Tarifverhandlungen im Frühjahr 2002 in der M+E Industrie in Baden-Württemberg. Zunächst werden die Einflussfaktoren auf die Verhandlungen betrachtet, bevor die praktische Verhandlungsphase thematisiert wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie Tarifverhandlungen, Tarifautonomie, Nominallohn, Kaufkrafttheorie, Lohnquote, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Industrielle Revolution, Soziale Frage, Metallindustrie und Baden-Württemberg. Die Arbeit untersucht die Interaktion dieser Schlüsselbegriffe im Kontext der deutschen Arbeitsbeziehungen.
- Quote paper
- Stefan Kägebein (Author), 2002, Tarifverhandlungen in Deutschland. Die Tarifverhandlungen in der Metallindustrie 2002, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6871