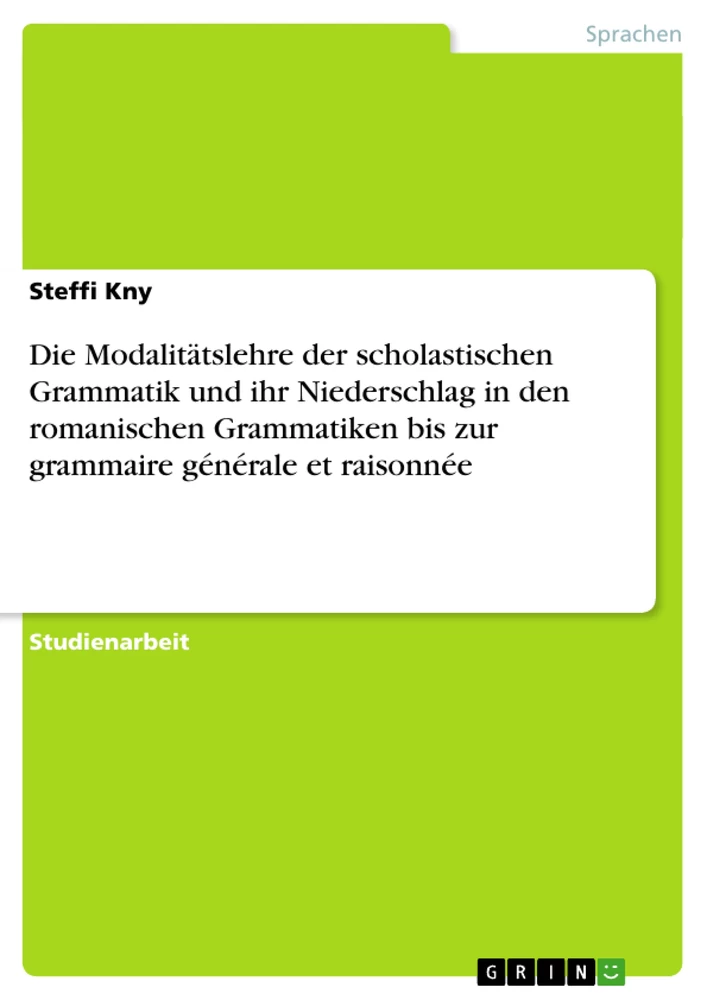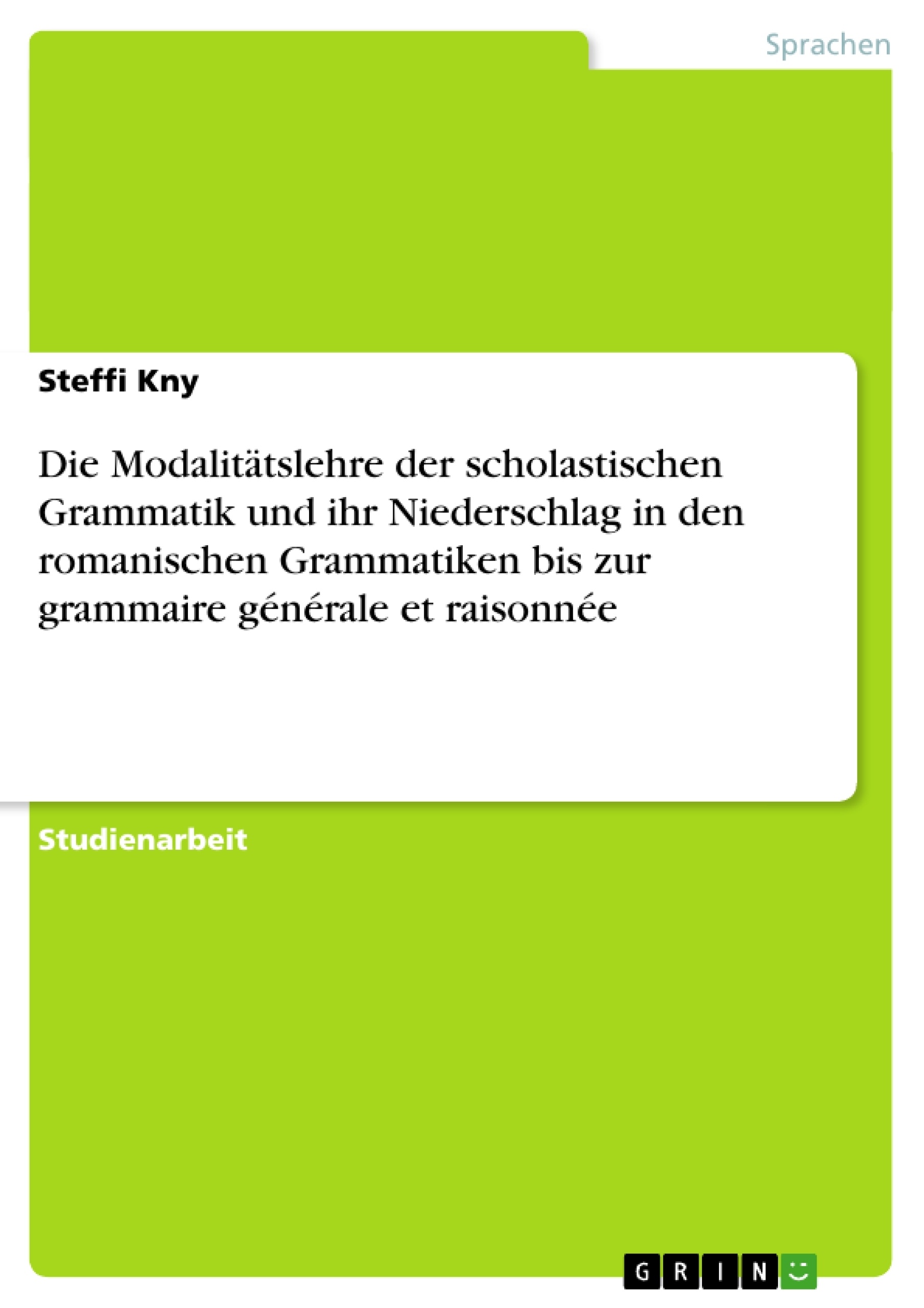Im Laufe dieses Seminars Modalität und Evidentialität in den romanischen und anderen Sprachen haben wir mehrfach Konzepte kennen gelernt, die auf knapp tausend oder zweitausend Jahre zurückgehen. So existierte das Konzept von Modalität bereits vor der Jahrtausendwende in der Modallogik des Aristoteles. Hier kann insbesondere eine Beziehung mit den alethischen Modalitäten Notwendigkeit, Möglichkeit, Kontingenz und Unmöglichkeit hergestellt werden. 1 Darüber hinaus zeigt die alethische Modalität als Modalität der Wahrheit auch an, ob eine Aussage notwendig wahr, möglich wahr, eventuell wahr oder unmöglich war ist. 2 Die Modalität von Wahrheit und Falschheit sind in der Scholastik, besonders auf theologischem Gebiet, von entscheidender Bedeutung. Auch werden diese zwei Modalitäten, bezogen auf die Aristotelische Logik, in der Arbeit über die Negation im Italienischen zum Ausgangspunkt genommen, ebenso wie die Kontradiktionsregel dargelegt wird. 3 Aristoteles unterscheidet hinsichtlich dieser vier Arten von entgegengesetzten Sätzen: konträr- Jedem und keinem zukommen, kontradiktorisch- einemund keinem zukommen sowie jedem und einem nicht zukommen und nur verbal- einemund einem nicht zukommen. Ein weiteres Mal wird sich in dieser Arbeit auf Aristoteles mit der Unterscheidung zwischen der „Negation des ganzen Prädikatsausdrucks“ und der „Negation des Prädikatstermes“ bezogen 4 , eine Unterscheidung, die besondere Bedeutung in den modalitas de re und de dicto, dem Modalitätskonzept der scholastischen Grammatiker, erlangte. In meiner Arbeit wird innerhalb des scholastischen Modalitätskonzepts vor allem auf die Modalitäten notwendig und möglich eingegangen, die auch ausführlich, bezogen auf das Englische, von Sophia Lui in ihrer Arbeit diskutiert werden. 5 Um die logische Äquivalenz der Negation der epistemischen Möglichkeit und Notwendigkeit zu erläutern, stellt sie einen Teil des logischen Quadrats 6 dar, welches Aristoteles zur Erklärung von Aussagen mit Modalfunktoren und deren Negation aufgestellt hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Überblick über die Sprachphilosophie in der Scholastik
- Die Suppositionslehre
- Satzanalyse der Logik
- Modalitas de re und modalitas de dicto
- Die Lehre der Modisten
- Die Weiterführung der Modalitätslehre in den romanischen Grammatiken
- Italienische Grammatikschreibung
- Spanische Grammatikschreibung
- Französische Grammatikschreibung bis zur Grammaire générale et raisonnée
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Tradition und Geschichte der scholastischen Grammatik und deren Einfluss auf die Grammatikschreibung der romanischen Sprachen Italienisch, Spanisch und Französisch bis zur Grammaire générale et raisonnée. Sie analysiert die scholastischen Konzepte von Modalität, Suppositionslehre, Satzanalyse und die Lehre der Modisten sowie deren Weiterentwicklung in den romanischen Grammatiken.
- Die Modalitätslehre der scholastischen Grammatik
- Die Entwicklung der Sprachphilosophie in der Scholastik
- Die Suppositionslehre und Satzanalyse der Logik
- Die Lehre der Modisten als Höhepunkt mittelalterlicher Grammatiktheorien
- Die Fortführung der Modalitätslehre in den romanischen Grammatiken
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Modalität und Evidentialität ein und stellt den historischen Kontext der Scholastischen Grammatik vor. Sie zeigt die Relevanz der Modalität im Bereich der Logik und Philosophie und erläutert ihre Bedeutung für die Sprachwissenschaft.
- Historischer Überblick über die Sprachphilosophie in der Scholastik: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Entwicklung der Sprachphilosophie innerhalb der Scholastik, von der Frühscholastik über die Hochscholastik bis zur Spätscholastik. Es betont die Verbindung von Sprache und Logik als zentrale Einheit der mittelalterlichen Sprachphilosophie und diskutiert die Bedeutung der Grammatik als Grundlage der Artes liberales.
- Die Suppositionslehre: Dieses Kapitel befasst sich mit der Suppositionslehre, einem wichtigen Konzept der Scholastischen Grammatik. Es untersucht die verschiedenen Arten der Supposition und ihre Rolle in der Interpretation von Sätzen.
- Satzanalyse der Logik: Dieses Kapitel erläutert die logische Satzanalyse der Scholastischen Grammatik. Es zeigt, wie Sätze analysiert und interpretiert werden können, um ihre logische Struktur zu verstehen.
- Modalitas de re und modalitas de dicto: Dieses Kapitel beleuchtet das Modalitätskonzept der Scholastischen Grammatik, das zwischen Modalität de re und Modalität de dicto unterscheidet. Es erklärt diese beiden Modalitäten und ihre Bedeutung für die Interpretation von Sätzen.
- Die Lehre der Modisten: Dieses Kapitel befasst sich mit der Lehre der Modisten, einer bedeutenden Gruppe mittelalterlicher Grammatiker. Es stellt ihre Lehre dar und erläutert ihre Beiträge zur Entwicklung der Grammatiktheorie.
- Die Weiterführung der Modalitätslehre in den romanischen Grammatiken: Dieses Kapitel untersucht, wie die Konzepte der Scholastischen Grammatik, insbesondere die Modalitätslehre, in den frühen Grammatiken der romanischen Sprachen Italienisch, Spanisch und Französisch aufgenommen und weiterentwickelt wurden. Es analysiert die Grammatikschreibung dieser Sprachen bis zur Grammaire générale et raisonnée.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themengebiete dieses Textes sind: Modalität, Evidentialität, Scholastische Grammatik, Sprachphilosophie, Suppositionslehre, Satzanalyse, Modalitas de re, Modalitas de dicto, Lehre der Modisten, Romanische Grammatiken, Grammaire générale et raisonnée, Italienisch, Spanisch, Französisch.
- Quote paper
- Steffi Kny (Author), 2006, Die Modalitätslehre der scholastischen Grammatik und ihr Niederschlag in den romanischen Grammatiken bis zur grammaire générale et raisonnée, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68408