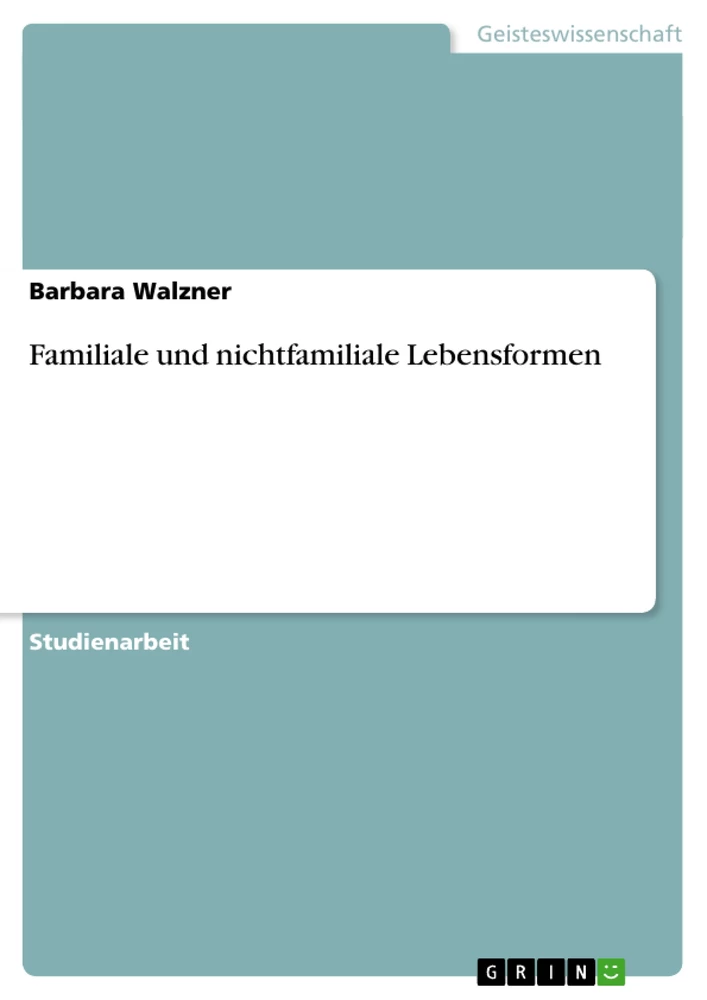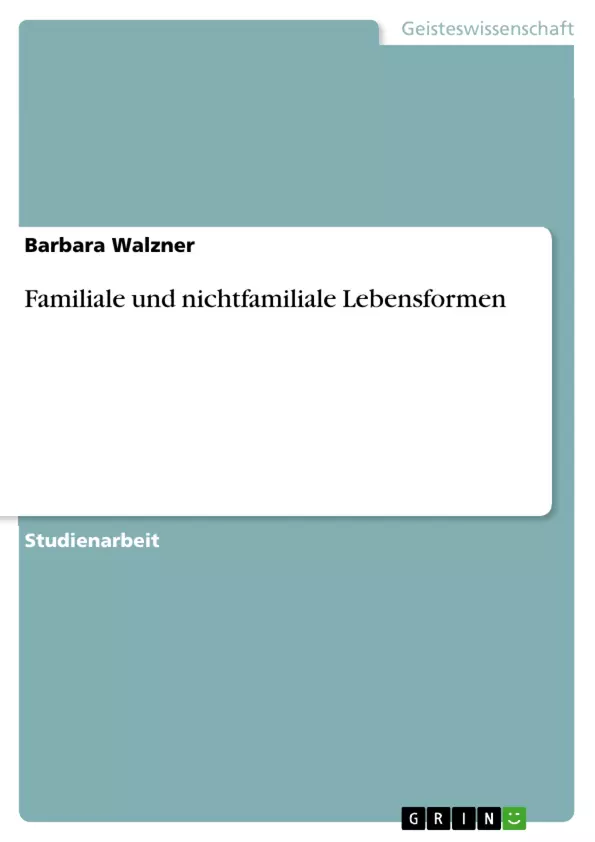Um sich mit familialen und nichtfamilialen Lebensformen wissenschaftlich fundiert
auseinandersetzen zu können, sollte man sich zu Beginn mit den Hauptschlagwörtern in
diesem Themenfeld vertraut machen. Das erste wichtige Stichwort in diesem Zusammenhang
lautet „Ehe". Sie „ist im allgemeinen und juristischen Verständnis eine Lebensgemeinschaft
von Mann und Frau, die über die Form des Zusammenlebens hinaus nach traditionaler und
universaler Auffassung zwei grundlegende Funktionen hat: den Geschlechtsverkehr zu
legalisieren und an seine möglichen Folgen, die Geburt von Kindern, Verpflichtungen zu
knüpfen"; (Schäfers 1998, S. 127) so ist sie auch im BGB in ihren Voraussetzungen, Folgen
und Scheidungsmöglichkeiten gesetzlich geregelt.
Der zweite zu definierende Begriff ist die „Familie“, was gar nicht so einfach ist, zumal es
eine große kulturelle und historische Pluralität der Familienformen gibt. „Im weitesten Sinn
ist die Familie eine nach Geschlecht und Generationen differenzierte Kleingruppe mit einem
spezifischen Kooperations- und wechselseitigem Solidaritätsverhältnis, dessen Begründung
in allen Gesellschaften zeremoniell begangen wird." (Meyer: in Geißler 1996, S. 306) Familie
im engeren Sinn ist jene Lebensgemeinschaft, in der Erwachsene sich der Erziehung von
i.d.R. leiblichen Kindern und Jugendlichen widmen. (vgl. Schäfers 1998, S. 127) Im weiteren
Sinn zählen zu einer Familie auch die Großeltem. In modernen Industriegesellschaften
herrscht der Familientyp der Kern- bzw. der Kleinfamilie vor. „Diese wird gebildet aus der
auf der Ehe gründenden und auf zwei Generationen beschränkten Gefühlsgemeinschaft der
Eltern mit ihren Kindern.“ (Meyer: in Geißler 1996, S. 306) Allerdings entspricht dieser
Familientyp der sog. „Normalfamilie“ nicht mehr der gegenwärtigen Realität: Demografische
Werte zeigen, dass Ehe und Familie seit einiger Zeit einem Wandel unterworfen sind. Im
Folgenden soll genauer auf diesen Wandel und die verschiedenen nichtfamilialen
Lebensformen eingegangen werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Begriffsdefinitionen Ehe und Familie
- 2 Wandel der Familie in Struktur und Funktion
- 3 Bedeutung und Funktion der Familie
- 3.1 Übereinstimmung oder Auseinanderdriften in Ost- und Westdeutschland?
- 3.2 Bundesrepublik Deutschland
- 3.3 Deutsche Demokratische Republik
- 4 Demographischer Strukturwandel der Familie
- 4.1 Geburtenentwicklung
- 4.2 Ursachen des Geburtenrückgangs
- 4.3 Eheschließungen und -scheidungen
- 5 Pluralisierung der Ehe- und Familienformen
- 5.1 Alleinlebende und Singles
- 5.2 Nichteheliche Lebensgemeinschaften
- 5.3 Kinderlose Ehen
- 5.4 Einelternfamilien
- 5.5 Andere alternative Lebensformen
- 6 Veränderungen innerhalb des Familienlebens
- 7 Erklärungsansätze
- 8 Bilanz und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel von Ehe- und Familienformen in Deutschland, sowohl im Hinblick auf deren Struktur als auch deren Funktion. Sie beleuchtet die historischen Entwicklungen und die demografischen Veränderungen, die die Pluralisierung der Lebensmodelle beeinflusst haben. Die Analyse umfasst sowohl die Bundesrepublik Deutschland als auch die Deutsche Demokratische Republik und deren jeweilige gesellschaftliche Einflüsse.
- Begriffsdefinitionen von Ehe und Familie
- Wandel der Familienstruktur und -funktion im Laufe der Zeit
- Bedeutung und Funktion der Familie in Ost- und Westdeutschland
- Demographischer Wandel und seine Auswirkungen auf Familienstrukturen
- Pluralisierung der Ehe- und Familienformen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Begriffsdefinitionen Ehe und Familie: Das Kapitel legt die Grundlage für die weitere Analyse, indem es die Begriffe "Ehe" und "Familie" präzise definiert. Es beleuchtet unterschiedliche Perspektiven auf die Ehe, sowohl aus juristischer als auch aus soziologischer Sicht, und beschreibt die traditionellen Funktionen der Ehe. Die Definition des Begriffs "Familie" wird ebenfalls differenziert betrachtet, wobei zwischen enger und weiterem Sinn unterschieden wird. Die verschiedenen Familienformen und deren historische und kulturelle Pluralität werden angesprochen, um ein fundiertes Verständnis für die Komplexität des Themas zu schaffen. Die Definitionen schaffen die notwendige terminologische Klarheit für die folgenden Kapitel.
2 Wandel der Familie in Struktur und Funktion: Dieses Kapitel beschreibt die Transformation der Familie von der vorindustriellen Zeit bis in das 20. Jahrhundert. Es analysiert den Übergang von der Familie als wirtschaftlicher und sozialer Einheit zur modernen Kernfamilie und die damit verbundenen Veränderungen in den Funktionen der Familie. Die "Privatisierung der Familie" wird als ein bedeutender Aspekt des Wandels hervorgehoben, mit der Abgabe von traditionellen Aufgaben wie Produktion und Ausbildung an außerfamiliäre Institutionen. Der Einfluss der Industrialisierung und die Entwicklung des bürgerlichen Familientyps werden detailliert erläutert. Das Kapitel verdeutlicht die zunehmende Pluralisierung der Familienformen, schon lange vor der Moderne.
3 Bedeutung und Funktion der Familie: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung und Funktion von Ehe und Familie in Ost- und Westdeutschland. Es vergleicht und kontrastiert die jeweiligen staatlichen Ideologien und deren Einfluss auf die Familienstrukturen. Obwohl beide Systeme die Familie als gesellschaftliche Grundinstitution betrachteten, unterschied sich der Grad ihrer Einbindung in politische und ideologische Zielsetzungen deutlich. In der Bundesrepublik lag der Fokus auf dem privaten Charakter der Familie, während in der DDR die Familie stärker in die sozialistischen Zielsetzungen des Staates eingebunden war. Das Kapitel hebt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Systeme hervor, indem es die sozio-kulturelle Funktion der Familie als zentralen Aspekt hervorhebt, der in beiden Systemen eine große Rolle spielte.
4 Demographischer Strukturwandel der Familie: Dieses Kapitel analysiert den demografischen Wandel, der die Familie beeinflusst. Es untersucht die Geburtenentwicklung, die Ursachen des Geburtenrückgangs und die Entwicklung der Eheschließungen und -scheidungen. Die Veränderungen in diesen demografischen Kennzahlen sind eng mit dem Wandel der Familienstruktur und -funktion verbunden und zeigen die Herausforderungen, vor denen die Familie im modernen Kontext steht. Durch die Analyse dieser demografischen Daten werden die Veränderungen der Familienstrukturen und die damit einhergehenden gesellschaftlichen Auswirkungen verdeutlicht.
5 Pluralisierung der Ehe- und Familienformen: Dieses Kapitel widmet sich der wachsenden Vielfalt an Ehe- und Familienformen. Es untersucht verschiedene Lebensmodelle wie Alleinlebende, nichteheliche Lebensgemeinschaften, kinderlose Ehen und Einelternfamilien. Die Analyse zeigt die zunehmende Akzeptanz und Verbreitung alternativer Lebensformen und deren Auswirkungen auf die traditionellen Familienstrukturen. Das Kapitel beleuchtet die vielfältigen Gründe für diese Pluralisierung und deren gesellschaftliche Implikationen. Es geht über die reine Beschreibung der Vielfalt hinaus und betont die gesellschaftlichen und individuellen Faktoren, die zu dieser Entwicklung beitragen.
6 Veränderungen innerhalb des Familienlebens: (Der Text enthält keine weiteren detaillierten Informationen zu diesem Kapitel, sodass hier keine Zusammenfassung erstellt werden kann.)
7 Erklärungsansätze: (Der Text enthält keine weiteren detaillierten Informationen zu diesem Kapitel, sodass hier keine Zusammenfassung erstellt werden kann.)
Schlüsselwörter
Ehe, Familie, Familienwandel, Demografie, Pluralisierung, Lebensformen, Industrialisierung, Ostdeutschland, Westdeutschland, Sozialisation, Familienpolitik, bürgerliche Familie, Kernfamilie, sozio-kulturelle Funktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text über den Wandel von Ehe- und Familienformen in Deutschland
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text analysiert den Wandel von Ehe- und Familienformen in Deutschland, sowohl in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) als auch in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Er untersucht die Veränderungen in der Struktur und Funktion von Familien im Laufe der Zeit, berücksichtigt demografische Entwicklungen und beleuchtet die Pluralisierung der Lebensmodelle.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text umfasst folgende Themen: Begriffsdefinitionen von Ehe und Familie, Wandel der Familienstruktur und -funktion, Bedeutung und Funktion der Familie in Ost- und Westdeutschland, demografischer Strukturwandel (Geburtenentwicklung, Eheschließungen, Scheidungen), Pluralisierung der Ehe- und Familienformen (Alleinlebende, nichteheliche Lebensgemeinschaften, kinderlose Ehen, Einelternfamilien), Veränderungen innerhalb des Familienlebens, Erklärungsansätze für den Wandel.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit Begriffsdefinitionen und einer Darstellung des Wandels von Ehe und Familie über die Zeit. Es folgen Kapitel zur Bedeutung und Funktion der Familie in Ost- und Westdeutschland, zum demografischen Wandel und zur Pluralisierung der Familienformen. Die letzten Kapitel befassen sich mit Veränderungen innerhalb des Familienlebens und Erklärungsansätzen für die beobachteten Entwicklungen.
Welche Zeiträume werden betrachtet?
Der Text betrachtet den Wandel von Ehe und Familie von der vorindustriellen Zeit bis ins 20. Jahrhundert und vergleicht die Entwicklungen in der BRD und der DDR.
Welche Aspekte des demografischen Wandels werden untersucht?
Der Text analysiert die Geburtenentwicklung, die Ursachen des Geburtenrückgangs, die Entwicklung der Eheschließungen und Scheidungen und deren Auswirkungen auf die Familienstrukturen.
Welche Arten von Familien werden betrachtet?
Der Text untersucht neben der traditionellen Kernfamilie auch alternative Familienformen wie Alleinlebende, nichteheliche Lebensgemeinschaften, kinderlose Ehen und Einelternfamilien.
Wie werden die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland berücksichtigt?
Der Text vergleicht und kontrastiert die Entwicklungen in Ost- und Westdeutschland, indem er die jeweiligen staatlichen Ideologien und deren Einfluss auf die Familienstrukturen berücksichtigt. Er hebt Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Bedeutung und Funktion der Familie in beiden Systemen hervor.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Textinhalt?
Schlüsselwörter sind: Ehe, Familie, Familienwandel, Demografie, Pluralisierung, Lebensformen, Industrialisierung, Ostdeutschland, Westdeutschland, Sozialisation, Familienpolitik, bürgerliche Familie, Kernfamilie, sozio-kulturelle Funktion.
Gibt es Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel?
Ja, der Text enthält Kapitelzusammenfassungen für die Kapitel 1 bis 5. Die Kapitel 6 und 7 enthalten im vorliegenden Textauszug keine detaillierten Informationen und konnten daher nicht zusammengefasst werden.
- Citation du texte
- Barbara Walzner (Auteur), 2002, Familiale und nichtfamiliale Lebensformen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6822