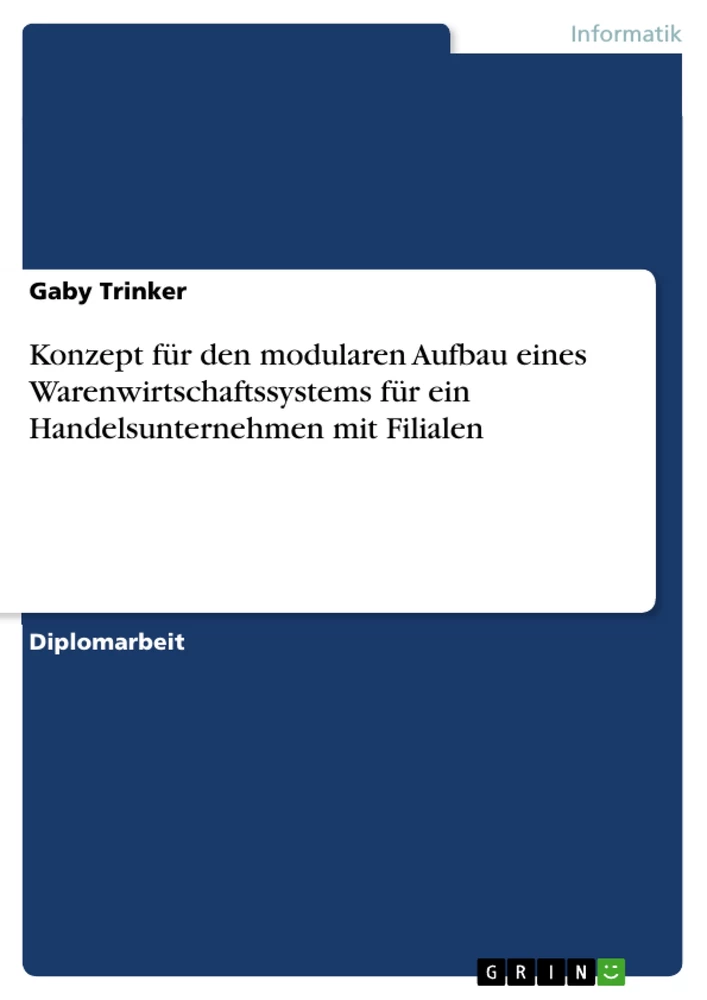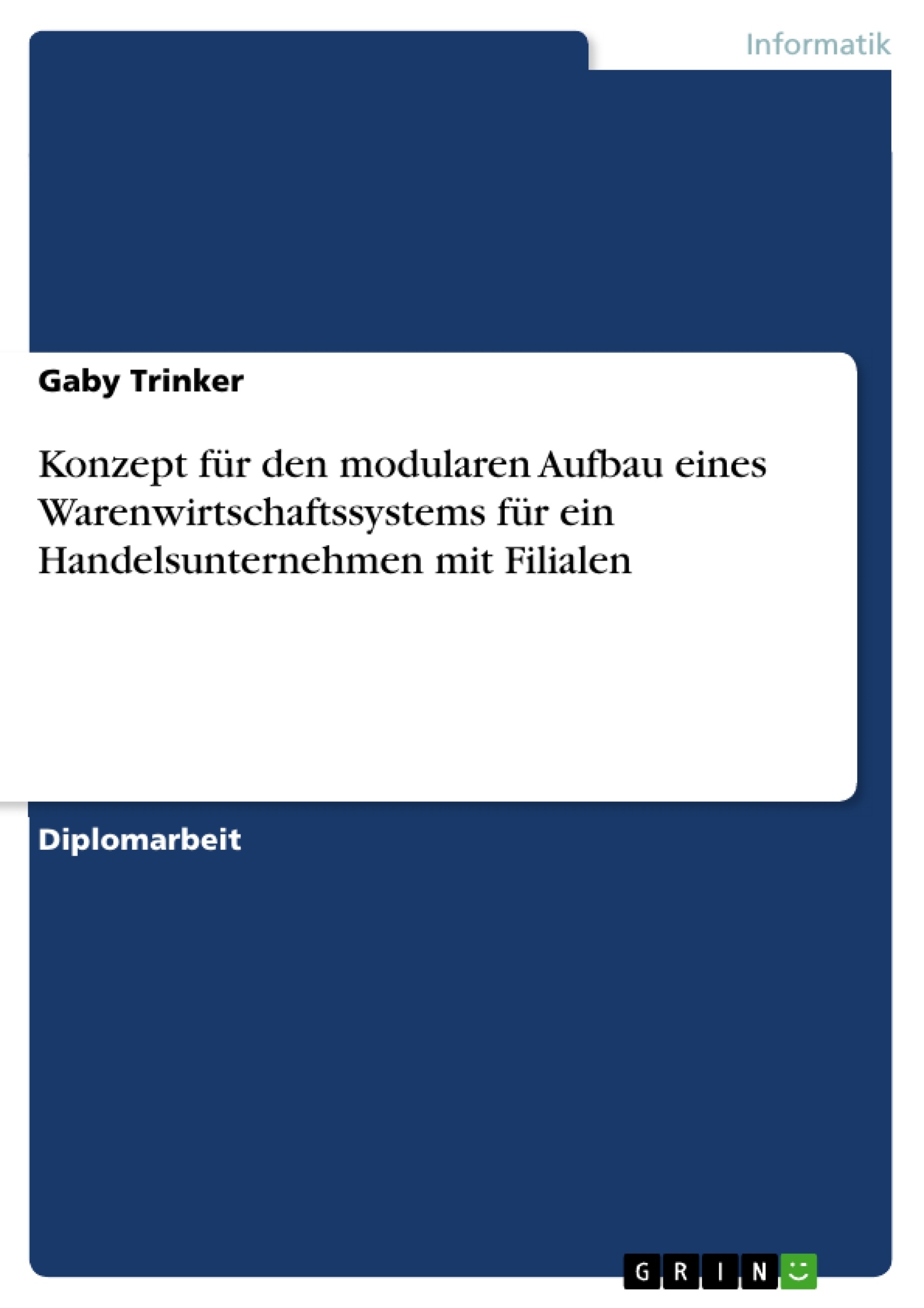Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird ein Vorgehensmodell für die Konzeption eines neuen Warenwirtschaftssystems mit modularem Aufbau erarbeitet. Grundprinzip dieses Modells ist Vereinfachung durch Vereinheitlichung. Nachdem in der Einführung das Problem der heutigen Warenwirtschaftssysteme mit den dazuführenden Ursachen geschildert wurde, wird in Kapitel 2 die zentrale Entscheidung „Make or Buy“ diskutiert. In Kapitel 3 werden die für das Verständnis der Arbeit notwendigen Begriffsabgrenzungen vorgenommen, das in dieser Arbeit verwendete Referenzmodell und Konzepte zur Vereinheitlichung vorgestellt, die einen wesentlichen Beitrag zur Vereinfachung des Systems leisten. Kapitel 4 geht allgemein auf den Entwurf einer modularen Software-Architektur ein. Als Erstes werden die Begriffe Modul und Software-Architektur abgegrenzt. Danach werden wichtige Prinzipien der Modulbildung und der Modul Guide als Hilfsmittel bei Entwurf und Dokumentation vorgestellt In Kapitel 5 werden einzelne Konzepte aus Kapitel 3 überarbeitet und neue Konzepte hinzugefügt mit dem Ziel, das Warenwirtschaftssystem weiter zu vereinfachen. Die Vorgehensweise bei der Modularisierung wird in Kapitel 6 erarbeitet. Dazu wird die Grundlage für den Entwurf bestimmt und modulare Entwurfsmethoden und mögliche Ansätze für das Vorgehensmodell diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Hinführung zum Thema
- 1.2 Ausgangssituation
- 1.3 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2 Die Entscheidung „Make or Buy“
- 2.1 Geeignete Standardwarenwirtschaftssysteme
- 2.1.1 Festlegung der Kriterien für die Auswahl
- 2.1.2 Betrachtung der Marktanalyse bezüglich der Kriterien
- 2.1.3 Analyse
- 2.2 Standardsoftware versus Eigenentwicklung
- 2.2.1 Vor- und Nachteile des Erwerbs von Standardsoftware
- 2.2.2 Vor- und Nachteile der Eigenentwicklung
- 2.2.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 2.1 Geeignete Standardwarenwirtschaftssysteme
- 3 Grundlagen zu Warenwirtschaftssystemen
- 3.1 Einleitung
- 3.2 Begriffsabgrenzungen
- 3.2.1 Der Begriff des Warenwirtschaftssystems
- 3.2.2 Der Begriff des Referenzmodells
- 3.3 Das Handels-H-Modell
- 3.4 Das Prinzip „Vereinfachung durch Vereinheitlichung“ nach Hertel
- 3.4.1 Die Grundidee
- 3.4.2 Das Konstrukt der operativen Einheiten
- 3.4.3 Offenheit des Systems durch strikte Orientierung an Normen
- 3.4.4 Das Zwei-Ebenen-Konzept
- 3.4.5 Das Baukastenkonzept
- 4 Modularisierung und Software-Architekturen
- 4.1 Begriffsabgrenzungen
- 4.1.1 Der Begriff Modul
- 4.1.2 Der Begriff Software-Architektur
- 4.2 Prinzipien der Modulbildung
- 4.2.1 Geheimnisprinzip (Information Hiding)
- 4.2.2 Balance zwischen Kopplung und Kohäsion
- 4.2.3 Beziehungen zwischen Modulen
- 4.3 Der Modul Guide
- 4.3.1 Der graphische Modul Guide
- 4.3.2 Der Modul Guide als Tabelle
- 4.1 Begriffsabgrenzungen
- 5 Weitere Konzepte zur Vereinheitlichung
- 5.1 Einführende Überlegungen
- 5.2 Erweiterung des Konzeptes der operativen Einheiten nach Hertel um externe Marktpartner
- 5.2.1 Vor- und Nachteile der Erweiterung
- 5.2.2 Unterschiede zwischen internen und externen operativen Einheiten
- 5.2.3 Beziehungen operativer Einheiten zu Prozessen
- 5.2.4 Gemeinsamkeiten aller Arten operativer Einheiten
- 5.2.5 Das Konstrukt der operativen Einheiten im Überblick
- 5.3 Vergleich des Beschaffungsprozesses mit dem Distributionsprozess
- 5.3.1 Der Beschaffungsprozess
- 5.3.2 Der Distributionsprozess
- 5.3.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei Beschaffungs- und Distributionsprozess
- 5.3.4 Schlussfolgerung
- 5.4 Mandantenfähigkeit der Funktionsbereiche der operativen Einheiten
- 5.4.1 Der Begriff der Mandantenfähigkeit
- 5.4.2 Mandantenabwicklung in den Funktionsbereichen der operativen Einheiten
- 5.4.3 Mandantenfähige Prozesse
- 5.4.4 Bedeutung der Mandantenfähigkeit für die Datenhaltung
- 6 Auswahl der Vorgehensweise für den Entwurf
- 6.1 Abgrenzung des Vorgehensmodells von gängigen Vorgehensmodellen
- 6.2 Die Grundlage für den Entwurf
- 6.3 Modulare Entwurfsmethoden
- 6.3.1 Top-Down-Entwurf
- 6.3.2 Bottom-Up-Entwurf
- 6.3.3 Top-Down-Entwurf versus Bottom-Up-Entwurf
- 6.3.4 Die geeignete Entwurfsmethode für das Warenwirtschaftssystem
- 6.4 Mögliche Ansätze für das Vorgehensmodell
- 6.4.1 Einstieg über das Konzept „Das Konstrukt der operativen Einheiten“
- 6.4.2 Einstieg über das Konzept „Vergleich des Beschaffungsprozesses mit dem Distributionsprozess“
- 6.4.3 Bewertung der beiden Vorgehensweisen
- 7 Das Vorgehensmodell für den Entwurf des Warenwirtschaftssystems
- 7.1 Einleitung
- 7.2 Teil 1 – Erstellung der Teilentwürfe
- 7.2.1 Schritt 1: Anwendung des Konzeptes „Vergleich des Beschaffungsprozesses mit dem Distributionsprozess“
- 7.2.2 Schritt 2: Anwendung des Konzeptes „Das Konstrukt der operativen Einheiten“
- 7.2.3 Schritt 3: Anwendung des Konzeptes „Mandantenfähigkeit der Funktionsbereiche der operativen Einheiten“
- 7.2.4 Schritt 4: Anwendung des Konzeptes „Das Zwei-Ebenen-Konzept“
- 7.2.5 Schritt 5: Erstellung des graphischen Modul Guide zu beiden Teilsystemen
- 7.3 Teil 2 – Erstellung des Gesamtentwurfs
- 7.3.1 Schritt 1: Erstellung des tabellarischen Modul Guide für das Gesamtsystem
- 7.3.2 Schritt 2: Entwurf der anderen Geschäftsprozesse
- 7.3.3 Schritt 3: Bestimmung der Modulschnittstellen
- 7.3.4 Schritt 4: Ergänzung der Beziehungstypen im graphischen Modul Guide
- 7.3.5 Schritt 5: Erstellung der ER-Modelle
- 8 Anwendung des Vorgehensmodells
- 8.1 Einleitung
- 8.2 Teil 1: Erstellung der Teilentwürfe
- 8.2.1 Schritt 1: Anwendung des Konzeptes „Vergleich des Beschaffungsprozesses mit dem Distributionsprozess“
- 8.2.2 Schritt 2: Anwendung des Konzeptes „Das Konstrukt der operativen Einheiten“
- 8.2.3 Schritt 3: Anwendung des Konzeptes „Mandantenfähigkeit der Funktionsbereiche der operativen Einheiten“
- 8.2.4 Schritt 4: Anwendung des Konzeptes „Das Zwei-Ebenen-Konzept“
- 8.2.5 Schritt 5: Erstellung des graphischen Modul Guide zu beiden Teilsystemen
- 8.3 Teil 2: Erstellung des Gesamtentwurfs
- 8.3.1 Schritt 1: Erstellung des tabellarischen Modul Guide für das Gesamtsystem
- 8.3.2 Schritt 2: Entwurf der anderen Geschäftsprozesse
- 8.3.3 Schritt 3: Bestimmung der Modulschnittstellen
- 8.3.4 Schritt 4: Ergänzung der Beziehungstypen im graphischen Modul Guide
- 8.3.5 Schritt 5: Erstellung der ER-Modelle
- 9 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 9.1 Die Ergebnisse des Vorgehensmodells
- 9.1.1 Umsetzung der vorgestellten Konzepte
- 9.1.2 Erreichung höherer Flexibilität und geringerer Komplexität durch das Vorgehensmodell
- 9.1.3 Erfüllung allgemeiner Forderungen an Vorgehensmodelle
- 9.2 Gegenüberstellung der Eigenentwicklung nach dem Vorgehensmodell und dem Erwerb von Standardsoftware
- 9.2.1 Nachteile der Eigenentwicklung nach dem Vorgehensmodell gegenüber dem Erwerb von Standardsoftware
- 9.2.2 Vorteile der Eigenentwicklung nach dem Vorgehensmodell gegenüber dem Erwerb von Standardsoftware
- 9.2.3 Fazit
- 9.3 Kostenersparnis durch das Vorgehensmodell
- 9.1 Die Ergebnisse des Vorgehensmodells
- 10 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit entwickelt ein Vorgehensmodell für den modularen Aufbau eines Warenwirtschaftssystems für ein Handelsunternehmen mit Filialen. Das Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Steigerung der Flexibilität im Vergleich zu bestehenden Systemen.
- Make or Buy Entscheidung bei der Softwareentwicklung
- Modularisierung und Software-Architekturen
- Vereinfachung durch Vereinheitlichung von Prozessen
- Konzept der operativen Einheiten (intern und extern)
- Mandantenfähigkeit des Warenwirtschaftssystems
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Arbeit beschreibt die Herausforderungen komplexer, historisch gewachsener Warenwirtschaftssysteme und formuliert das Ziel, ein Vorgehensmodell für die Entwicklung eines flexibleren und weniger komplexen Systems zu schaffen. Der Fokus liegt auf einem Handelsunternehmen mit Filialen in verschiedenen Branchen.
2 Die Entscheidung „Make or Buy“: Dieses Kapitel analysiert die Vor- und Nachteile des Kaufs von Standardsoftware (insbesondere ERP-Systeme) im Vergleich zur Eigenentwicklung. Es wird gezeigt, dass ERP-Systeme zwar technologisch fortschrittlich sind, aber hohe Anpassungskosten und Abhängigkeiten vom Anbieter verursachen können. Die Eigenentwicklung wird aufgrund der spezifischen Anforderungen des Unternehmens bevorzugt.
3 Grundlagen zu Warenwirtschaftssystemen: Das Kapitel klärt grundlegende Begriffe wie Warenwirtschaftssystem und Referenzmodell. Es beschreibt das Handels-H-Modell als Referenzmodell und erläutert Hertels Prinzip der „Vereinfachung durch Vereinheitlichung“, das auf Konzepten wie dem Konstrukt operativer Einheiten und dem Zwei-Ebenen-Konzept basiert.
4 Modularisierung und Software-Architekturen: Das Kapitel definiert Modul und Software-Architektur und beschreibt wichtige Prinzipien der Modulbildung wie das Geheimnisprinzip (Information Hiding) und die Balance zwischen Kopplung und Kohäsion. Der Modul Guide wird als Hilfsmittel zur Strukturierung und Dokumentation vorgestellt.
5 Weitere Konzepte zur Vereinheitlichung: Das Kapitel erweitert Hertels Konzept der operativen Einheiten um externe Marktpartner und vergleicht detailliert den Beschaffungs- und den Distributionsprozess. Die Mandantenfähigkeit der Funktionsbereiche operativer Einheiten wird als wichtiges Konzept zur Vereinfachung und Flexibilisierung eingeführt.
6 Auswahl der Vorgehensweise für den Entwurf: Dieses Kapitel beschreibt den Entwurfsprozess und grenzt das gewählte Vorgehensmodell von gängigen Softwareentwicklungsmodellen ab. Es vergleicht Top-Down- und Bottom-Up-Entwurfsmethoden und wählt eine kombinierte Vorgehensweise für den Entwurf des Warenwirtschaftssystems.
7 Das Vorgehensmodell für den Entwurf des Warenwirtschaftssystems: Hier wird das detaillierte Vorgehensmodell für den Entwurf des Warenwirtschaftssystems präsentiert. Es gliedert sich in zwei Teile: die Erstellung der Teilentwürfe und die Erstellung des Gesamtentwurfs. Jeder Teil enthält mehrere Schritte, die die Anwendung der in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Konzepte umfassen.
8 Anwendung des Vorgehensmodells: Dieses Kapitel illustriert das Vorgehensmodell anhand konkreter Beispiele aus verschiedenen Teilsystemen des Warenwirtschaftssystems. Es wird detailliert gezeigt, wie die Konzepte in der Praxis angewendet werden und welche Ergebnisse erzielt werden können.
Schlüsselwörter
Warenwirtschaftssystem, Modularisierung, Software-Architektur, Referenzmodell, Handels-H-Modell, Vereinfachung durch Vereinheitlichung, Operative Einheiten, Mandantenfähigkeit, Zwei-Ebenen-Konzept, Beschaffungsprozess, Distributionsprozess, Modul Guide, Eigenentwicklung, Softwareentwicklungsmethoden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Vorgehensmodell für den modularen Aufbau eines Warenwirtschaftssystems
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Vorgehensmodells für den modularen Aufbau eines Warenwirtschaftssystems für ein Handelsunternehmen mit Filialen. Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Steigerung der Flexibilität des Systems im Vergleich zu bestehenden Lösungen.
Welche Entscheidung wird zu Beginn der Arbeit getroffen?
Zu Beginn wird die „Make or Buy“-Entscheidung analysiert. Es werden die Vor- und Nachteile des Kaufs von Standardsoftware (z.B. ERP-Systeme) gegenüber einer Eigenentwicklung untersucht. Die Entscheidung fällt letztendlich zugunsten einer Eigenentwicklung aufgrund spezifischer Anforderungen des Unternehmens.
Welche Konzepte werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Konzepte, darunter Modularisierung, Software-Architekturen, Hertels Prinzip der „Vereinfachung durch Vereinheitlichung“, das Konstrukt der operativen Einheiten (intern und extern), die Mandantenfähigkeit des Warenwirtschaftssystems, das Handels-H-Modell als Referenzmodell und das Zwei-Ebenen-Konzept.
Was ist das Ziel des Vorgehensmodells?
Das Ziel des entwickelten Vorgehensmodells ist die Schaffung eines flexibleren und weniger komplexen Warenwirtschaftssystems. Dies wird durch die modulare Architektur und die Anwendung der beschriebenen Konzepte erreicht. Die Reduktion von Komplexität und die Steigerung der Flexibilität stehen im Vordergrund.
Welche Methoden der Modulbildung werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt wichtige Prinzipien der Modulbildung, wie das Geheimnisprinzip (Information Hiding) und die Balance zwischen Kopplung und Kohäsion. Der Modul Guide wird als Hilfsmittel zur Strukturierung und Dokumentation vorgestellt. Es werden Top-Down- und Bottom-Up-Entwurfsmethoden verglichen und eine kombinierte Vorgehensweise gewählt.
Wie wird das Vorgehensmodell angewendet?
Das Vorgehensmodell wird in zwei Teilen angewendet: Die Erstellung von Teilentwürfen (basierend auf Konzepten wie dem Vergleich von Beschaffungs- und Distributionsprozessen, dem Konstrukt der operativen Einheiten und der Mandantenfähigkeit) und die Erstellung des Gesamtentwurfs (inkl. Modulschnittstellenbestimmung, Erstellung des Modul Guides und ER-Modelle).
Welche Vorteile bietet die Eigenentwicklung gegenüber Standardsoftware?
Die Arbeit analysiert die Vor- und Nachteile der Eigenentwicklung gegenüber dem Erwerb von Standardsoftware. Die Eigenentwicklung bietet Vorteile hinsichtlich der Anpassbarkeit an spezifische Unternehmensanforderungen und der Vermeidung von Abhängigkeiten von Softwareanbietern. Die Kostenersparnis durch das entwickelte Vorgehensmodell wird ebenfalls untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter zur Beschreibung der Arbeit sind: Warenwirtschaftssystem, Modularisierung, Software-Architektur, Referenzmodell, Handels-H-Modell, Vereinfachung durch Vereinheitlichung, Operative Einheiten, Mandantenfähigkeit, Zwei-Ebenen-Konzept, Beschaffungsprozess, Distributionsprozess, Modul Guide, Eigenentwicklung, Softwareentwicklungsmethoden.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, gefolgt von Kapiteln zur „Make or Buy“-Entscheidung, Grundlagen zu Warenwirtschaftssystemen, Modularisierung und Software-Architekturen, weiteren Konzepten zur Vereinheitlichung, der Auswahl der Vorgehensweise für den Entwurf, dem Vorgehensmodell selbst, seiner Anwendung, einer Zusammenfassung der Ergebnisse und einem Ausblick.
- Quote paper
- Gaby Trinker (Author), 2005, Konzept für den modularen Aufbau eines Warenwirtschaftssystems für ein Handelsunternehmen mit Filialen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67987