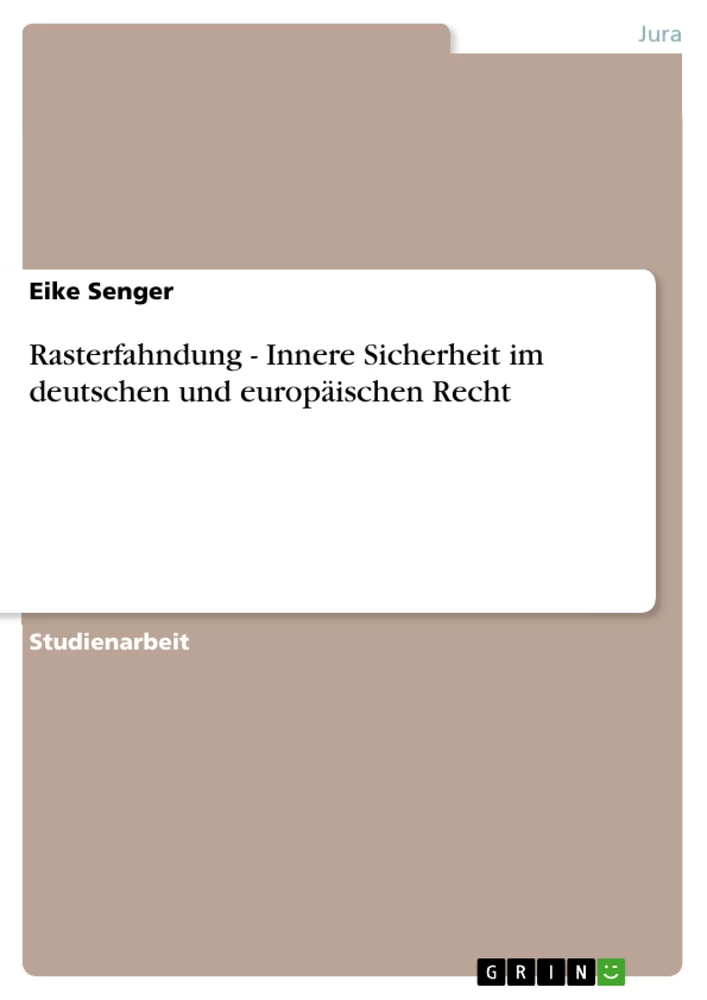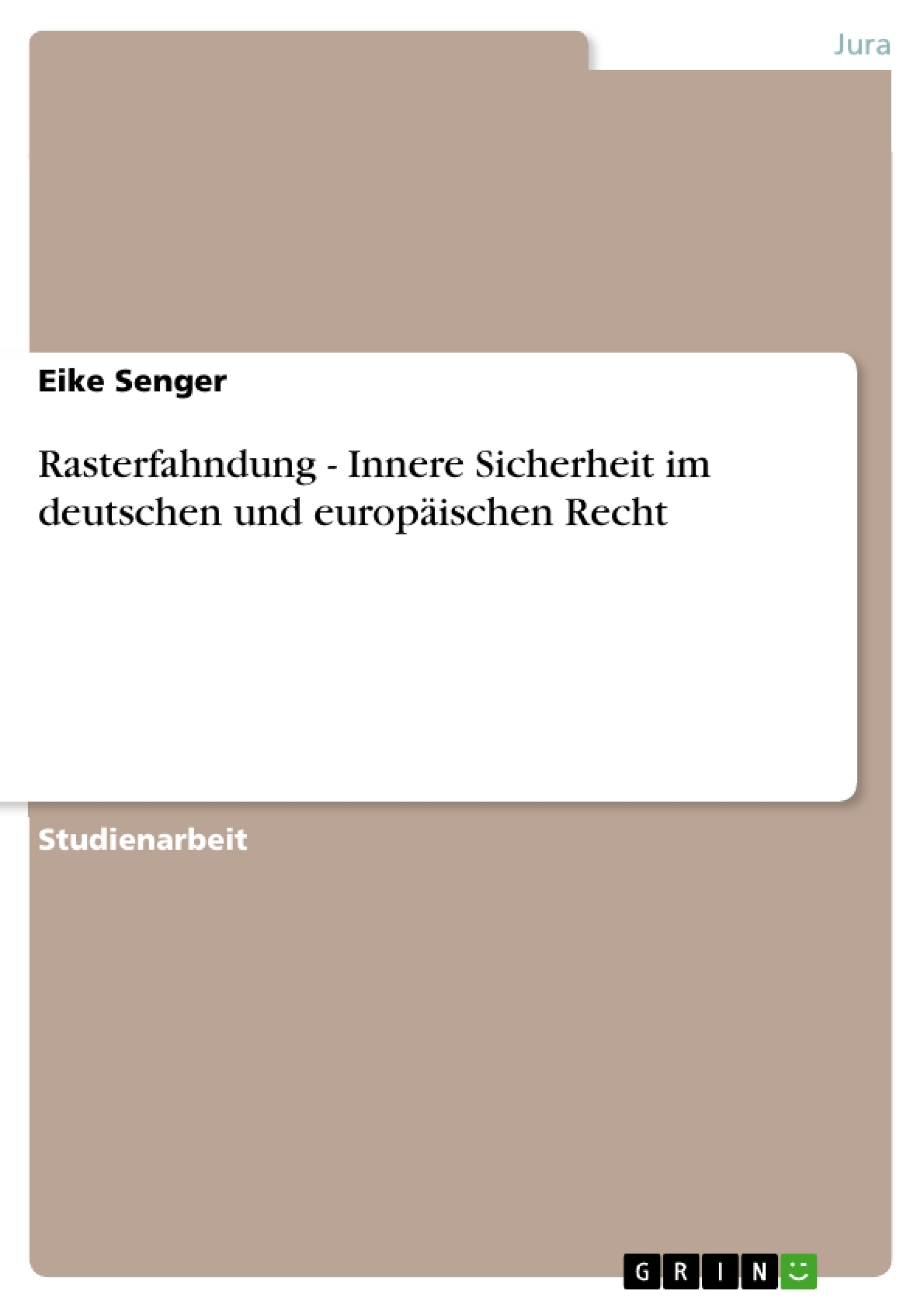Die Rasterfahndung wurde in den sechziger Jahren von Bundeskriminalamt (BKA) entwickelt und in den siebziger Jahren zur Bekämpfung des RAF Terrors erprobt. Nun findet sie im Zuge des 11. Septembers erneut Anwendung.
Eine Fahndung ist die Suche nach einem bekannten oder unbekannten Täter zu Zwecke der Strafverfolgung, dies ist bei der derzeitigen Rasterfahndung jedoch nicht der Fall, ihr Ziel ist die präventive Gefahrenabwehr, somit ist der Begriff aus definitorischer Sicht ungenau. Zu unterscheiden ist zwischen der so genannten „positiven Rasterfahndung“, bei der nach Personen gesucht wird auf die bestimmte Merkmale zutreffen, sowie der „negativen Rasterfahndung“ auf die bestimmte Merkmale nicht zutreffen.
Da die Strafverfolgung im Kompetenzbereich des Bundes und die Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben zur Verhüttung künftiger Straftaten im Aufgabenbereich der Länder angesiedelt sind, „[…]unterliegen die Rechtsgrundlagen der Rasterfahndung einer gewissen Rechtszersplitterung“.
Die Arbeit diskutiert die aktuellen Erkenntnisse zur Rasterfahndung und zeigt dabei rechtsdogmatische Problemfelder auf.
Die Problemfeldanalyse geht sowohl auf die aktuelle Rechtsprechung, die gesellschaftspolitische Tragweite und die politische Bedeutung ein.
Dabei bezieht sich die Arbeit insbesondere auf die bundesweite Rasterfahndung, im Zuge des 11.Septembers.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Allgemeines zur Rasterfahndung
- Die Rasterfahndung in Folge des 11. Septembers
- Präventiv polizeilicher Bereich
- Repressiv polizeilicher Bereich
- BKA-Gesetz
- Die Rasterkriterien
- Mitteilungspflicht gegenüber den Betroffenen
- Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten
- Rechtsdogmatische Probleme und Kritikpunkte
- Verhältnismäßigkeit der Rasterfahndung
- Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 GG
- Diskussion der unterschiedlichen Tatbestandsvoraussetzungen (Gefahrenbegriffe)
- Der Richtervorbehalt als Ausdruck des effektiven (umfassenden) Rechtsschutzes aus Art. 19 Abs. 4 GG
- Rechtpolitischer Ausblick & Fazit
- Anhang
- Literatur und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rasterfahndung, insbesondere im Kontext der Ereignisse vom 11. September 2001 und deren rechtliche Implikationen. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen, die praktische Anwendung und die damit verbundenen rechtsdogmatischen Probleme und Kritikpunkte. Der Fokus liegt auf der bundesweiten Rasterfahndung und dem Abgleich mit Erfahrungen aus der Bekämpfung des RAF-Terrorismus.
- Rechtliche Grundlagen der Rasterfahndung
- Verhältnismäßigkeit und Eingriff in Grundrechte
- Diskussion unterschiedlicher Gefahrenbegriffe
- Der Richtervorbehalt und effektiver Rechtsschutz
- Gesellschaftspolitische und rechtliche Kontroversen
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort beschreibt den Hintergrund der Arbeit und dankt den Betreuern für ihre Unterstützung. Es hebt die Aktualität des Themas nach den Anschlägen vom 11. September 2001 hervor und deutet die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der rechtlichen und gesellschaftlichen Aspekte der Rasterfahndung an.
Einleitung: Die Einleitung erläutert die Einführung der Rasterfahndung nach den Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon. Sie hebt die unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen auf Bundes- und Länderebene hervor und beschreibt den Prozess der Datengewinnung und -verarbeitung, der auf länderspezifischen Polizeigesetzen beruhte. Die Einleitung betont die politischen und rechtlichen Herausforderungen im Umgang mit dieser neuen Form der präventiven Gefahrenabwehr.
Allgemeines zur Rasterfahndung: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Rasterfahndung, sowohl im präventiven als auch im repressiven Bereich. Es analysiert die Rolle des BKA-Gesetzes und die verwendeten Rasterkriterien. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten und der damit verbundenen rechtlichen Problematik. Die Ausführungen detaillieren das Verfahren der Datenerhebung und des Abgleichs durch verschiedene Behörden.
Rechtsdogmatische Probleme und Kritikpunkte: Dieser Abschnitt befasst sich eingehend mit den rechtlichen Herausforderungen der Rasterfahndung. Es werden die Fragen der Verhältnismäßigkeit, des Eingriffs in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und die unterschiedlichen Gefahrenbegriffe diskutiert. Der Richtervorbehalt als Garant für effektiven Rechtsschutz wird ausführlich analysiert und kritisch beleuchtet.
Schlüsselwörter
Rasterfahndung, Terrorismusbekämpfung, Datenschutz, Grundrechte, Verhältnismäßigkeit, Richtervorbehalt, informationelle Selbstbestimmung, präventive Gefahrenabwehr, Rechtsdogmatik, Polizeirecht, BKA, Gefahrenbegriff.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Rasterfahndung
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rasterfahndung, insbesondere im Kontext der Ereignisse vom 11. September 2001 und deren rechtliche Implikationen. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen, die praktische Anwendung und die damit verbundenen rechtsdogmatischen Probleme und Kritikpunkte. Der Fokus liegt auf der bundesweiten Rasterfahndung und dem Abgleich mit Erfahrungen aus der Bekämpfung des RAF-Terrorismus.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die rechtlichen Grundlagen der Rasterfahndung, die Verhältnismäßigkeit und den Eingriff in Grundrechte, die Diskussion unterschiedlicher Gefahrenbegriffe, den Richtervorbehalt und effektiven Rechtsschutz sowie gesellschaftspolitische und rechtliche Kontroversen. Sie umfasst einen Überblick über die Rasterfahndung im präventiven und repressiven Bereich, die Rolle des BKA-Gesetzes, die verwendeten Rasterkriterien, die Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten und die damit verbundenen rechtlichen Probleme.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in ein Vorwort, eine Einleitung, ein Kapitel zum Allgemeinen zur Rasterfahndung, ein Kapitel zu Rechtsdogmatischen Problemen und Kritikpunkten, einen rechtpolitischen Ausblick und Fazit, einen Anhang und ein Literatur- und Quellenverzeichnis. Das Kapitel "Allgemeines zur Rasterfahndung" behandelt u.a. die Rasterfahndung nach dem 11. September, den präventiven und repressiven Bereich, das BKA-Gesetz, die Rasterkriterien, die Mitteilungspflicht und die Datenverarbeitung. Das Kapitel "Rechtsdogmatische Probleme und Kritikpunkte" befasst sich mit der Verhältnismäßigkeit, dem Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, der Diskussion unterschiedlicher Gefahrenbegriffe und dem Richtervorbehalt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Rasterfahndung umfassend zu untersuchen und ihre rechtlichen Implikationen zu analysieren. Sie soll die rechtlichen Grundlagen, die praktische Anwendung und die damit verbundenen Probleme kritisch beleuchten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Rasterfahndung, Terrorismusbekämpfung, Datenschutz, Grundrechte, Verhältnismäßigkeit, Richtervorbehalt, informationelle Selbstbestimmung, präventive Gefahrenabwehr, Rechtsdogmatik, Polizeirecht, BKA, Gefahrenbegriff.
Wie wird die Rasterfahndung im Kontext des 11. Septembers behandelt?
Die Arbeit untersucht die Rasterfahndung insbesondere im Kontext der Anschläge vom 11. September 2001 und analysiert die damit verbundenen rechtlichen Implikationen und Herausforderungen.
Welche Kritikpunkte an der Rasterfahndung werden angesprochen?
Die Arbeit diskutiert kritische Punkte hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit der Rasterfahndung, des Eingriffs in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und die unterschiedlichen Gefahrenbegriffe. Der Richtervorbehalt als Garant für effektiven Rechtsschutz wird kritisch beleuchtet.
- Quote paper
- M.A. Eike Senger (Author), 2003, Rasterfahndung - Innere Sicherheit im deutschen und europäischen Recht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67912