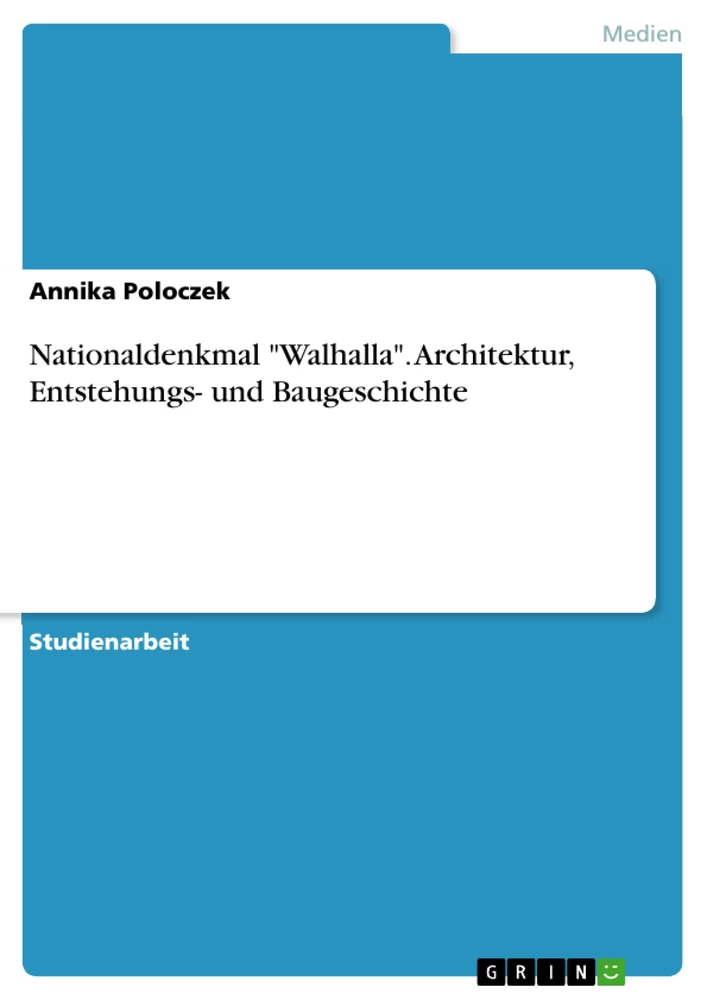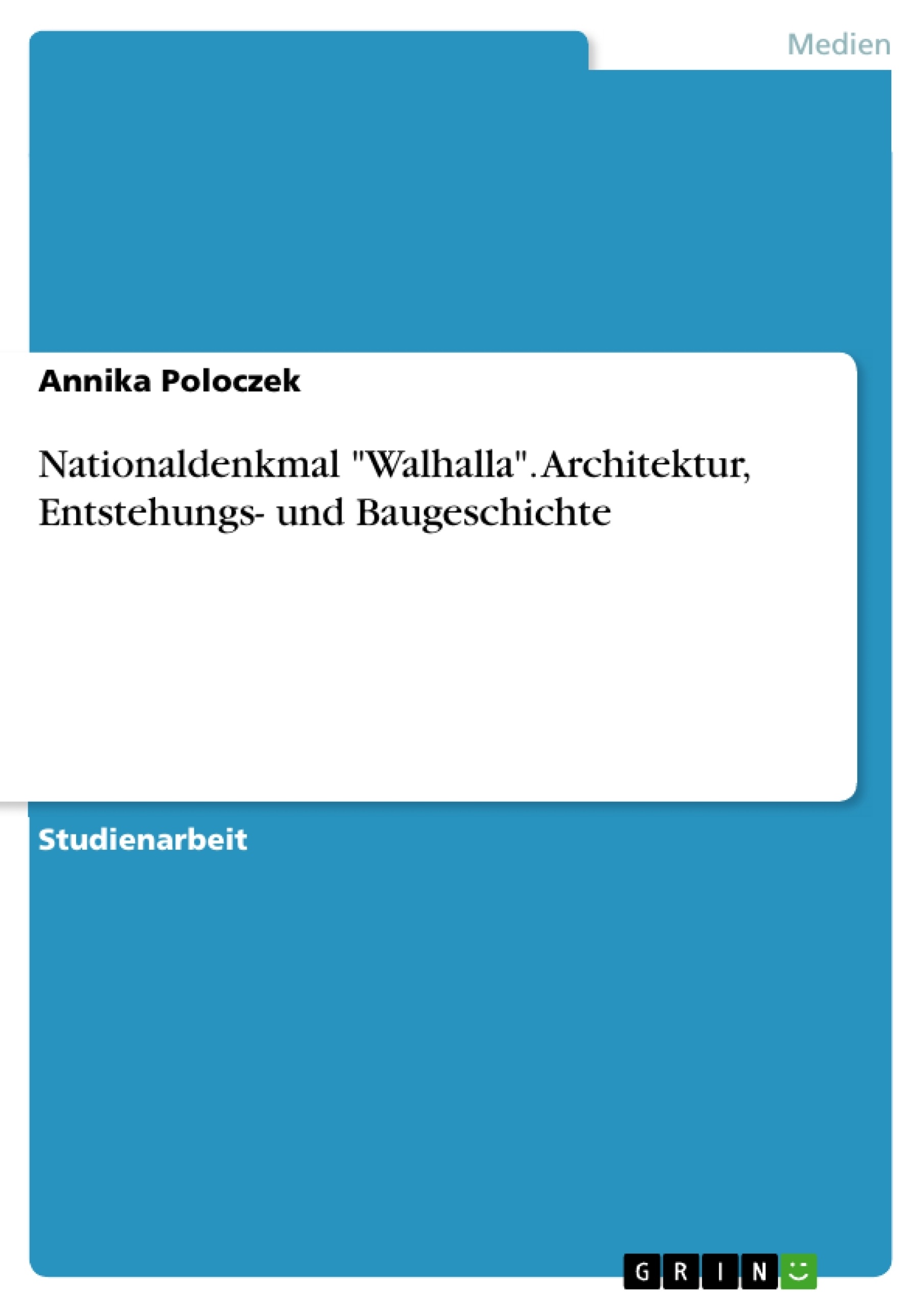Der marmorne Tempelbau der Walhalla, initiiert von König Ludwig I. von Bayern und erbaut von seinem Hofarchitekten Leo von Klenze, erhebt sich auf dem Bräuberg bei Donaustauf, einige Kilometer donauabwärts von Regensburg entfernt. Im Jahre 1830 wurde der Grundstein für den Longitudinalbau gelegt, der sich architektonisch am griechischen Parthenon, dem Tempel der Göttin der Weisheit Athene orientiert. 12 Jahre später, nach zahlreichen Plan- und Bauänderungen, wurde der Tempel zu "Ehren des Vaterlandes", der heute 126 Büsten und 64 Gedenktafeln der "rühmlich ausgezeichneten Teutschen" beherbergt, eröffnet. Die Walhalla gilt als bedeutendstes deutsches Nationaldenkmal und als „international berühmteste Schöpfung Klenzes“. Die folgende Arbeit wird auf die Entstehungs- und Baugeschichte der Walhalla eingehen, sowie auf deren architektonische Gestaltung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Denkmal
- Die Namensgebung
- Der Stil
- Die Standortwahl
- Entstehungsgeschichte
- Die ersten Entwürfe
- Die Rundbauentwürfe
- Die Halle der Erwartung
- Die Büsten
- Die Baugeschichte
- Baubeschreibung
- Außenansicht
- Innenansicht
- Ikonologie und Ikonographie
- Nachahmung oder Neuschöpfung?
- Resumee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Entstehungs- und Baugeschichte der Walhalla, einem bedeutenden deutschen Nationaldenkmal, und beleuchtet deren architektonische Gestaltung. Die Untersuchung soll die ikonologische und ikonographische Bedeutung des Bauwerks ergründen und die Frage nach der Nachahmung oder Neuschöpfung des architektonischen Werkes beleuchten.
- Die Entstehung und Entwicklung der Walhalla als Projekt zur Erinnerung an „rühmlich ausgezeichnete Teutschen“
- Die architektonische Gestaltung der Walhalla und die Rolle des dorischen Stils im Kontext des Denkmalkults des 19. Jahrhunderts
- Die ikonologische und ikonographische Interpretation des Bauwerks und seine Bedeutung als nationales Symbol
- Die kontroversen Diskussionen über die Rezeption antiker Architektur im 19. Jahrhundert und die Frage der Nachahmung oder Neuschöpfung in Bezug auf die Walhalla
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Denkmal der Walhalla vor und erläutert seine Namensgebung, seinen architektonischen Stil und die Standortwahl. Das Kapitel „Entstehungsgeschichte“ beleuchtet die ersten Entwürfe, die Entwicklung des Bauprojekts, die Auswahl der Büsten und die Bauphase. Die „Baubeschreibung“ widmet sich der Außen- und Innenansicht des Bauwerks, der ikonologischen und ikonographischen Analyse und der Frage, ob es sich bei der Walhalla um eine bloße Nachahmung antiker Architektur oder um eine Neuschöpfung handelt.
Schlüsselwörter
Walhalla, Leo von Klenze, Ludwig I. von Bayern, Nationaldenkmal, griechischer Parthenon, dorischer Stil, Ikonologie, Ikonographie, Nachahmung, Neuschöpfung, Denkmalkult, deutsche Identität, Johannes von Müller, Johann Martin von Wagner.
- Quote paper
- Annika Poloczek (Author), 2005, Nationaldenkmal "Walhalla". Architektur, Entstehungs- und Baugeschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67623