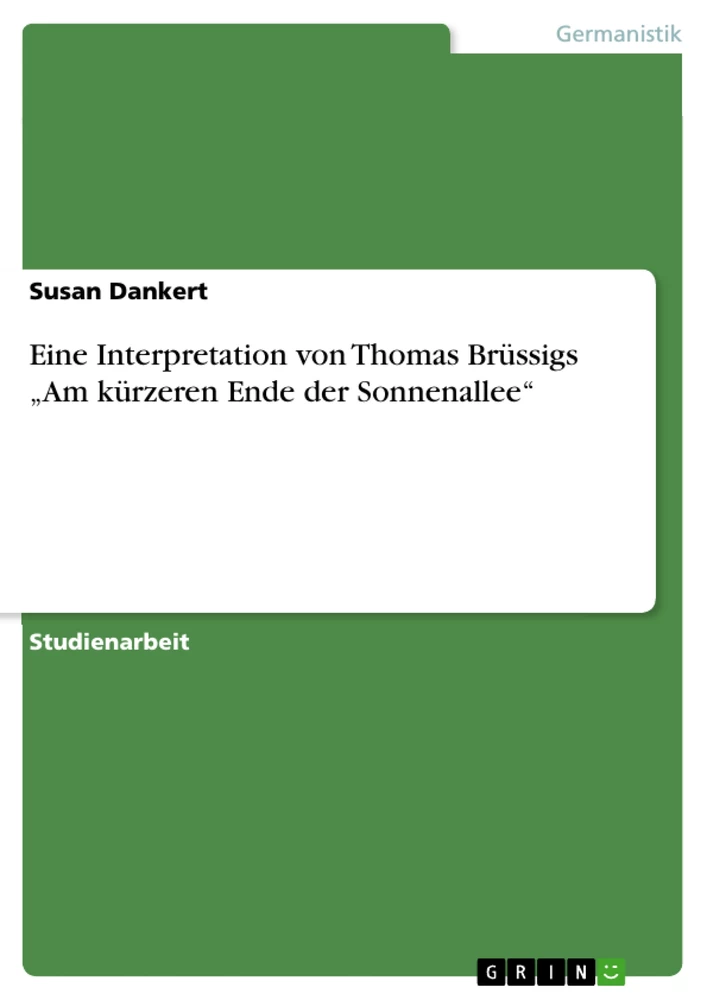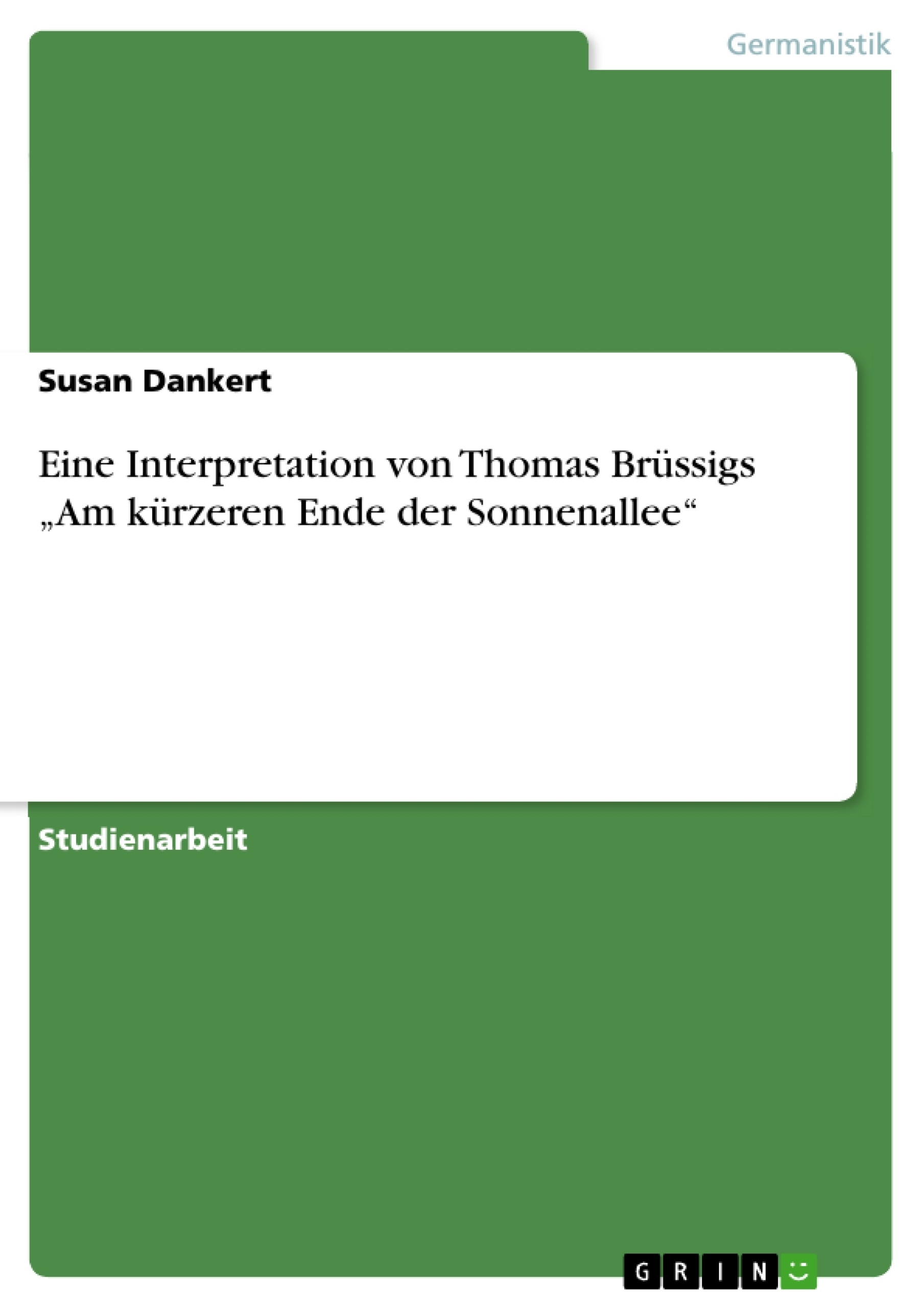Im Angesicht der momentanen politischen Diskussionen um Hartz IV, Montagsdemonstrationen etc. erlebte auch die Ost-West-Debatte erneut eine ungewöhnlich starke Brisanz. Fünfzehn Jahre nach dem Mauerfall wünscht sich jeder fünfte Deutsche die Mauer zurück - so heißt es einer Forsa-Umfrage der vergangenen Wochen zufolge. Der Stinkefinger von Bernd Görgelein (ein arbeitsloser Ostdeutscher) gen Westen wird deutschlandweit zum Symbol der aufgeladenen Stimmung. Er spricht aus, was viele denken: „[I]n der DDR waren wir glücklicher. Wenn jemand die Mauer wieder aufbauen wollte, würde ich sagen: Ja“. Da fragt man sich, was in den Köpfen der Menschen von statten geht, wenn sie einen solch absurden Wunsch äußern - wohin verschwand das kollektive Gedächtnis, wohin das Bedauern um eine Zeit der Diktatur, Mangelwirtschaft, Eingesperrtheit? Doch darin liegt das Problem - ein kollektiv - deutsches Gedächtnis zur DDR-Vergangenheit gibt es in dem Sinne nicht. Schließlich kam es nie zu einer ernsthaften Auseinandersetzung mit der jüngsten deutschen Vergangenheit und v.a. dem individuellen Versagen in der DDR-Geschichte seitens der Ostdeutschen. Stattdessen gab es auf der einen Seite Ostalgie-Shows, in denen sich die Ossis selbst feierten und die DDR in knalligem Bunt erstrahlte, während auf der anderen Seite westdeutsche Late-Night-Moderatoren das Publikum mit klischeebeladenen Ossi-Witzen erfreuten. Von Vergangenheitsbewältigung keine Spur - auf beiden Seiten redete man sich die Zeit vor dem Mauerfall schön, man wurde nostalgisch. Genau an diesem Punkt, an dem Gedächtnis aufhört und Erinnerung anfängt, knüpft Brussigs Roman Am kürzeren Ende der Sonnenallee an. Der Stoff des Buches „war ursprünglich ein Filmstoff“, d.h. Brussig schrieb zunächst (gemeinsam mit Leander Haußmann) das Drehbuch zum Film Sonnenallee und entschloss sich, den Stoff erneut im Roman zu verarbeiten. Der Film folgte den „Intentionen des Regisseurs Leander Haußmann, der auf das Kultpotenzial des Stoffes setzte (mit musicalartigen Tanzeinlagen, stilisierten Kostümen usw.)“ wobei Brussig die Erzählung im Nachhinein schrieb, um „zu untersuchen, was Nostalgie eigentlich ist“. 3 Der Rückentext von Am kürzeren Ende der Sonnenallee macht dabei dringlich auf dieses Prinzip der Lektüre aufmerksam: „Glückliche Menschen haben ein schlechtes Gedächtnis und reiche Erinnerungen“.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Literarische Form und Struktur
- Romanstruktur
- Episodische Struktur des Romans
- Erzähler und Erzählstruktur
- Fokularisierung
- Stellung des Erzählers zum Geschehen
- Erzählte Zeit und Erzählgeschwindigkeit
- Erzählgeschwindigkeit
- Erzählte Zeit
- Sprache
- Satzbau
- Umgangs- und Jugendsprache
- Dialekt und Hochdeutsch
- DDR-Wortschatz und Superlativ
- Sprache des Erzählers
- Motivation, Motivik und Intertextualität
- Motivation
- Motivik und Intertextualität
- Motivkomplex Ost-West-Problematik
- Motivkomplex "Wunsch nach Westkontakt"
- Westmusik
- Figurengebundene Motivik
- Motivkomplex Familie Kuppisch
- Analyse wichtiger "Stellen" im Roman
- Die Unmöglichkeit der Kritik
- Die Vollmondnacht
- Die Wirkung der Sonnenallee
- Das Wunder der Geburt
- Allegorische Lesart der Geburts-Episode
- Das Schlusswort
- Resumee / Interpretationsansatz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Thomas Brussigs Roman "Am kürzeren Ende der Sonnenallee" unter Berücksichtigung verschiedener literaturwissenschaftlicher Aspekte. Ziel ist es, die Romanstruktur, die Erzählperspektive, die sprachlichen Besonderheiten und die zentrale Thematik des Romans zu untersuchen und zu interpretieren.
- Die Darstellung der Lebensrealität in der DDR kurz vor dem Mauerfall
- Die Auseinandersetzung mit der Ost-West-Problematik und der damit verbundenen Nostalgie
- Die Analyse der sprachlichen Gestaltung und ihrer Bedeutung für den Roman
- Die Untersuchung der Erzählstruktur und ihrer Wirkung auf den Leser
- Die Interpretation wichtiger Szenen und Motive
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort beleuchtet den aktuellen gesellschaftlichen Diskurs um die deutsche Teilung und die anhaltende Debatte um Ostalgie. Es verortet Brussigs Roman in diesem Kontext und betont die Notwendigkeit einer differenzierten Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit, die über nostalgisierende Vereinfachungen hinausgeht. Der Roman wird als ein Versuch verstanden, das Phänomen der Nostalgie zu untersuchen und zu hinterfragen.
Literarische Form und Struktur: Dieses Kapitel analysiert die strukturellen Elemente des Romans, untersucht die episodische Struktur und die gewählte Romanform. Es untersucht wie diese die Erzählung prägen und zum Verständnis des Gesamtwerks beitragen. Die Untersuchung der Struktur gibt Aufschluss über die erzählerische Strategie und die Wirkung auf den Leser.
Erzähler und Erzählstruktur: Hier wird die Erzählperspektive und die Rolle des Erzählers im Roman untersucht. Die Analyse umfasst die Fokularisierung, die Stellung des Erzählers zum Geschehen und die Auswirkungen dieser Gestaltungsmittel auf die Interpretation des Textes. Es wird die Frage nach der Objektivität und Subjektivität der Darstellung beleuchtet.
Erzählte Zeit und Erzählgeschwindigkeit: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Verhältnis zwischen erzählter Zeit und Erzählgeschwindigkeit im Roman. Es analysiert, wie die unterschiedlichen Erzähltempi die Wirkung des Textes beeinflussen und zum Verständnis der dargestellten Ereignisse beitragen. Es wird die Funktion der Beschleunigung und Verlangsamung der Erzählung untersucht.
Sprache: Die sprachliche Gestaltung des Romans steht im Mittelpunkt dieses Kapitels. Es analysiert Satzbau, Umgangssprache, Dialekt, DDR-Wortschatz und die Sprache des Erzählers. Die Untersuchung zeigt, wie die Sprache die Charaktere, die Atmosphäre und die Thematik des Romans prägt. Die Verwendung von Jugendsprache und DDR-Slang wird im Detail untersucht.
Motivation, Motivik und Intertextualität: Dieses Kapitel befasst sich mit den zentralen Motiven des Romans, insbesondere dem Motivkomplex der Ost-West-Problematik und dem Wunsch nach Westkontakt. Es analysiert die Motivwahl und deren Funktion innerhalb der Erzählung und untersucht mögliche intertextuelle Bezüge. Die Bedeutung der Familienstrukturen und deren Einfluss auf die Handlung wird erörtert.
Analyse wichtiger "Stellen" im Roman: In diesem Kapitel werden wichtige Episoden des Romans detailliert analysiert. Es wird untersucht, wie diese Szenen die zentralen Themen und Motive des Romans verdeutlichen. Es erfolgt eine Interpretation ausgewählter Szenen und ihrer Bedeutung für das Gesamtwerk.
Schlüsselwörter
Sonnenallee, Thomas Brussig, DDR, Ostalgie, Ost-West-Problematik, Jugendkultur, Erzähltechnik, Sprache, Nostalgie, Erinnerung, Identität.
Häufig gestellte Fragen zu Thomas Brussigs "Am kürzeren Ende der Sonnenallee"
Welche Themen werden in der vorliegenden Analyse von "Am kürzeren Ende der Sonnenallee" behandelt?
Die Analyse untersucht verschiedene literaturwissenschaftliche Aspekte von Thomas Brussigs Roman "Am kürzeren Ende der Sonnenallee". Schwerpunkte sind die Romanstruktur, die Erzählperspektive (einschließlich Fokularisierung und Erzählerposition), die sprachlichen Besonderheiten (Satzbau, Umgangssprache, Dialekt, DDR-Wortschatz), die erzählte Zeit und Erzählgeschwindigkeit, sowie die zentrale Thematik des Romans, insbesondere die Darstellung der Lebensrealität in der DDR kurz vor dem Mauerfall, die Ost-West-Problematik und die damit verbundene Nostalgie. Wichtige Szenen und Motive werden detailliert interpretiert, einschließlich der Motivkomplexe Ost-West-Problematik und "Wunsch nach Westkontakt".
Welche Kapitel umfasst die Analyse und was ist ihr jeweiliger Inhalt?
Die Analyse gliedert sich in mehrere Kapitel: Ein Vorwort, das den gesellschaftlichen Kontext und die Bedeutung des Romans beleuchtet; Kapitel zur literarischen Form und Struktur, Erzähler und Erzählstruktur, erzählte Zeit und Erzählgeschwindigkeit, Sprache, Motivation, Motivik und Intertextualität, sowie eine Analyse wichtiger Stellen im Roman und ein abschließendes Resumee/Interpretationsansatz. Jedes Kapitel befasst sich mit spezifischen Aspekten des Romans und trägt zum Gesamtverständnis bei. Beispielsweise analysiert das Kapitel "Sprache" den Sprachstil, den Satzbau und die Verwendung von Jugendsprache und DDR-Slang. Das Kapitel "Motivation, Motivik und Intertextualität" untersucht zentrale Motive wie die Ost-West-Problematik und den Wunsch nach Westkontakt.
Welche methodischen Ansätze werden in der Analyse verwendet?
Die Analyse verwendet verschiedene literaturwissenschaftliche Methoden, um den Roman zu untersuchen. Sie analysiert die narrative Struktur, die Erzählperspektive, die sprachlichen Mittel und die zentralen Motive des Romans. Es werden interpretative Ansätze verwendet, um die Bedeutung der verschiedenen Elemente des Romans zu entschlüsseln und die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Aspekten aufzuzeigen. Die Analyse berücksichtigt den historischen Kontext und bezieht sich auf relevante literaturwissenschaftliche Theorien.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Roman und die Analyse?
Schlüsselwörter, die den Roman und die Analyse charakterisieren, sind: Sonnenallee, Thomas Brussig, DDR, Ostalgie, Ost-West-Problematik, Jugendkultur, Erzähltechnik, Sprache, Nostalgie, Erinnerung und Identität.
Wie wird die Ost-West-Problematik im Roman dargestellt und analysiert?
Die Ost-West-Problematik ist ein zentrales Thema des Romans und wird auf verschiedenen Ebenen analysiert. Die Analyse untersucht, wie die Sehnsucht nach dem Westen, der Wunsch nach Westkontakt (z.B. durch Westmusik) und die Erfahrungen der Protagonisten mit der DDR-Realität dargestellt werden. Der Motivkomplex "Ost-West-Problematik" wird detailliert untersucht, einschließlich der damit verbundenen Nostalgie und der komplexen Beziehungen zwischen Ost und West.
Wie wird die Sprache des Romans analysiert?
Die Analyse der Sprache des Romans konzentriert sich auf verschiedene Aspekte, einschließlich Satzbau, Umgangssprache, Dialekt (Hochdeutsch vs. DDR-Dialekt), DDR-Wortschatz und die Sprache des Erzählers. Es wird untersucht, wie die sprachliche Gestaltung die Charaktere, die Atmosphäre und die Thematik des Romans prägt. Die Verwendung von Jugendsprache und DDR-Slang wird im Detail analysiert, um deren Bedeutung für das Gesamtwerk zu ermitteln.
Welche Rolle spielt die Erzählperspektive in "Am kürzeren Ende der Sonnenallee"?
Die Analyse untersucht detailliert die Erzählperspektive und die Rolle des Erzählers im Roman. Sie analysiert die Fokularisierung, die Stellung des Erzählers zum Geschehen und die Auswirkungen dieser Gestaltungsmittel auf die Interpretation des Textes. Die Frage nach der Objektivität und Subjektivität der Darstellung wird beleuchtet und ihre Bedeutung für das Verständnis der Geschichte diskutiert.
- Quote paper
- Susan Dankert (Author), 2005, Eine Interpretation von Thomas Brüssigs „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67581