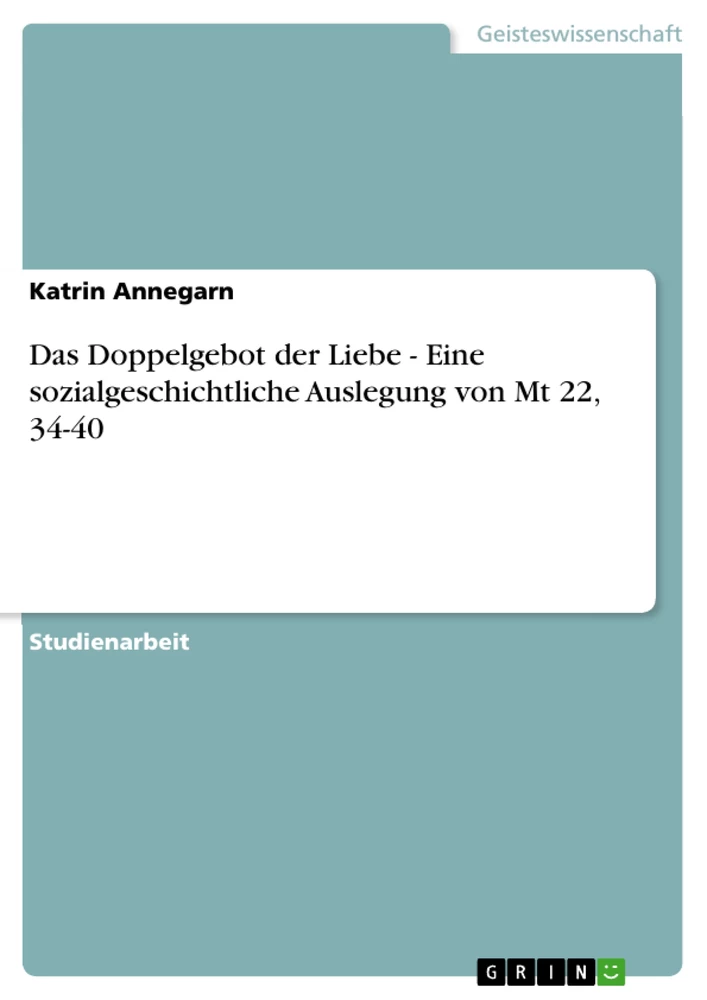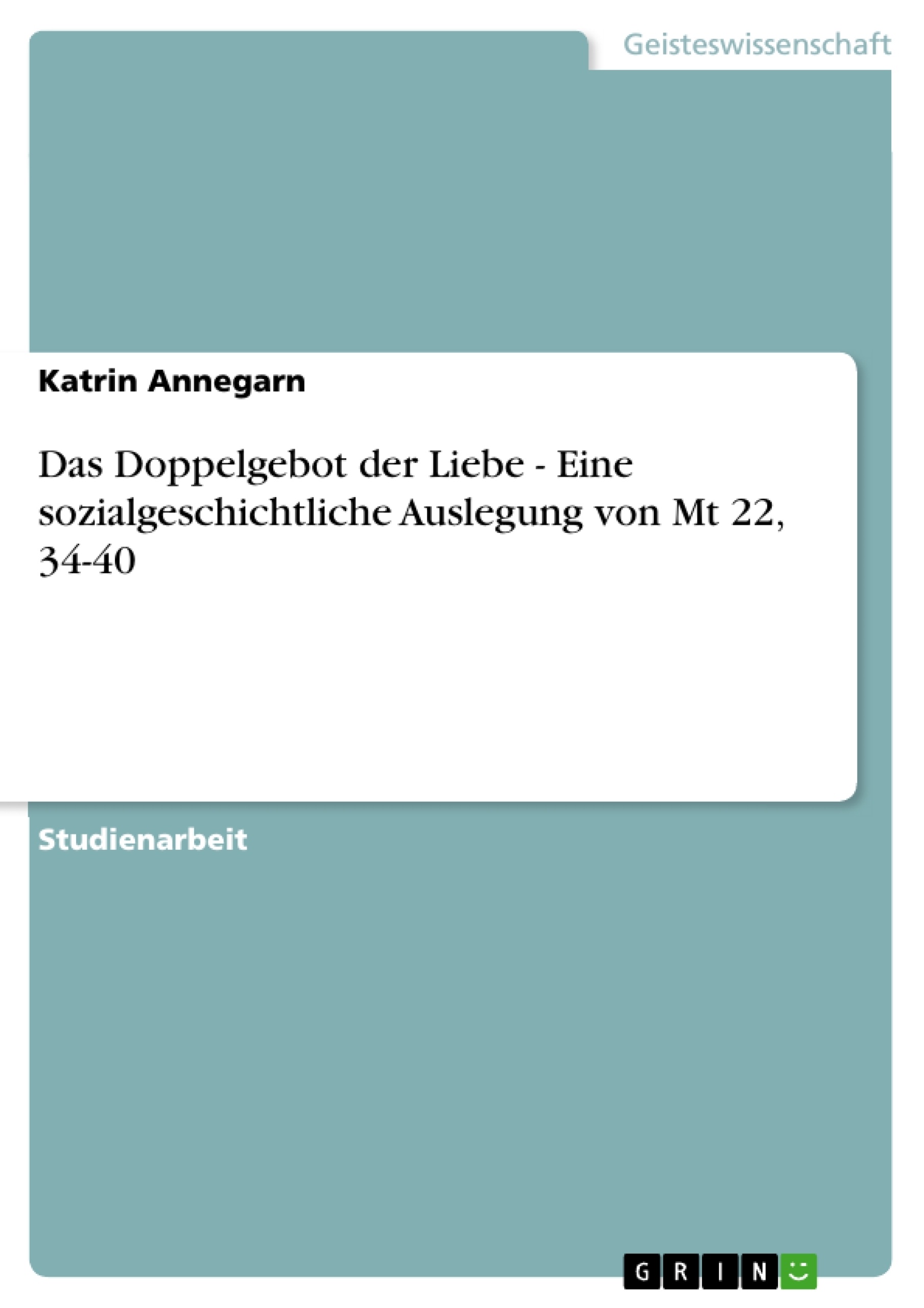Für meine Hausarbeit im Exegetischen Proseminar habe ich als Bibelstelle Mt 22, 34-40 ausgewählt. In dieser Perikope wird Jesus von einem Pharisäer nach dem wichtigsten Gebot gefragt, worauf dieser das Doppelgebot der Liebe (Gottes- und Selbst-/Nächstenliebe) nennt.
Bei der Interpretation dieser Perikope orientiere ich mich an den im Skript zum Exegetischen Proseminar angegebenen Arbeitsschritten: Am Anfang steht eine Textanalyse, in der ich die sprachliche Gestaltung, die Übersetzung sowie die literarische Gattung und die Textgrenzen herausarbeite. Anschließend folgen eine Einordnung der Perikope in ihren literarischen Zusammenhang sowie eine geistes- und religionswissenschaftliche Einordnung des Textes und eine sozialgeschichtliche Analyse, in der ich mich auf drei wissenschaftliche Kommentare beziehe. In einer Gesamtinterpretation fasse ich die in den vorangehenden Kapiteln erhaltenen Ergebnisse zusammen und nehme selber Stellung dazu.
Da die Begriffe „Altes“ und „Neues“ Testament auch als für Juden diskriminierende höhere Bewertung des Neuen Testaments verstanden werden können, es jedoch noch keine allgemein akzeptierten Alternativen gibt, verwende ich in dieser Arbeit anstelle des Ausdrucks „Altes Testament“ den Begriff „Hebräische Bibel“, der nicht die Assoziation hervorruft, das Alte Testament sei weniger wichtig und überholt. Für „Neues Testament“ gibt es leider keine Alternative, so dass ich diesen Begriff beibehalte.
Als biblische Grundlage verwende ich in meiner gesamten Arbeit die Lutherübersetzung in der Revision von 1984. Sofern ein Bibelzitat keine Fußnote mit einer anderen Quellenangabe besitzt, ist es aus der Lutherübersetzung zitiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Textanalyse
- 2.1 Allgemeine Informationen zum Matthäusevangelium
- 2.2 Bestimmung der literarischen Gattung
- 2.3 Textgrenzen und Gliederung
- 2.4 Übersetzungsvergleich
- 3. Der literarische Zusammenhang
- 3.1 Verfasserschaft
- 3.2 Synoptischer Vergleich
- 4. Geistes- und religionswissenschaftliche Einordnung
- 5. Sozialgeschichtliche Analyse
- 5.1 Eigene Beobachtungen zu Mt 22, 34-40
- 5.2 Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Kommentaren
- 6. Gesamtinterpretation
- 7. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Perikope Mt 22, 34-40, in der Jesus das Doppelgebot der Liebe formuliert. Die Zielsetzung besteht darin, den Text mittels einer sozialgeschichtlichen Exegese zu interpretieren. Hierbei werden textanalytische, literaturwissenschaftliche und religionswissenschaftliche Methoden eingesetzt.
- Textanalyse von Mt 22, 34-40
- Einordnung in den literarischen Kontext des Matthäusevangeliums
- Geistes- und religionswissenschaftliche Betrachtung
- Sozialgeschichtliche Analyse des Doppelgebots der Liebe
- Gesamtinterpretation und eigene Stellungnahme
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung beschreibt den Gegenstand der Arbeit: die exegetische Untersuchung der Perikope Mt 22, 34-40, welche das Doppelgebot der Liebe behandelt. Die Autorin erläutert ihre methodische Vorgehensweise, die sich an den im Proseminar vorgegebenen Arbeitsschritten orientiert und die schrittweise Analyse des Textes von der Textanalyse über den literarischen Kontext bis hin zur sozialgeschichtlichen Analyse umfasst. Besondere Aufmerksamkeit wird der Begrifflichkeit des Alten und Neuen Testaments gewidmet, wobei aus Gründen der Vermeidung von Diskriminierung der Begriff "Hebräische Bibel" anstelle von "Altes Testament" verwendet wird. Die Lutherbibel von 1984 dient als Textgrundlage.
2. Textanalyse: Dieses Kapitel widmet sich einer detaillierten Analyse der Perikope Mt 22, 34-40. Es werden allgemeine Informationen zum Matthäusevangelium bereitgestellt, inklusive Entstehungszeit, Sprache und Autorschaft. Die Bestimmung der literarischen Gattung als Evangelium wird diskutiert, wobei die Unterschiede zu anderen Gattungen wie Biographien herausgestellt werden. Die Besonderheiten des Matthäusevangeliums, wie seine thematische Gliederung und die wiederkehrenden Wendungen nach den großen Reden, werden erläutert. Die Analyse umfasst auch die sprachliche Gestaltung und den Übersetzungsvergleich.
3. Der literarische Zusammenhang: In diesem Kapitel wird die Perikope in ihren literarischen Kontext eingeordnet. Die Verfasserschaft des Matthäusevangeliums wird thematisiert, wobei die Zwei-Quellen-Theorie angesprochen wird. Ein synoptischer Vergleich mit parallelen Stellen in den anderen Evangelien liefert weitere Einblicke in den Zusammenhang und die Bedeutung der Perikope.
4. Geistes- und religionswissenschaftliche Einordnung: Dieses Kapitel untersucht die Perikope aus geistes- und religionswissenschaftlicher Perspektive. Es beleuchtet die theologische Bedeutung des Doppelgebots der Liebe im Kontext des Judentums und des frühen Christentums.
5. Sozialgeschichtliche Analyse: Der Kern dieses Kapitels liegt in der sozialgeschichtlichen Analyse der Perikope Mt 22, 34-40. Eigene Beobachtungen zur Perikope werden mit wissenschaftlichen Kommentaren verglichen und diskutiert, um ein umfassenderes Verständnis des Textes im sozialen und historischen Kontext zu gewinnen.
Schlüsselwörter
Matthäusevangelium, Mt 22, 34-40, Doppelgebot der Liebe, Gottesliebe, Nächstenliebe, Sozialgeschichtliche Exegese, Textanalyse, Literarische Gattung, Evangelium, Synoptische Evangelien, Hebräische Bibel, Zwei-Quellen-Theorie.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Exegetische Untersuchung von Mt 22, 34-40
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Perikope Mt 22, 34-40 des Matthäusevangeliums, in der Jesus das Doppelgebot der Liebe formuliert. Die Analyse erfolgt mittels sozialgeschichtlicher Exegese, unter Einbezug textanalytischer, literaturwissenschaftlicher und religionswissenschaftlicher Methoden.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine methodische Vorgehensweise, die schrittweise Analyse des Textes umfasst: von der Textanalyse über den literarischen Kontext bis hin zur sozialgeschichtlichen Analyse. Es werden textanalytische, literaturwissenschaftliche und religionswissenschaftliche Methoden eingesetzt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung besteht darin, die Perikope Mt 22, 34-40 mittels sozialgeschichtlicher Exegese zu interpretieren und ein umfassendes Verständnis des Textes im sozialen und historischen Kontext zu gewinnen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (Beschreibung des Gegenstands und der Methode), Textanalyse (detaillierte Analyse von Mt 22, 34-40, inklusive Übersetzungsvergleich), Literarischer Zusammenhang (Einordnung in den Kontext des Matthäusevangeliums, synoptischer Vergleich), Geistes- und religionswissenschaftliche Einordnung (theologische Bedeutung im Kontext von Judentum und frühem Christentum), Sozialgeschichtliche Analyse (eigene Beobachtungen und Vergleich mit wissenschaftlichen Kommentaren), Gesamtinterpretation und Fazit/Ausblick.
Welche Textgrundlage wird verwendet?
Als Textgrundlage dient die Lutherbibel von 1984. Der Begriff "Hebräische Bibel" wird anstelle von "Altes Testament" verwendet, um Diskriminierung zu vermeiden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Matthäusevangelium, Mt 22, 34-40, Doppelgebot der Liebe, Gottesliebe, Nächstenliebe, Sozialgeschichtliche Exegese, Textanalyse, Literarische Gattung, Evangelium, Synoptische Evangelien, Hebräische Bibel, Zwei-Quellen-Theorie.
Wie wird die Perikope Mt 22, 34-40 in den literarischen Kontext eingeordnet?
Die Einordnung erfolgt durch die Auseinandersetzung mit der Verfasserschaft des Matthäusevangeliums (inkl. Zwei-Quellen-Theorie) und durch einen synoptischen Vergleich mit parallelen Stellen in den anderen Evangelien.
Welche Bedeutung hat die sozialgeschichtliche Analyse?
Die sozialgeschichtliche Analyse bildet den Kern der Interpretation. Eigene Beobachtungen zur Perikope werden mit wissenschaftlichen Kommentaren verglichen und diskutiert, um ein umfassenderes Verständnis des Textes im sozialen und historischen Kontext zu gewinnen.
- Quote paper
- Katrin Annegarn (Author), 2004, Das Doppelgebot der Liebe - Eine sozialgeschichtliche Auslegung von Mt 22, 34-40, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67447