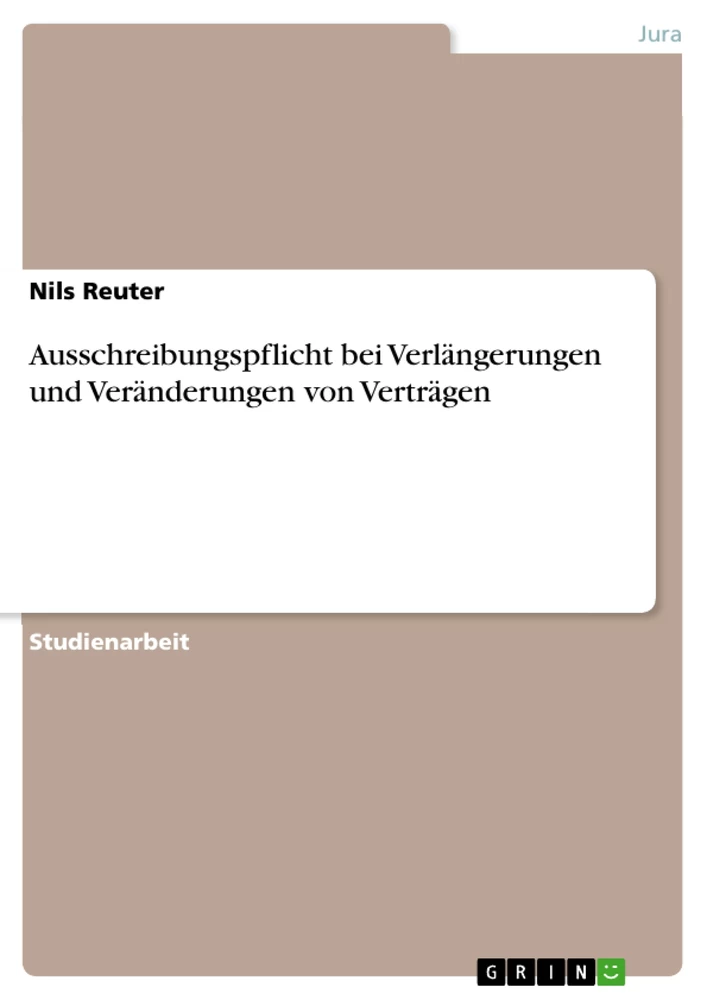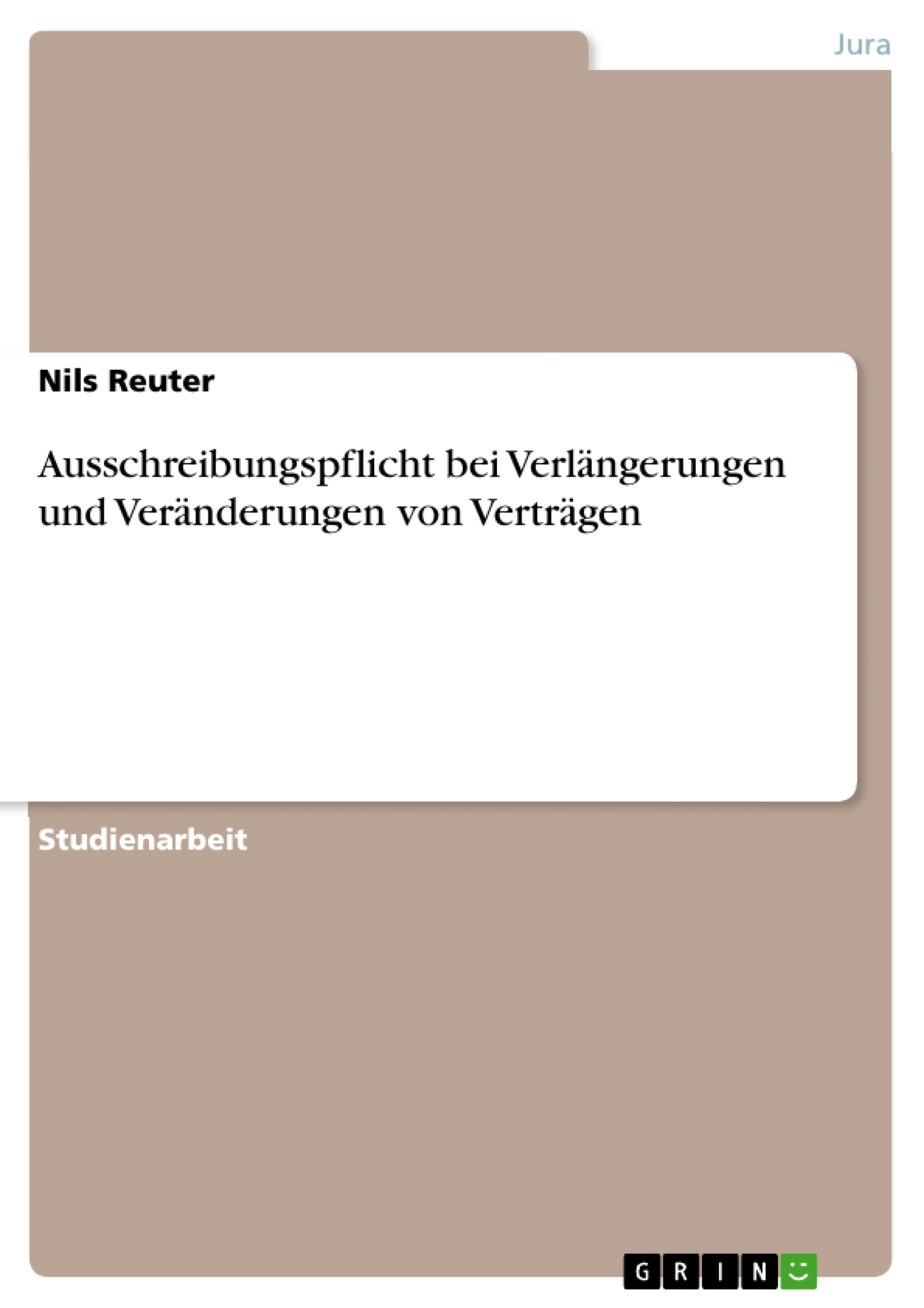Das Vergaberecht verpflichtet öffentliche Auftraggeber bei der Vergabe von Aufträgen ein bestimmtes Verfahren einzuhalten. Diese Verpflichtung kann auf zwei verschiedenen Gründen beruhen. Zum einen wird sie durch den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) - §§ 97ff - bestimmt, wenn die Auftragswerte bestimmte Schwellen überschreiten. Unterhalb dieser Schwellenwerte besteht die Pflicht zur Einhaltung des Vergabeverfahrens aufgrund haushaltsrechtlicher Bestimmungen (vergleiche. § 30 HGrG), für den Bund beispielsweise § 55 BHO. Diese Zweiteilung ist entstanden, da oberhalb der Schwellenwerte aufgrund europarechtlicher Vorgaben ein subjektiver Rechtsschutz erforderlich wurde, der unter dem Dach des Haushaltsrechts nicht verwirklicht werden konnte. Das Vergabeverfahren soll als Wettbewerbsrecht in erster Linie eine wettbewerbsneutrale Vergabe öffentlicher Aufträge sichern, als Haushaltsrecht zu einer wirtschaftlichen und sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel anhalten.
Die Regelungen sind durch die erhebliche ökonomische Bedeutung öffentlicher Aufträge gerechtfertigt. Auf die öffentlichen Auftraggeber entfällt also eine erhebliche Marktmacht. Schon aus ordnungsökonomischen Gründen scheint daher eine wettbewerbsneutrale Ausübung dieser Marktmacht notwendig zu sein. Aber auch grundrechtlich ist ein neutrales Verhalten der öffentlichen Auftraggeber geboten (Art. 3 Abs. 1 GG). Weiterhin dient das Vergaberecht auch der Verwirklichung des europarechtlichen Diskriminierungsverbots (Art. 12 EG). mUnd nicht zuletzt ist auch eine wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel ein wichtiges Gebot. Nicht immer unproblematisch ist die Frage, welche Vorgänge dem Vergabeverfahren unterfallen, also wann eine Ausschreibungspflicht gem. § 3 Nr. 1 Abs. 1 VOB/A, § 3(a) Nr. 1 Abs. 1 VOL/A bzw. § 5 Abs. 1 VOF (Vergabebekanntmachung) besteht. Es handelt sich um eine Frage des sachlichen Anwendungsbereichs des Vergaberechts. Oberhalb der Schwellenwerte richtet sich dieser nach § 99 GWB. Danach ist das Vergabeverfahren auf alle öffentlichen Aufträge anzuwenden. Das sind nach dem § 99 GWB zugrundeliegenden Auftragsbegriff alle entgeltlichen Verträge zwischen öffentlichen Auftraggebern und Unternehmen, die Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen zum Gegenstand haben.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Auslegung des Tatbestands der Ausschreibungspflicht
- 1. Ausgangspunkt
- 2. Rechtsprechung und Literatur
- 3. Stellungnahme
- a) Änderungen wesentlicher Bestandteile
- b) Änderung der essentialia negotii
- c) Änderung durch zwei selbständige Willenserklärungen
- d) (Un-)möglichkeit einer selbständigen Vergabe
- e) Änderung in Ausschreibung nicht vorgesehen
- f) Zusammenfassung
- 4. Konkretisierung des Kriteriums „Änderung wesentlicher Bestandteile“
- III. Verlängerung von Verträgen
- 1. Allgemeines
- 2. Verlängerung durch Vertrag
- 3. Unbefristeter Vertrag mit Kündigungsmöglichkeit – Pflicht zur Kündigung
- a) Zulässigkeit des Abschlusses unbefristeter Verträge
- b) Nichtwahrnehmung einer Kündigungsmöglichkeit
- 4. Befristeter Vertrag mit automatischer Verlängerung
- 5. Verlängerungsrecht als Option
- a) Einräumung des einseitigen Verlängerungsrechts
- b) Ausübung des einseitigen Verlängerungsrechts
- 6. Einvernehmliche Rücknahme einer Kündigung
- IV. Sonstige Änderungen von Verträgen
- 1. Allgemeines
- 2. Auftragnehmerwechsel
- 3. Inhaltsänderungen im engeren Sinne
- V. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Ausschreibungspflicht von Verlängerungen und Veränderungen von Verträgen im öffentlichen Wirtschaftsrecht. Sie untersucht die Auslegung des Tatbestands der Ausschreibungspflicht im Kontext von Vertragsänderungen und -verlängerungen.
- Die Auslegung des Begriffs „wesentliche Bestandteile“ im Zusammenhang mit Vertragsänderungen
- Die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen die Verlängerung von Verträgen eine Ausschreibungspflicht auslöst
- Die Analyse verschiedener Arten von Vertragsänderungen, wie z.B. Auftragnehmerwechsel und Inhaltsänderungen
- Die rechtlichen und praktischen Auswirkungen der Ausschreibungspflicht auf die Gestaltung von Verträgen im öffentlichen Sektor
- Die Bedeutung der Ausschreibungspflicht für einen fairen Wettbewerb und die effiziente Verwendung öffentlicher Mittel
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema der Ausschreibungspflicht im öffentlichen Wirtschaftsrecht und beleuchtet die rechtlichen Grundlagen und die Bedeutung der Thematik. Anschließend wird der Tatbestand der Ausschreibungspflicht im Detail analysiert, wobei die Rechtsprechung und Literatur zu Änderungen wesentlicher Vertragsbestandteile beleuchtet werden. Das dritte Kapitel widmet sich der Verlängerung von Verträgen und analysiert verschiedene Szenarien wie unbefristete Verträge mit Kündigungsmöglichkeit, befristete Verträge mit automatischer Verlängerung und das Verlängerungsrecht als Option. Das vierte Kapitel behandelt sonstige Vertragsänderungen, darunter Auftragnehmerwechsel und Inhaltsänderungen im engeren Sinne.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Ausschreibungspflicht im öffentlichen Wirtschaftsrecht, Vertragsänderungen, Verlängerungen, wesentliche Bestandteile, Vergabeverfahren, öffentliches Auftragswesen, Wettbewerbsrecht, Haushaltsrecht, europäisches Vergaberecht.
- Quote paper
- Nils Reuter (Author), 2007, Ausschreibungspflicht bei Verlängerungen und Veränderungen von Verträgen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67424