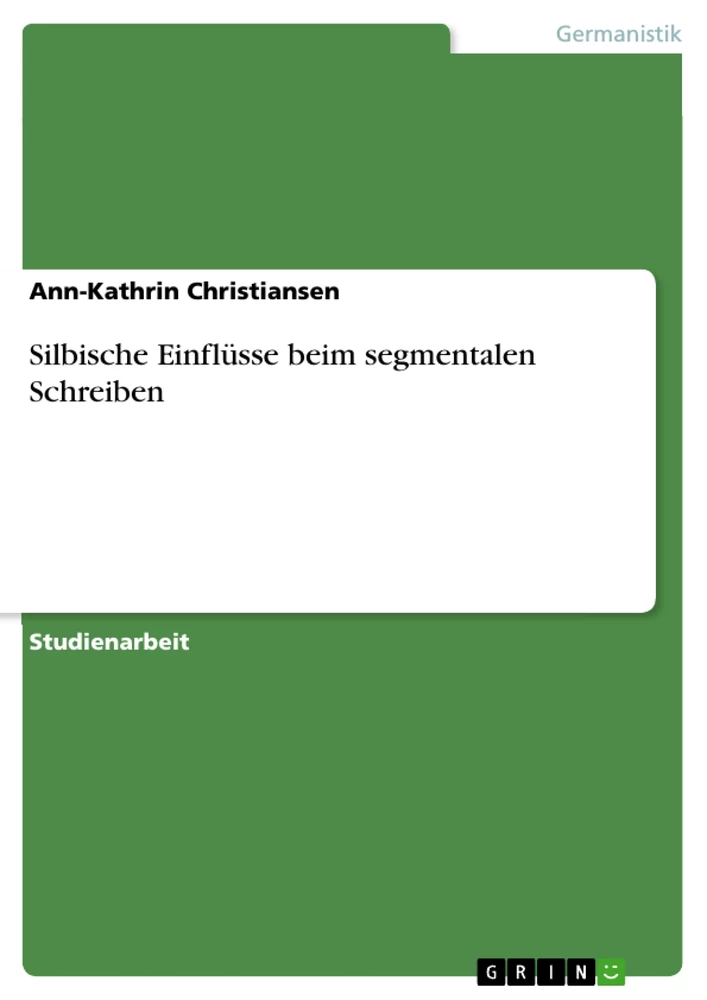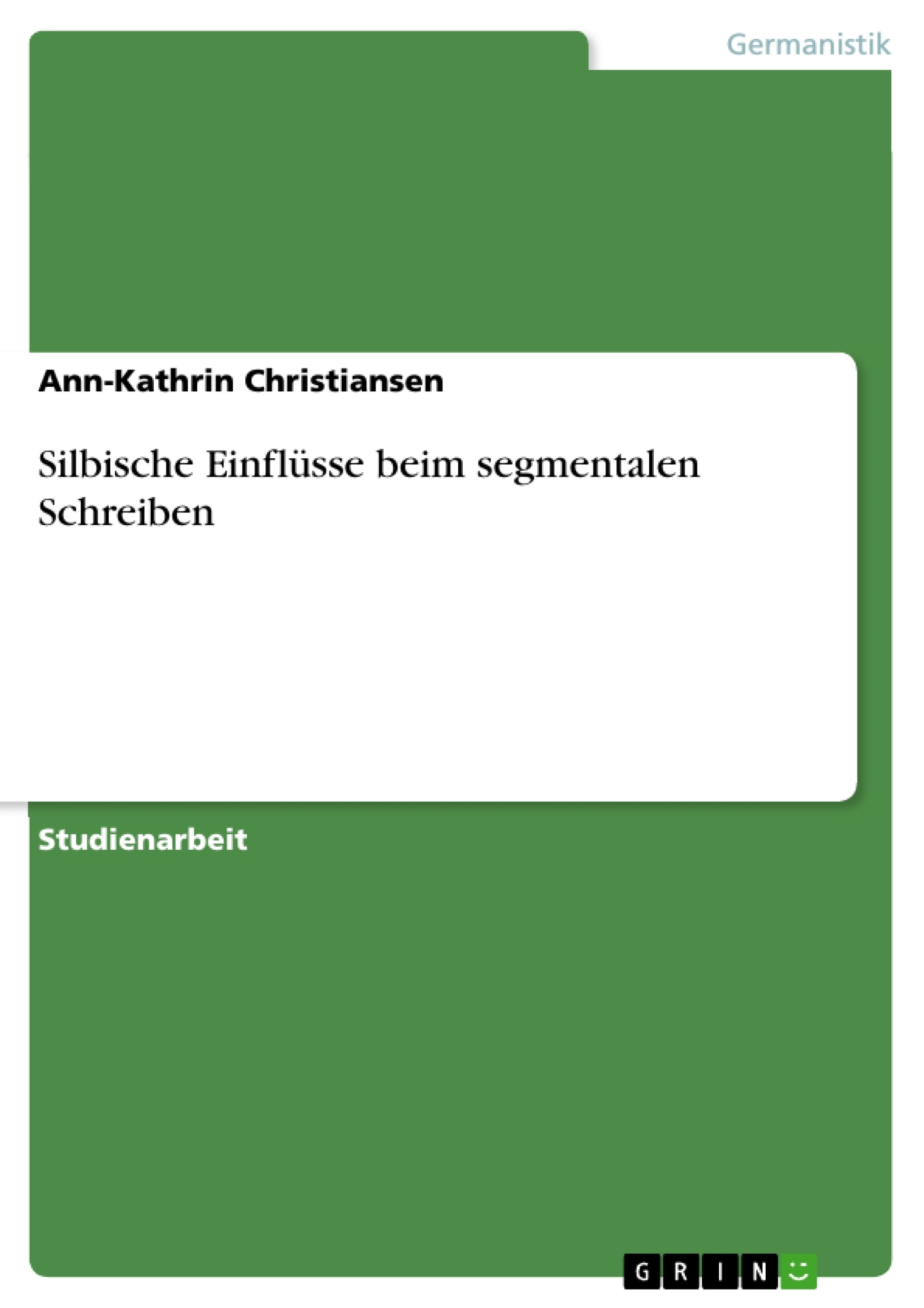Der Hausarbeit liegt der Aufsatz „Silbische Aspekte segmentalen Schreibens – neurolinguistische Evidenz“ von Eisenberg, de Bleser und Domahs zugrunde. Die Autoren möchten mehr über die segmentale Verarbeitung beim Schreiben erfahren, indem sie sich der Neurolinguistik bedienen. Eine Aphasie, die Oberflächendysgraphie, erlaubt es ihnen die segmentale Verarbeitungsroute weitestgehend isoliert zu betrachten, da bei den Patienten die lexikalische und semantische Verarbeitung gestört ist. Die Untersuchungen verfolgen das Ziel, die silbischen Einflüsse in der segmentalen Verarbeitung beim Schreiben zu erfassen.
Ich werde zuerst das Logogen-Modell von Morton (1980) und Patterson (1988) vorstellen. Das ist nötig, weil es das Fundament für die ganze Analyse darstellt.
Im Weiteren folgen die Begriffserklärungen zur Phonem-Graphem-Korrespondenz (PGK), Neurolinguistik und der Oberflächendysgraphie (OFDG).
Im nächsten Abschnitt werde ich den Patienten H.S. vorstellen, der von Eisenberg, de Bleser und Domahs analysiert wurde, um die silbischen Einflüsse der segmentalen Verarbeitung zu untersuchen.
Der letzte Abschnitt beinhaltet den Forschungsstand und die silbischen Analysen der Autoren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlage: Logogen-Modell von Morton (1980) und Patterson (1988)
- 3. Begriffserklärungen
- 3.1 Phonem-Graphem-Korrespondenzen (PGK)
- 3.2 Neurolinguistik
- 3.3 Oberflächendysgraphie (OFDG)
- 4. Patient
- 4.1 Analyse der Schreibleistung im Januar 1987
- 4.2 Darstellung verbleibender Leistungen
- 5. Silbische Einflüsse
- 5.1 Forschungsstand
- 5.2 Forschungen von Eisenberg, de Bleser und Domahs
- 5.2.1 „Silbeninitales h“
- 5.2.2 Dehnungs-h
- 5.2.3
-Schreibung - 5.2.4 Realisierung des langen, gespannten /i:/
- 6. Schlussteil
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der segmentalen Verarbeitung beim Schreiben. Die Autoren Eisenberg, de Bleser und Domahs untersuchen mithilfe des Logogen-Modells und der Analyse von Patienten mit Oberflächendysgraphie die silbischen Einflüsse auf diese Verarbeitung. Ziel ist es, die Rolle der Silbe bei der Rechtschreibung zu beleuchten und zu erforschen, wie die segmentale Verarbeitung auf der Silbenebene funktioniert.
- Das Logogen-Modell als Grundlage zur Erklärung von Les- und Schreibprozessen.
- Die Oberflächendysgraphie als Fenster zur segmentalen Verarbeitung.
- Silbische Einflüsse auf die segmentale Verarbeitung beim Schreiben.
- Die Analyse der Schreibleistungen von Patienten mit Oberflächendysgraphie.
- Die Rolle der Phonem-Graphem-Korrespondenz (PGK) beim Schreiben.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Arbeit stellt das Thema und die Zielsetzung der Untersuchung vor. Sie erläutert den Fokus auf die segmentale Verarbeitung und die Verwendung der Oberflächendysgraphie als Forschungsmethode.
- Kapitel 2: Grundlage: Logogen-Modell von Morton (1980) und Patterson (1988): Das Logogen-Modell wird als Grundlage für die Untersuchung der segmentalen Verarbeitung beim Schreiben vorgestellt. Es werden die verschiedenen Verarbeitungsrouten erläutert, insbesondere die segmentale Route, die im Fokus der Arbeit steht.
- Kapitel 3: Begriffserklärungen: In diesem Kapitel werden wichtige Begriffe wie Phonem-Graphem-Korrespondenz (PGK), Neurolinguistik und Oberflächendysgraphie (OFDG) definiert und erklärt.
- Kapitel 4: Patient: Es wird ein Patient (H.S.) vorgestellt, der von Eisenberg, de Bleser und Domahs untersucht wurde, um die segmentalen Verarbeitungsprozesse bei Patienten mit Oberflächendysgraphie zu analysieren.
- Kapitel 5: Silbische Einflüsse: Der Forschungsstand zur Rolle der Silbe bei der segmentalen Verarbeitung wird dargestellt. Die Forschungsarbeiten von Eisenberg, de Bleser und Domahs werden vorgestellt, die die Bedeutung der Silbe für verschiedene Aspekte der Rechtschreibung untersuchen, wie z.B. die Schreibung von „h“ und die Realisierung von Vokalen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die segmentale Verarbeitung beim Schreiben, die Oberflächendysgraphie, das Logogen-Modell, silbische Einflüsse auf die Rechtschreibung, Phonem-Graphem-Korrespondenz (PGK) und die Analyse der Schreibleistungen von Patienten.
Excerpt out of 18 pages - scroll top- Quote paper
- Ann-Kathrin Christiansen (Author), 2006, Silbische Einflüsse beim segmentalen Schreiben, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67364