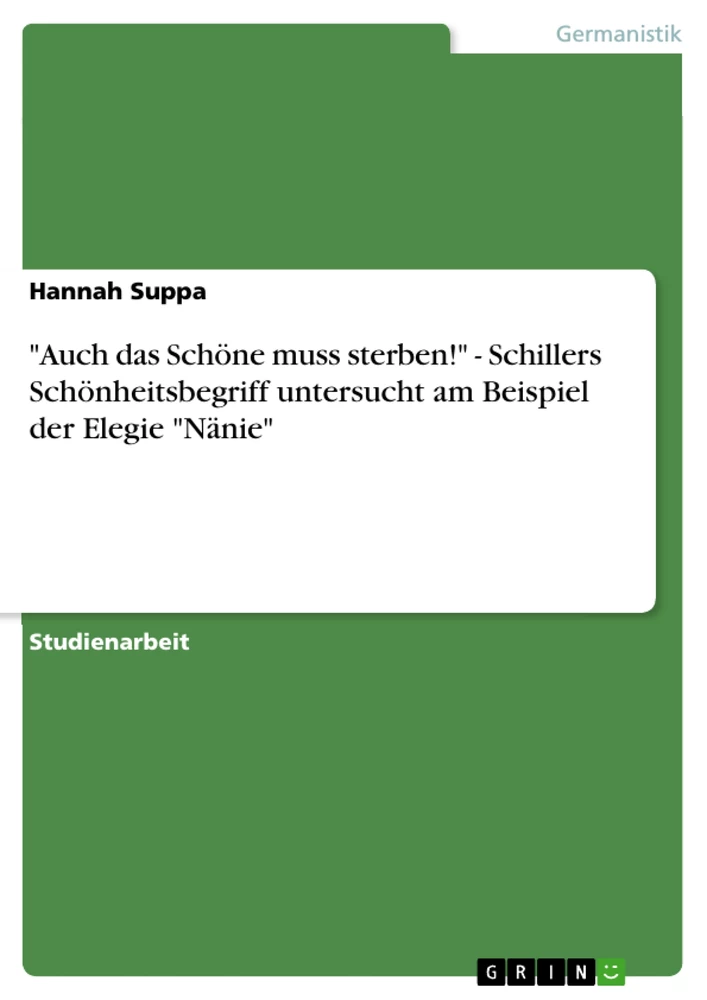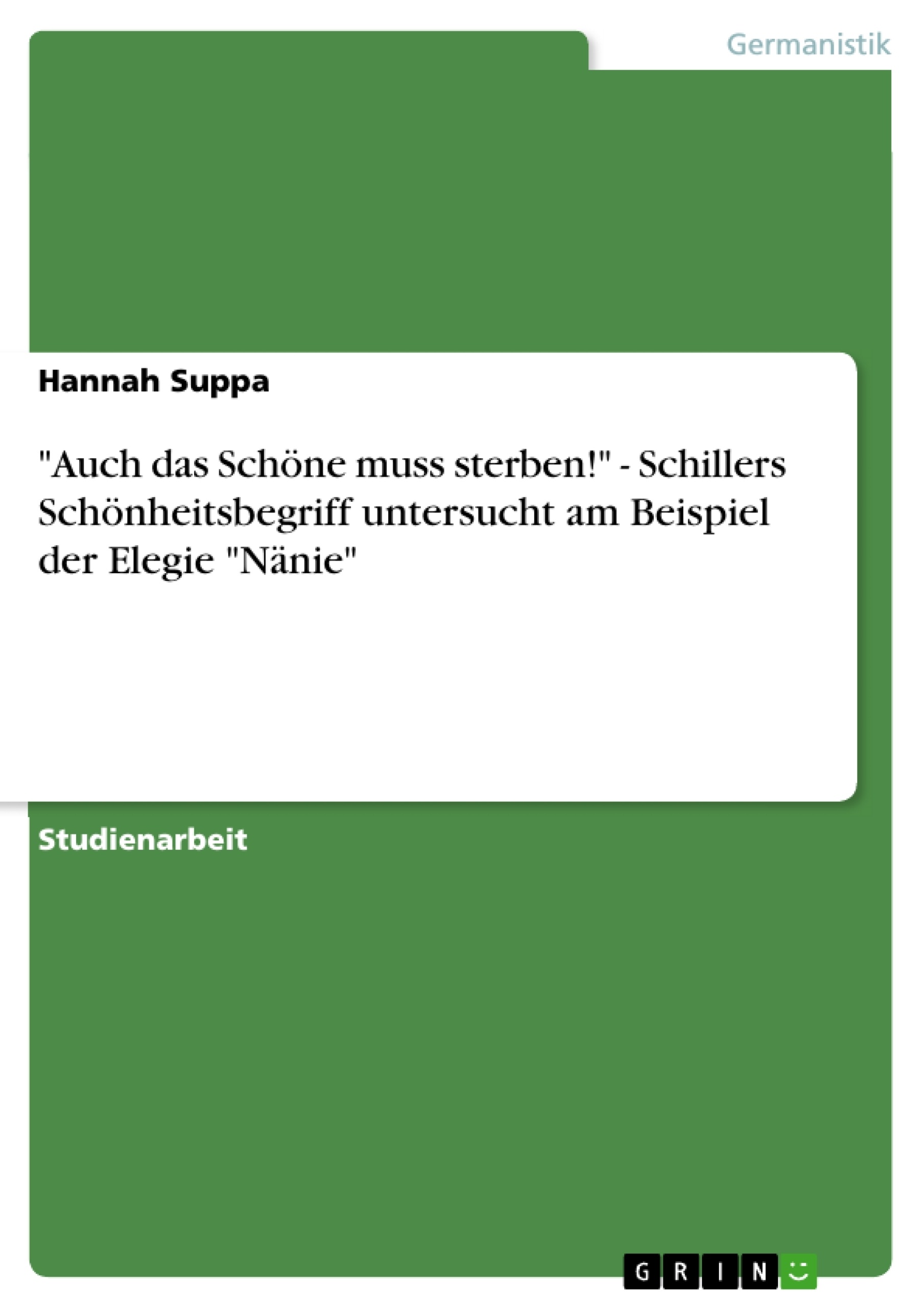Mit diesem plakativen und viel zitierten Ausspruch leitet Schiller die Elegie „Nänie“ ein und setzt somit ein Fazit unter seine bisherigen Arbeiten über den Schönheitsbegriff. Die Frage, was als schön gelte und wie der Schönheitsbegriff definiert werden kann, hat Schiller über eine breite Schaffensphase beschäftigt. Bereits 1793, also knapp sechs Jahre vor Entstehung der „Nänie“, hat er sich in den so genannten Kallias-Briefen mit der Frage nach einem „objektiven Prinzip für den Geschmack“ auseinandergesetzt. Schillers Definition des Schönheitsbegriffs verlief nicht stringent. In „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ findet eine Negierung seiner in den Kallias-Briefwechseln formulierten Darstellungen statt. In „Nänie“, seinem oftmals als schönstes Gedicht tituliertem Werk, gipfeln seine bisherigen Ergebnisse im ersten Vers: „Auch das Schöne muss sterben!“. Was für eine provokative Aussage! Wie kommt Schiller zu seinem sich wandelnden Schönheitsbegriff? Kann die „Nänie“ als Abschluss seiner Betrachtungen zur Schönheit verstanden werden?
Über den Entstehungszeitpunkt der „Nänie“ herrscht in der Forschung Uneinigkeit, da keine sicheren Daten zur Entstehungsgeschichte überliefert sind. Ungefähr kann die Entstehung der „Nänie“ auf das Jahr 1799 datiert werden. Die gesamte Schaffensphase ab 1790, in der Schiller Kant-Lektüre studiert hat und sich vorwiegend mit Fragen nach der Ästhetik und Schönheit beschäftigt hat, war durch mehrfache Krankheitsschübe geprägt, die sich wohl auch auf seine Arbeiten ausgewirkt haben. So schloss seine gesundheitliche Verfassung seit 1791 „eine aktive Teilnahme am öffentlichen Leben nahezu“ aus.
Im Zuge seiner Krankheitsgeschichte wurde so für Schiller das Thema Tod und Sterben immer präsenter. Und so ist auch der Tod in Verbindung mit dem Schönheitsbegriff ein zentrales Thema der „Nänie“.
Schillers Schönheitsbegriffs soll in dieser Arbeit anhand dieser Elegie untersucht und interpretiert werden. Zunächst gehe ich auf die philosophischen und theoretischen Schriften Schillers, insbesondere im Hinblick auf Kants „Kritik der Urteilskraft“ ein. Die ausführliche Interpretation des Gedichtes soll dabei vor allem Schillers Schönheitsbegriff einbeziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Schönheitsbegriff
- Philosophische und literaturgeschichtliche Einordnung
- Schillers Schönheitsbegriff in seinen theoretischen Schriften
- „Nänie“
- Einordnung
- Interpretation
- Verwendung des Schönheitsbegriffs
- Fazit
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Schillers Schönheitsbegriff anhand seiner Elegie „Nänie“. Ziel ist es, Schillers sich wandelnde Definition von Schönheit zu beleuchten und zu ergründen, ob die „Nänie“ als Abschluss seiner Gedanken zur Ästhetik verstanden werden kann. Dabei werden Schillers theoretische Schriften, insbesondere im Hinblick auf Kants „Kritik der Urteilskraft“, einbezogen.
- Entwicklung von Schillers Schönheitsbegriff
- Einfluß von Kants „Kritik der Urteilskraft“ auf Schillers Gedanken zur Ästhetik
- Die Rolle des Todes im Kontext des Schönheitsbegriffs in Schillers „Nänie“
- Interpretation der „Nänie“ unter Berücksichtigung von Schillers Schönheitsbegriff
- Schillers „Nänie“ als möglicher Abschluss seiner Betrachtungen zur Schönheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Schillers „Nänie“ und den darin enthaltenen Satz „Auch das Schöne muss sterben!“ vor. Sie skizziert die Entwicklung von Schillers Schönheitsbegriff, der in seiner Vielschichtigkeit verschiedene theoretische und literarische Strömungen aufgreift.
Das zweite Kapitel widmet sich Schillers Schönheitsbegriff im Kontext philosophischer und literaturgeschichtlicher Diskurse. Es geht auf die Antike und die Unterscheidung zwischen „Naturschönen“ und „Kunstschönen“ ein und beleuchtet Immanuel Kants Einfluss auf die Weiterentwicklung des Schönheitsbegriffs, der in seiner „Kritik der Urteilskraft“ Schönheit als Urteil des Verstandes definiert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit Schillers „Nänie“. Es geht auf die Einordnung des Gedichts in Schillers Schaffen ein und präsentiert eine Interpretation des Textes, die Schillers Schönheitsbegriff in den Vordergrund stellt.
Der Abschnitt über die Verwendung des Schönheitsbegriffs in der „Nänie“ betrachtet den Einsatz von Bildsprache und Metaphern, um die Vergänglichkeit von Schönheit darzustellen.
Schlüsselwörter
Schillers „Nänie“, Schönheitsbegriff, Ästhetik, „Kritik der Urteilskraft“, Immanuel Kant, Vergänglichkeit, Tod, Schönheit, Kunst, Natur, Geschmacksurteil, Klassik, Elegie.
- Quote paper
- Hannah Suppa (Author), 2006, "Auch das Schöne muss sterben!" - Schillers Schönheitsbegriff untersucht am Beispiel der Elegie "Nänie", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67344