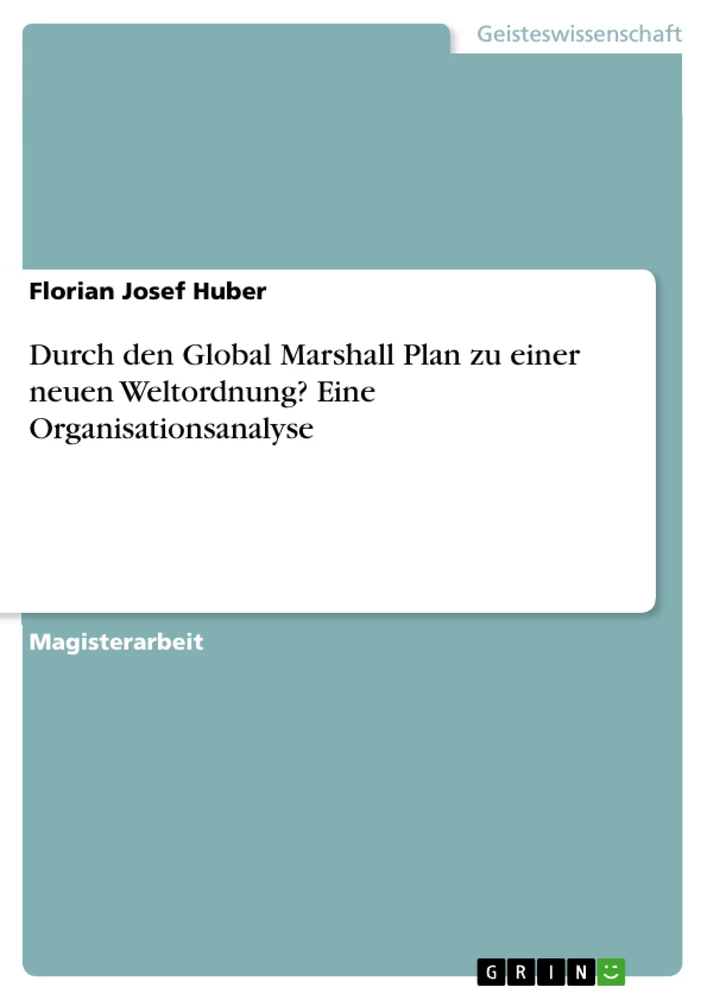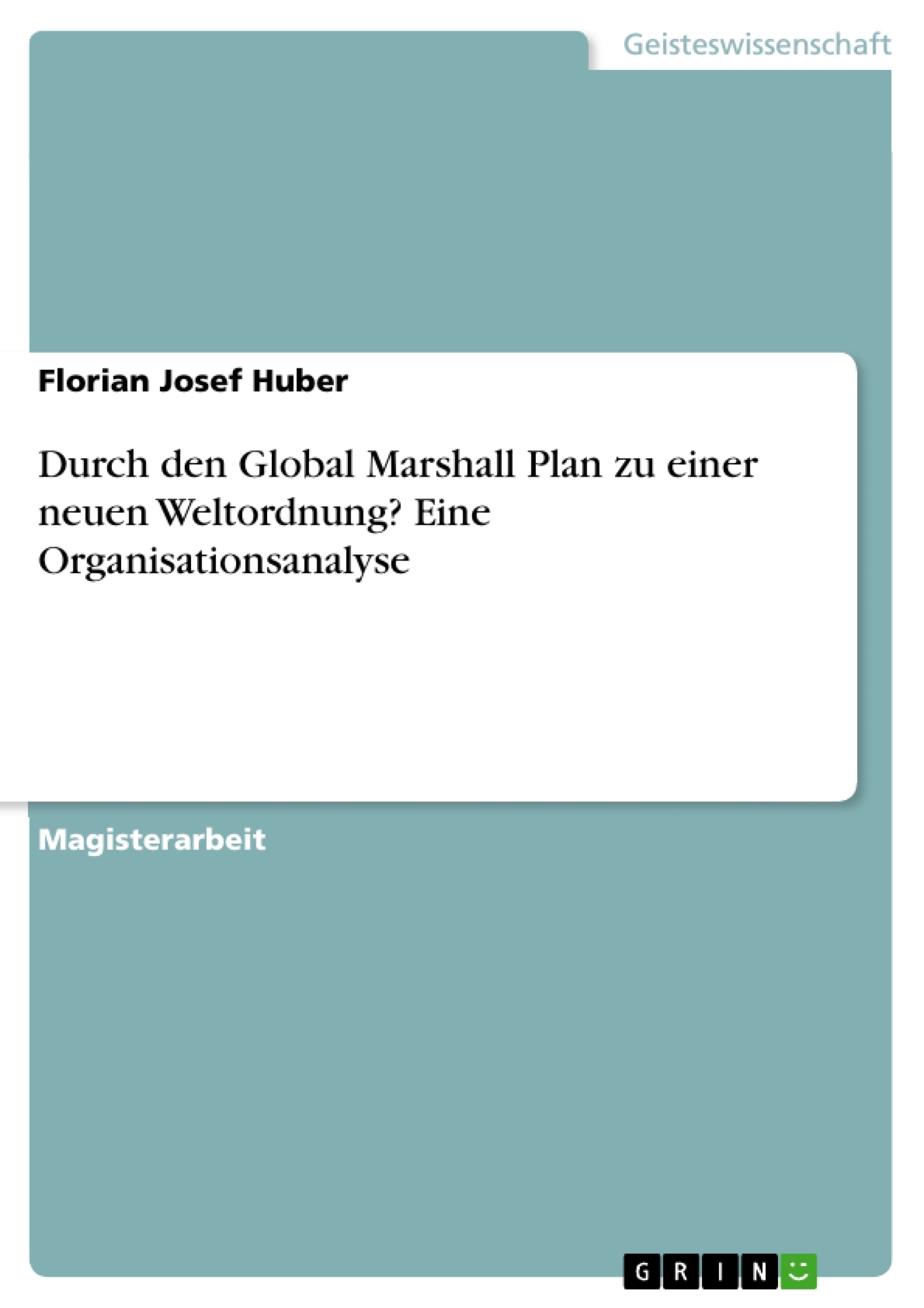In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, inwieweit die zivilgesellschaftliche Organisation Global Marshall Plan Initiative in Anbetracht ihrer relativ losen netzwerkförmigen Organisati-ons-struktur dazu imstande ist, die Umsetzung einer Global Governance Architek-tur voranzu-treiben. Somit wird in dieser Arbeit sowohl ein organisationssoziologischer Ansatz verfolgt, als auch auf das Thema der zivilgesellschaftlichen Bewegungen, die ein Motor für gesell-schaftliche Veränderung sein können, eingegangen. Diesbezüglich ist es weiters von Inte-resse, inwieweit Druck und Engagement aus der Zivilgesellschaft eine Veränderung innerhalb der großen Institutionen bewirken kann.
Als Drittes wird danach gefragt, ob die von der Initiative propagierte Ökosoziale Marktwirt-schaft und die Global Go-vernance Idee in ihren Konzeptionen identisch sind oder ob es zu-mindest gewisse Ähnlichkeiten gibt. Als letzter Punkt wird zudem mit Hilfe einer Faktoren-analyse die Einstellung der befragten Personen des European Social Survey 2002/03 zu Global Governance geklärt.
Die gesamte Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel, die wiederum drei Hauptteilen zugeordnet werden können: Theoretischer Hintergrund (Kapitel 1 und 2), Empirischer Teil (Kapitel 3 bis 6) und Anhang (Literatur-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnis, Transkript und Lebenslauf des Autors).
Derzeit besitzt die Initiative, neben einigen Aspekten, die sich positiv auf die Funktionalität der Organisation auswirken, nicht die Möglichkeit, die Umsetzung einer Global Governance Architektur erfolgreich vorantreiben zu können. Weiters stellen die teils negativen Stellungnahmen anderer zivilgesellschaftlicher Organisationen, die aufgrund der verwendeten Begrifflichkeiten und der Probleme mit dem Gesamtkonzept abgegeben wurden, ein Problem dar. Durch Druck aus der Zivilgesellschaft können Veränderungen innerhalb der globalen Insti-tutionen durchgesetzt werden, wie anhand von Beispielen gezeigt wurde, obwohl dies ein langsamer und schwieriger Prozess ist. Die Idee eines Global Marshall Plans (wie sie von der Initiative verfolgt wird) weist in den wesentlichen Punkten (wie etwa Implementierung von globalen Rahmenbedingungen bzw. Standards und Reformprozesse innerhalb der globalen Institutionen) Ähnlichkeiten mit dem Global Governance Konzept auf. Die Auswertung der Daten ergab, dass die Bevölkerung vor allem Themen wie Entwick-lungszusammenarbeit oder Umweltschutz auf der globalen Ebene behandelt wissen will.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A. THEORETISCHER HINTERGRUND
- 1. Das Global Governance Konzept
- 1.1. Thematiken der Globalisierung
- 1.2. Global Governance
- 1.2.1. Der Begriff Governance - eine Verortung
- 1.2.2. Die Vision einer globalen Weltordnungspolitik
- 1.3. Global Governance Strategien
- 1.3.1. Commission on Global Governance
- 1.3.2. Der Global Compact
- 1.3.3. Die Vereinten Nationen und Global Governance
- 1.3.4. Institut für Entwicklung und Frieden (INEF)
- 1.4. Institutionen und Blockaden
- 1.4.1. Die Reform der Vereinten Nationen als Baustein in der Global Governance Architektur
- 1.4.2. Blockaden und Kernprobleme
- 1.5. Die Rolle der Nicht-Regierungsorganisationen im Global Governance Konzept
- 1.5.1. Daten
- 1.5.2. Historischer Rückblick - Zivilgesellschaft
- 1.5.3. Nicht-Regierungsorganisationen und Neue Soziale Bewegungen
- 1.5.4. Nicht-Regierungsorganisationen und Global Governance
- 1.6. Kritik am Global Governance Konzept
- 2. Skizzen ausgewählter Organisationstheorien
- 2.1. Begriffe und Forschungszugänge
- 2.2. Allgemeine Entwicklung der Organisationssoziologie
- 2.3. Betriebswirtschaftliche Organisationstheorie
- 2.4. Administrationstheorie
- 2.5. Bürokratietheorie
- 2.6. Human Relationstheorie
- 2.7. Systemtheorie
- 2.8. Kontingenztheorie
- 2.9. Soziotechnische Integrationstheorie
- 2.10. Weitere Ansätze
- 2.11. Netzwerk und Netzwerkanalyse
- 2.11.1. Geschichte der Netzwerkanalyse
- 2.11.2. Forschungsfelder
- B. EMPIRISCHER TEIL
- 3. Analyse der Global Marshall Plan Initiative
- 3.1. Die Global Marshall Plan Initiative (GMPI)
- 3.1.1. Der Global Marshall Plan
- 3.1.2. Finanzierungsinstrumente
- 3.1.3. Ökosoziale Marktwirtschaft
- 3.1.4. Der Global Marshall Plan und das Global Governance Konzept
- 3.1.5. Die Entwicklung der Initiative
- 3.1.6. Organisationsstruktur
- 3.1.7. Finanzierung und Tätigkeiten
- 3.2. Analyse der Organisation
- 3.2.1. Unabhängige Organisationsvariablen
- 3.2.1.1. Ziele
- 3.2.1.1.1. Begriff und theoretische Bedeutung der Ziele
- 3.2.1.1.2. Praktische Festlegung und empirische Ermittlung der Ziele
- 3.2.1.1.3. Veränderung der Organisationsziele
- 3.2.1.2. Instrumente
- 3.2.1.2.1. Begriff und theoretische Bedeutung der Instrumente
- 3.2.1.2.2. Menschliches Instrumentarium
- 3.2.1.2.3. Andere Instrumente
- 3.2.1.2.4. Beziehungen zwischen Instrumenten und Ziele
- 3.2.1.3. Bedingungen
- 3.2.1.3.1. Begriff und theoretische Bedeutung der Organisationsbedingungen
- 3.2.1.3.2. Organisationskultur als Organisationsbedingung
- 3.2.2. Abhängige Organisationsvariablen
- 3.2.2.1. Strukturen
- 3.2.2.1.1. Begriff und allgemeine Bedeutung der Organisationsstrukturen
- 3.2.2.1.2. Rollenstrukturen
- 3.2.2.1.3. Leitungsstrukturen
- 3.2.2.1.4. Kommunikationsstrukturen
- 3.2.2.1.5. Autoritätsstrukturen und Führungsstile
- 3.2.2.1.6. Beziehungen zwischen Strukturen und unabhängigen Variablen
- 3.2.2.2. Funktionen
- 3.2.2.2.1. Soziale und interne Funktionen
- 3.2.2.2.2. Beziehungen zwischen Funktionen und unabhängigen Variablen
- 3.2.2.3. Verhalten
- 3.2.2.3.1. Begriff und allgemeine Bedeutung des Organisationsverhaltens
- 3.2.2.3.2. Ziel- und nicht Ziel orientiertes Organisationsverhalten
- 3.2.2.3.3. Beziehungen zwischen Verhalten und anderen Variablen
- 3.3. Darstellung der Ergebnisse der SWOT Analyse
- 3.4. Kritik am Global Marshall Plan
- 4. Einstellung und Interesse der Bevölkerung
- 4.1. Beschreibung des Datensatzes
- 4.2. Auswertung der Daten
- 4.2.1. Demographische Daten
- 4.2.2. Analyse der potentiellen Variablen für eine Faktorenanalyse
- 4.2.3. Explorative Faktorenanalyse
- 5. Rückschlüsse auf die Forschungsfragen und Prüfung der Hypothesen
- 6. Abschließende Betrachtung
- C. ANHANG
- C.1. Literaturverzeichnis
- C.2. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Global Marshall Plan Initiative (GMPI) im Kontext des Global Governance Konzepts. Die Arbeit analysiert die Organisation der GMPI und beleuchtet die Rolle von Nicht-Regierungsorganisationen in der Gestaltung einer globalen Weltordnung.
- Die Herausforderungen der Globalisierung und die Notwendigkeit einer globalen Governance
- Die Rolle von Nicht-Regierungsorganisationen in der Global Governance
- Die Organisationsanalyse der Global Marshall Plan Initiative
- Die Analyse der Strukturen, Funktionen und des Verhaltens der GMPI
- Die Relevanz der GMPI für die Gestaltung einer globalen Weltordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen Überblick über die Thematik und die Forschungsfrage. Der theoretische Teil befasst sich mit dem Global Governance Konzept und verschiedenen Organisationstheorien.
Der empirische Teil konzentriert sich auf die Analyse der GMPI. Die Analyse der Organisation umfasst eine detaillierte Betrachtung der Ziele, Instrumente, Bedingungen, Strukturen, Funktionen und des Verhaltens der GMPI.
Die Ergebnisse der SWOT Analyse werden dargestellt und die Kritik am Global Marshall Plan beleuchtet. Die Studie analysiert die Einstellungen und Interessen der Bevölkerung im Hinblick auf die GMPI.
Schlüsselwörter
Global Governance, Global Marshall Plan Initiative, Nicht-Regierungsorganisationen, Organisationstheorie, Organisationsanalyse, Strukturen, Funktionen, Verhalten, Globalisierung, Weltordnung, Entwicklung, Nachhaltigkeit.
- Quote paper
- Mag. Florian Josef Huber (Author), 2006, Durch den Global Marshall Plan zu einer neuen Weltordnung? Eine Organisationsanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67288