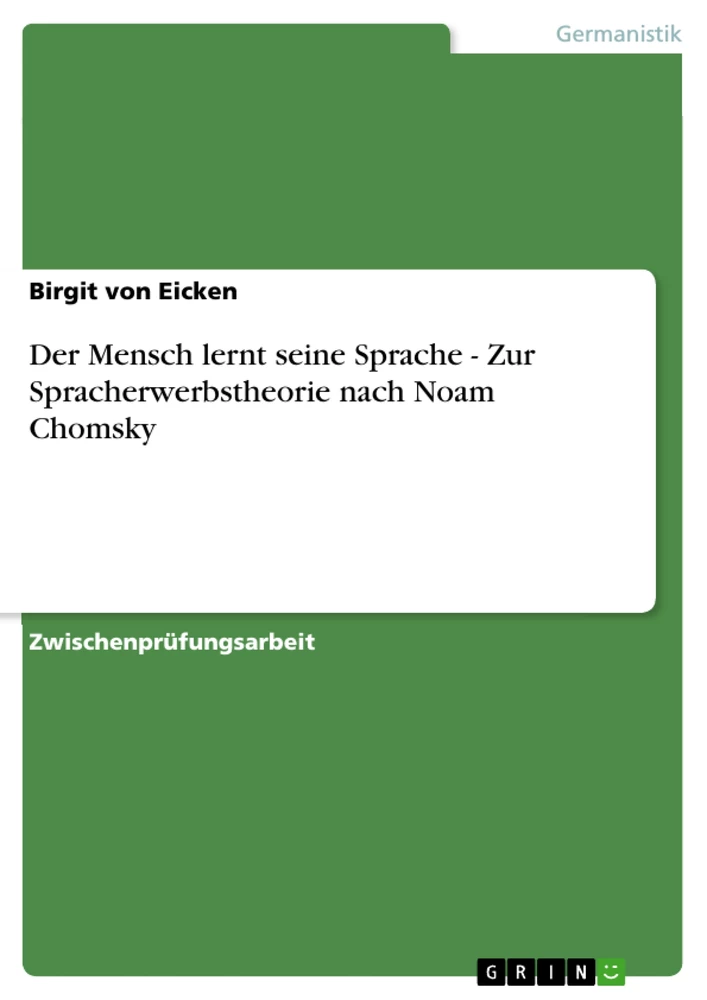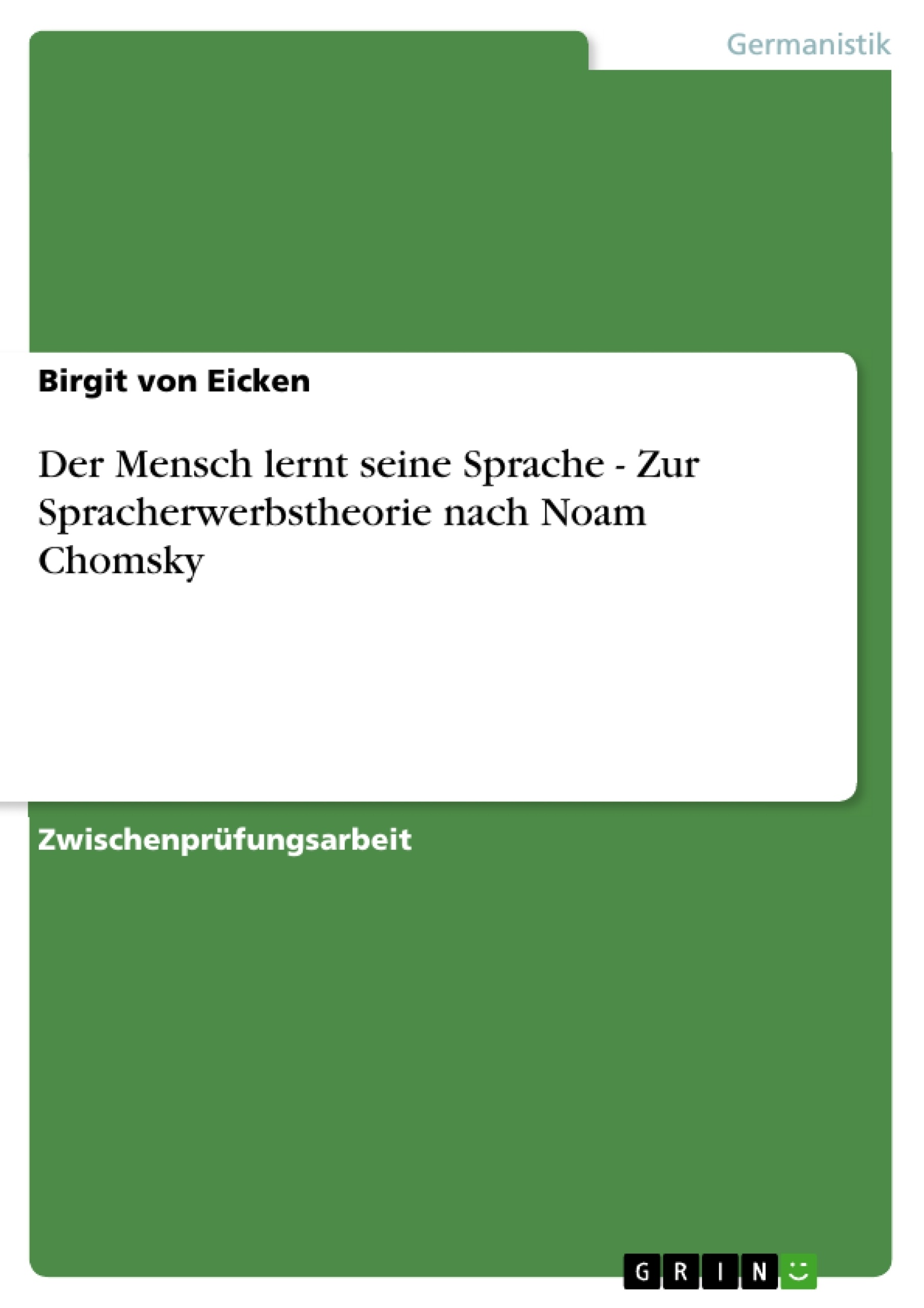Einleitung
Kommunikation spielt eine besondere Rolle in der Gesellschaft. Nur wer seine Aktivitäten mit denen der Anderen koordinieren kann, ist gesellschaftlich handlungsfähig. Diese Koordination geschieht über die Kommunikation mit anderen Mitgliedern der Gesellschaft. Die menschliche Kommunikation erfolgt zum größten Teil über die Sprache. Um ein handlungsfähiges Mitglied der Gesellschaft zu werden, muss der Mensch im Kindes- und Jugendalter kommunikative und damit auch sprachliche Fähigkeiten entwickeln. Wie der Prozess des Spracherwerbs im Einzelnen aussieht und verläuft, ist umstritten. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze, die unter anderem aus den Bereichen der Soziologie, Psychologie und Linguistik stammen. Die Behavioristen z.B. gehen davon aus, dass der Mensch ohne angeborene Strukturen die Sprache erlernt, was entscheidend von den Erfahrungen mit der Umwelt geprägt wird. Eine vollkommen gegensätzliche Einstellung vertritt Noam Chomsky. Seiner Meinung nach sind die Strukturen der Sprache angeboren, also genetisch bedingt.1 Erst durch Übung und die entsprechenden Stimuli können diese Strukturen während der Sprachentwicklung heranreifen.
Diese zweite Theorie nach Chomsky soll im Folgenden genauer betrachtet werden, um einen Zugang aus dem Bereich der Linguistik zu diesem Thema zu erhalten. Um Chomskys Bedeutung für die Linguistik zu verdeutlichen, wird zunächst versucht, Chomsky und seine Theorie in die Geschichte der Linguistik einzuordnen. Im Weiteren soll seine Theorie des Spracherwerbs beschrieben werden, um sie anschließend kritisch zu betrachten. Hier ist von besonderem Interesse, welche Argumente für und welche gegen die Spracherwerbstheorie Chomskys sprechen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Chomskys Platz in der Linguistik
- Chomskys Theorie der Sprache
- Sein Platz in der Geschichte der Linguistik
- Der Erwerb der Sprache
- Der Spracherwerb nach Chomsky
- Argumente für und gegen Chomskys Spracherwerbstheorie
- Für Chomsky
- Gegen Chomsky
- Fazit
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Spracherwerbstheorie von Noam Chomsky und versucht, seine Bedeutung für die Linguistik aufzuzeigen. Er beleuchtet Chomskys Theorie im Kontext der Geschichte der Linguistik und analysiert seine zentralen Argumente zum Spracherwerb.
- Chomskys generative Transformations-Grammatik
- Die angeborene Fähigkeit des Menschen zur Sprachentwicklung
- Die Konzepte der Tiefen- und Oberflächenstruktur
- Die Rolle von Übung und Stimulation im Spracherwerb
- Kritik an Chomskys Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung der Kommunikation für die Gesellschaft heraus und führt in die Problematik des Spracherwerbs ein. Sie präsentiert Chomskys Theorie als Gegenentwurf zur behavioristischen Sichtweise.
Kapitel 2 beleuchtet Chomskys Position in der Linguistik und stellt seine Theorie der Sprache dar. Es beschreibt das Konzept der Tiefen- und Oberflächenstruktur und die zentrale Rolle der menschlichen kognitiven Fähigkeiten im Spracherwerb.
Kapitel 3 analysiert Chomskys Spracherwerbstheorie und präsentiert Argumente für und gegen seine Ansichten. Es diskutiert kritisch die Beweise für die angeborene Fähigkeit des Menschen, Sprache zu lernen.
Schlüsselwörter
Spracherwerbstheorie, Noam Chomsky, generative Transformations-Grammatik, Tiefen- und Oberflächenstruktur, Kompetenz und Performanz, angeborene Strukturen, Stimulation, Kritik an Chomskys Theorie.
- Citation du texte
- Birgit von Eicken (Auteur), 2005, Der Mensch lernt seine Sprache - Zur Spracherwerbstheorie nach Noam Chomsky, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67271