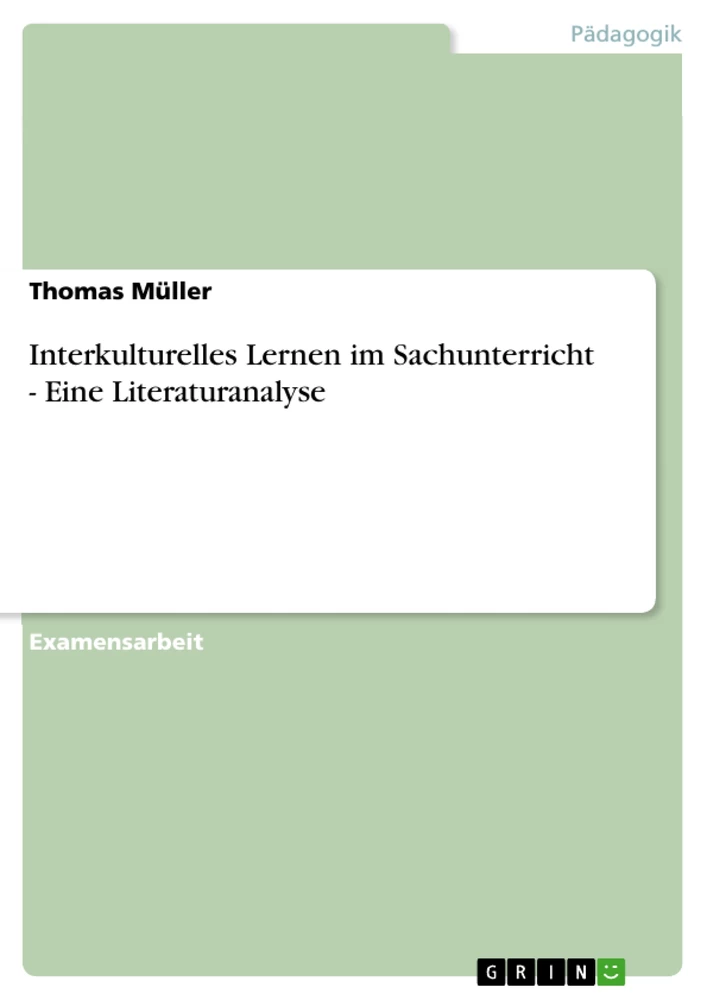Einleitung:
"Kinder heute kommen aus Familien unterschiedlicher kultureller Herkunft. Der Anteil ausländischer Kinder und der Aussiedlerfamilien ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Auch deshalb haben Grundschulklassen heute eine sehr heterogene Zusammensetzung".
Dieser Auszug aus dem Punkt drei des "Frankfurter Manifests zum
Bundesgrundschulkongreß 1989" spiegelt die aktuelle Wahrnehmung des
strukturellen Wandels der Schülerpopulation deutscher Grundschulen bzw. der deutschen Gesellschaftsstruktur wider. Ethnische, sprachliche und kulturelle Vielfalt ist kein marginales Phänomen mehr in deutschen Grundschulklassen, vielmehr gehört sie zum alltäglichen Bild. Diese Veränderung der Schülerpopulation nimmt Einfluß auf die Heterogenität der Lernvoraussetzungen.
Diese ist in der Grundschule, als gemeinsamer Grundstufe für alle Kinder, besonders ausgeprägt, da in einem Jahrgang Schüler des gesamten Begabungsund Interessenspektrums sitzen:
"Jeder einzelne besitzt unverwechselbare persönliche Voraussetzungen, Bedürfnisse Erfahrungen, die ihn von den anderen in Nuancen oder meilenweit, unterscheiden, Faktoren, die er in den Unterricht einbringt. Sprache oder kulturelle Herkunft sind
dabei wichtige Elemente" (KUPFER-SCHREINER 1994, S. 12).
Die Grundschule, "als Schule mit dem größten Integrationsanspruch", muß diese Entwicklungen berücksichtigen, wenn sie ihrem Anspruch, "allen Schulpflichtigen eine gemeinsame grundlegende Bildung [zu] vermitteln" (BOSCH 1994, S. 47), gerecht werden will. Ein Versuch der ethnischen, sprachlichen und kulturellen Pluralisierung auf pädagogischer Ebene Rechnung zu tragen ist "interkulturelles
Lernen". Nach KIPER (1992) ist "interkulturelles Lernen"
"das gemeinsame Lernen von Menschen unterschiedlicher nationaler bzw. ethnischer Herkunft [..]; es nimmt Bezug auf die jeweiligen, auch kulturell geformten Erfahrungen, es orientiert auf Gemeinsamkeiten auf der Basis der Akzeptanz von Unterschieden,
orientiert auf gleichberechtigte Beziehungsformen und sucht zur Gestaltung neuer Lern- und Lebensmöglichkeiten beizutragen" (a.a.O., S. 161).
Interkulturelles Lernen vollzieht sich im Kontext von interkultureller Erziehung, somit ist interkulturelle Erziehung auch immer wieder Gegenstand dieser Arbeit.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG:
- 2. DIE ZEITSCHRIFT "SACHUNTERRICHT UND MATHEMATIK IN DER PRIMARSTUFE":
- 3. EINE NEUE RUBRIK: "AUSLÄNDERKINDER IM UNTERRICHT":
- 3.1. Ausländerkinder im Sachunterricht - ein Sprachproblem:
- 3.2. Sachunterricht als Zweitsprachenunterricht:
- 3.3. Sprachlich vorbereiteter Sachunterricht:
- 4. AUSLÄNDERPÄDAGOGIK - EINE SONDERPÄDAGOGIK FÜR AUSLÄNDER:
- 4.1 Migrationsbedingte Veränderungen des Grundschulalltags und Reaktionen der Bildungspolitik:
- 4.2. Kritik an der Ausländerpädagogik:
- 5. AUSLÄNDERKINDER UND IHRE BERÜCKSICHTIGUNG IM SACHUNTERRICHT:
- 5.1. Interkulturelle Erziehung:
- 5.1.1. Terminologie:
- 5.1.2. Der Kulturbegriff:
- 5.1.3. Entstehung und Ansätze interkultureller Erziehung:
- 5.1.4. Interkulturelle Erziehung und Zweisprachigkeit:
- 5.1.5. Interkulturelles Lernen auch für Lehrer:
- 5.2. Von der Heimatkunde zum Sachunterricht: Konzeptionen im Wandel der Zeit:
- 5.2.1. Von der Heimatkunde zum Sachunterricht:
- 5.2.2. Sachunterricht als elementarer Fachunterricht und die Orientierung an kindlichen Lebenswelten:
- 5.3. Thema "Ausländer" - ein Thema für den Sachunterricht:
- 5.3.1. Untersuchungen von Lehrplänen und Richtlinien:
- 5.3.2. Lehrbuchanalysen:
- 5.3.3. Die Bedeutung der Reformpädagogik für den Unterricht in Klassen mit deutschen und ausländischen Kindern:
- 5.3.3.1. Anregungen der MONTESSORI-Pädagogik
- 5.3.3.2. Anregungen aus den Konzeptionen von PETERSEN und FREINET:
- 6. "KULTURENVIELFALT UND MEHRSPRACHIGKEIT" - PERSPEKTIVEN DER 90ER JAHRE:
- 6.1. Aussiedler:
- 6.2. Die Rubrik in den 90er Jahren:
- 6.2.1. Der "Europagedanke im Sachunterricht":
- 6.2.1.1. Entwicklungen in Europa und Aufgaben einer Europaerziehung:
- 6.2.1.2. Europaerziehung und interkulturelles Lernen:
- 6.2.1.3. Europa - ein neues Thema im Sachunterricht:
- 6.2.2. Überlegungen zu einer Konzeption interkulturellen Sachunterrichts:
- 7. ZUSAMMENFASSUNG:
- Entwicklung interkulturellen Lernens im Sachunterricht
- Analyse der Rubrik "Ausländerkinder im Unterricht" in SMP
- Bedeutung von Ausländerpädagogik und interkultureller Erziehung
- Einbezug der Disziplingeschichte des Sachunterrichts
- Analyse von Lehrplänen, Richtlinien und Lehrbüchern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die zeitliche und inhaltliche Entwicklung des interkulturellen Lernens im Sachunterricht der Grundschule anhand der in der Zeitschrift "Sachunterricht und Mathematik in der Primarstufe" (SMP) veröffentlichten Beiträge. Der Fokus liegt auf der Rubrik "Ausländerkinder im Unterricht", die später in "Kulturenvielfalt und Mehrsprachigkeit" umbenannt wurde. Die Arbeit beleuchtet, wie Schule und Unterricht der Anwesenheit ausländischer Kinder bzw. der Existenz multinationaler Klassen Rechnung tragen können.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer kurzen Vorstellung der Zeitschrift "Sachunterricht und Mathematik in der Primarstufe" und schildert die Anfänge der Rubrik "Ausländerkinder im Unterricht". Kapitel 3 beleuchtet die frühen Beiträge, die sich mit sprachlichen Problemen von Ausländerkindern im Sachunterricht auseinandersetzen. Kapitel 4 widmet sich der "Ausländerpädagogik" und deren Kritik. Kapitel 5 befasst sich mit der Entwicklung interkultureller Erziehung und ihrer Bedeutung für den Sachunterricht. Es werden verschiedene Konzeptionen und Ansätze vorgestellt, sowie die Rolle des Sachunterrichts in der Förderung interkulturellen Lernens diskutiert. Kapitel 6 schließlich analysiert die Entwicklung der Rubrik "Kulturenvielfalt und Mehrsprachigkeit" in den 1990er Jahren, die sich mit den Herausforderungen und Chancen einer zunehmend heterogenen Schülerschaft auseinandersetzt.
Schlüsselwörter
Interkulturelles Lernen, Sachunterricht, Grundschule, Ausländerkinder, Ausländerpädagogik, interkulturelle Erziehung, Mehrsprachigkeit, Kulturenvielfalt, Lehrpläne, Richtlinien, Lehrbücher, Reformpädagogik, Montessori-Pädagogik, Petersen, Freinet, Europaerziehung.
- Quote paper
- Thomas Müller (Author), 1997, Interkulturelles Lernen im Sachunterricht - Eine Literaturanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66