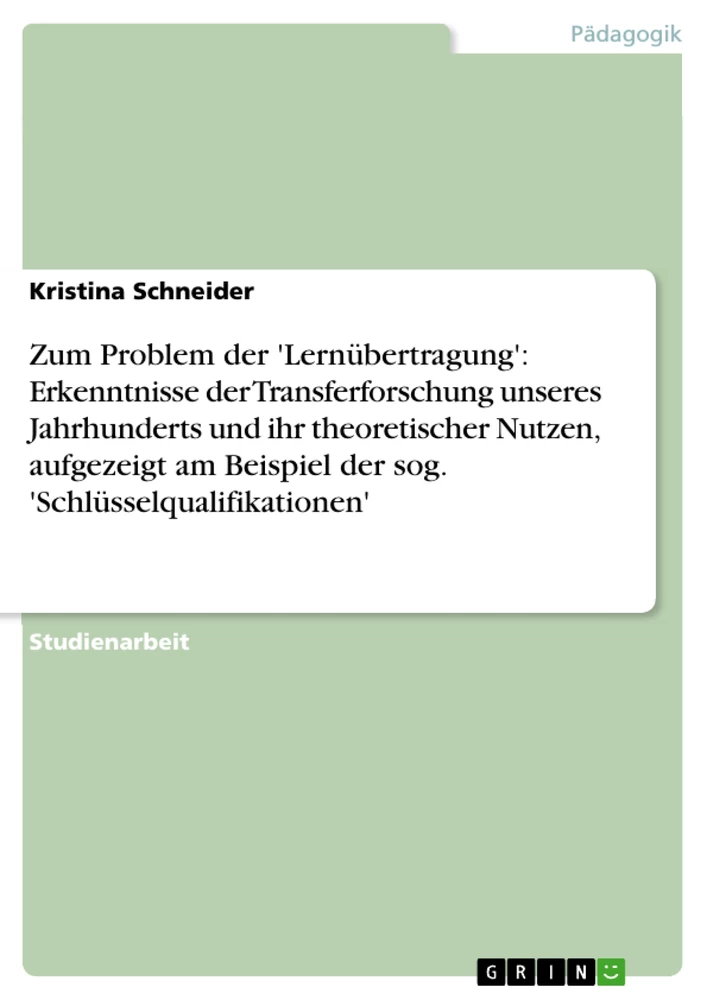„Die Innovationsdynamik der Technologieentwicklung und Reorganisation von Unternehmensstrukturen und -abläufen führt zu permanenten Veränderungen beruflicher Qualifikationsanforderungen und damit zu Schwierigkeiten bei der Prognostizierbarkeit von Arbeitskräfte- und Qualifikationsbedarfen.“ Deshalb kommt den fachübergreifenden Kompetenzen eine enorme Bedeutung zu. Engagement, Flexibilität und Kreativität sind die in Stellenanzeigen geforderten Eigenschaften. Es reicht heute nicht mehr aus für eine eng umgrenzte Klasse von Spezialaufgaben qualifiziert zu sein, Mitarbeiter müssen in der Lage sein, den Wandel von Anforderungen infolge neuer oder geänderter Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Die Wirtschaft fordert die Fähigkeit, sich schnell auf veränderte Bedingungen einzustellen und neuen Anforderungen offen und selbstsicher entgegenzutreten.
In diesem Zusammenhang ist der Begriff der Schlüsselqualifikationen entstanden. Durch die Ausstattung mit einem universalen Schlüssel sollen im Arbeitsmarkt der Gegenwart und Zukunft möglichst viele Türen geöffnet werden und der Einzelne befähigt werden, berufliche, gesellschaftliche wie auch individuelle Probleme selbständig zu lösen. Die Vorstellung eines Universalschlüssels, der wie ein Dietrich in jedes Schloss passt, also die Vorstellung davon, dass sich allgemeine Fähigkeiten erlernen lassen, die sich unabhängig von der Spezifität der konkreten Anforderungssituation anwenden lassen, wird wohl jedem zusagen. Die Frage ist jedoch nicht, ob es wünschenswert sein könnte, allgemeine Fähigkeiten zu fördern, sondern in welchem Ausmaß das möglich ist. Es stellt sich das Problem der Lernübertragung und die Frage ob es eine allgemeine Transferfähigkeit, die in spezifischen Kontexten flexibel eingesetzt werden kann, überhaupt gibt. Um dieser Frage nachzugehen werden die Erkenntnisse der Transferforschung unseres Jahrhunderts herangezogen.
Es soll in dieser Arbeit herausgefunden werden, welche Bedingungen an einen erfolgreichen Transfer gestellt werden und inwiefern die Erkenntnisse der Transferforschung dazu beitragen können, den Lernenden jene Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln, die in unserer heutigen Zeit einen beruflichen und persönlichen Erfolg ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Das Konzept der Schlüsselqualifikationen
- Entstehung und Definition
- Kritik an den Schlüsselqualifikationen
- Lerntransfer
- Der Transferbegriff
- Die Formen des Transfers
- Klassische Theorien zum Lerntransfer
- Die formale Bildungstheorie und deren Widerlegung
- Thorndikes Theorie der identischen Elemente
- Die Generalisierungstheorie nach Judd
- Bewertung des Konzeptes der Schlüsselqualifikationen unter Bezugnahme auf die klassischen Transfertheorien
- Konstruktivistisches Transferkonzept
- Konstruktivismus und situiertes Lernen
- Das Problem des trägen Wissens
- Ansätze zur Gestaltung konstruktivistischer Lernumgebungen
- Cognitive-Apprenticeship-Ansatz
- Anchored-Instruction-Ansatz
- Handlungskompetenz als Ziel der Berufsausbildung
- Grundsätze zur Gestaltung von Lernumgebungen unter Berücksichtigung konstruktivistischer Grundsätze und Kriterien
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, das Konzept der Schlüsselqualifikationen im Kontext der Transferforschung zu untersuchen. Dabei wird erörtert, welche Bedingungen an einen erfolgreichen Transfer gestellt werden und inwiefern die Erkenntnisse der Transferforschung dazu beitragen können, den Lernenden Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln, die in unserer heutigen Zeit einen beruflichen und persönlichen Erfolg ermöglichen.
- Entstehung und Definition des Begriffs der Schlüsselqualifikationen
- Kritik an den Schlüsselqualifikationen
- Theorien zum Lerntransfer, insbesondere klassische und konstruktivistische Ansätze
- Die Rolle von Schlüsselqualifikationen im Kontext der Handlungskompetenz
- Gestaltung von Lernumgebungen, die den Transfer von Wissen und Fähigkeiten fördern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit der Darstellung der Problemstellung, die sich aus dem sich ständig wandelnden Qualifikationsbedarf der Wirtschaft ergibt. Dabei wird die Bedeutung von Schlüsselqualifikationen im Kontext dieser Veränderungen beleuchtet. Das zweite Kapitel widmet sich dem Konzept der Schlüsselqualifikationen, ihrer Entstehung und Definition sowie der Kritik, die an ihnen geäußert wird. Im dritten Kapitel werden verschiedene Theorien zum Lerntransfer vorgestellt, wobei insbesondere die klassischen Ansätze, wie die formale Bildungstheorie, die Theorie der identischen Elemente und die Generalisierungstheorie, im Mittelpunkt stehen. Anschließend wird das Konzept der Schlüsselqualifikationen unter Bezugnahme auf diese klassischen Transfertheorien bewertet.
Das vierte Kapitel befasst sich mit dem konstruktivistischen Transferkonzept, dessen Kern die Bedeutung des situierten Lernens darstellt. Hier wird das Problem des "trägen Wissens" behandelt, das sich auf die Schwierigkeit bezieht, erworbenes Wissen in neuen Situationen erfolgreich anzuwenden. Im fünften Kapitel werden zwei Ansätze zur Gestaltung konstruktivistischer Lernumgebungen, der Cognitive-Apprenticeship-Ansatz und der Anchored-Instruction-Ansatz, vorgestellt. Das sechste Kapitel befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Handlungskompetenz und Schlüsselqualifikationen. Abschließend werden im siebten Kapitel Grundsätze zur Gestaltung von Lernumgebungen unter Berücksichtigung konstruktivistischer Prinzipien und Kriterien vorgestellt.
Schlüsselwörter
Schlüsselqualifikationen, Lerntransfer, konstruktivistisches Lernen, Handlungskompetenz, situiertes Lernen, träges Wissen, Cognitive Apprenticeship, Anchored Instruction.
- Quote paper
- Dipl.-Hdl. Kristina Schneider (Author), 2005, Zum Problem der 'Lernübertragung': Erkenntnisse der Transferforschung unseres Jahrhunderts und ihr theoretischer Nutzen, aufgezeigt am Beispiel der sog. 'Schlüsselqualifikationen', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66938