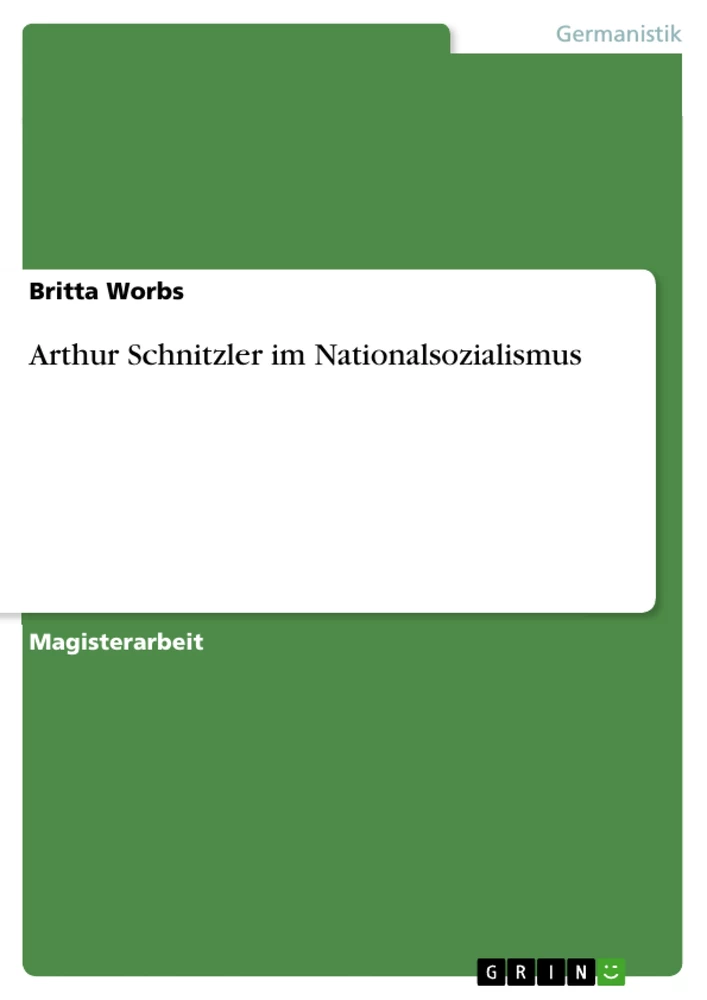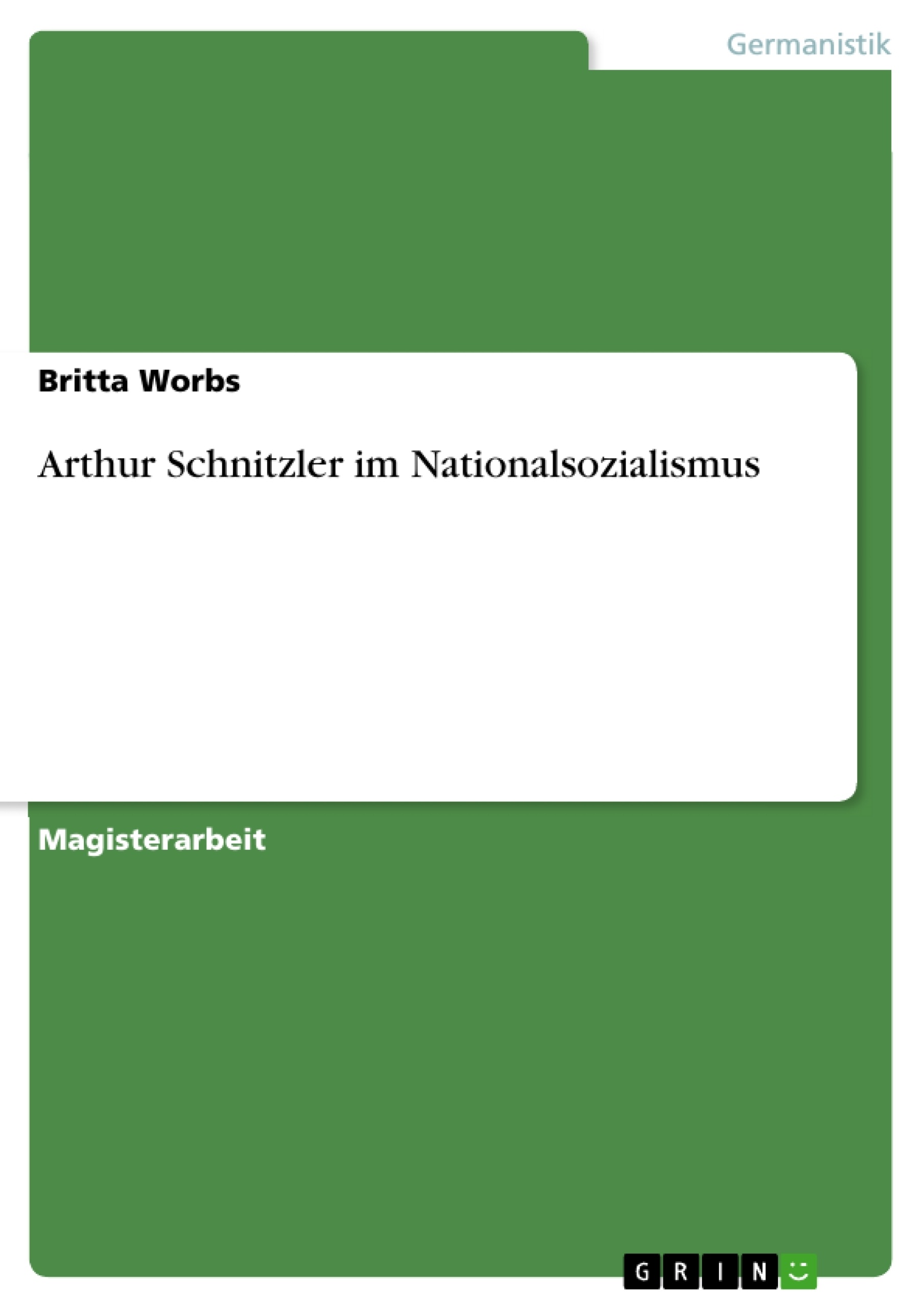„Mißverstanden wurden natürlich alle Künstler von Rang, - die Betonung – und die Lautheit der ‚Verstehenden′ ist eben doch zum allergrößten Teil nur aus meinem Judentum zu erklären.“ (Tagebucheintrag vom 29.1.1919)1
Warum ist es interessant zu untersuchen, wie es einem Autor in der national-sozialistischen Zeit ergangen ist, besonders wenn der Autor zu diesem Zeitpunkt schon verstorben war und die besondere Dramatik durch Exil oder Flucht somit außen vor bleibt? Deutlich ist die globale Antwort, dass die NS-Zeit uns hoffentlich für immer beschäftigen wird, damit die Menschen wachsam und aufmerksam bleiben, denn nur unter solchen Voraussetzungen kann es möglich sein, sich erneuten Terrorregimen entgegen zu stellen. Trotz aller Aufmerksamkeit gibt es doch eine ansteigende Tendenz rechtsradikaler und antisemitischer Strömungen. Deshalb kann es nur positiv sein, diesen dunklen Aspekt deutscher, aber auch österreichischer Zeitgeschichte in möglichst vielen Aspekten zu beleuchten.
Arthur Schnitzler war eine Person, die durch die Betrachtung seines Lebenswerkes eine Untersuchung ermöglicht, die Drama und Epik jener Zeit beleuchten kann und Höhen und Tiefen in der Rezeptionsgeschichte aufweist (ob das nun an Zeitgeist oder Zeitdruck liegt, bleibt dahingestellt). Er bietet für einen Zeitraum von über dreißig Jahren vor der Naziregierung bis heute die Möglichkeit die Rezeption und Publikumsgunst zu betrachten.
Die vorliegende Arbeit gibt die Verhältnisse vor 1933 aus zwei verschiedenen Blickwinkeln wieder. Zum einen soll die Tendenz der nationalsozialistischen Strömung aufgezeigt werden. Schon lange, bevor am 10. April 1938 nach offiziellen Angaben über 90% der Bevölkerung Österreichs dem „Anschluss“ an das „Deutsche Reich“ zustimmten (wobei es den jüdischen Österreichern nicht erlaubt war, abzustimmen) und auch lange vor der „Machtergreifung“ durch die National-sozialisten am 30. Januar 1933 war die Atmosphäre in Deutschland und Österreich für Menschen jüdischen Glaubens bedrohlich.
Für Österreich ist es wichtig, den Zeitraum ab 1933 und nicht erst ab 1938 zu betrachten, da sich durch die politische Veränderung Deutschlands in Österreich ein Wandel vollzog. Mehrere österreichische Theater strichen Schnitzler schon 1933, vor dem Zeitpunkt des „Anschlusses“ aus dem Programm. Dies führte zwangsläufig zu weniger Berichterstattungen in Zeitungen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Stand der Forschung
- Einleitung
- Der Zeitraum vor 1933
- 1.1 Familiengeschichte
- 1.2 Zeitgeschichte vor 1933
- 1.3 Zur Lebenssituation Arthur Schnitzlers
- 1.4 Ruhm und Kritik
- 1.5 Veröffentlichungsgeschichte
- Der Zeitraum von 1933 bis 1945
- 2.1 Kunst und Kultur ab 1933
- 2.2 Umgang mit Kultur im Nationalsozialismus
- 2.2.1 Nationalsozialistische „Würdigung“ der Literatur
- 2.2.2 Nationalsozialistische „Würdigung“ des Theaterwesens
- 2.3 Literaturgeschichten im Nationalsozialismus
- 2.3.1 Adalbert Schmidt
- 2.3.2 Josef Nadler
- 2.4 Veröffentlichungen über Arthur Schnitzler und sein Werk von 1933 bis 1950
- 2.4.1 Veröffentlichungen von 1933 bis 1939
- 2.4.2 Veröffentlichungen von 1940 bis 1945
- 2.4.3 Veröffentlichungen von 1946 bis 1950
- 2.5 Zeitungsartikel über Arthur Schnitzler im Nationalsozialismus
- 2.5.1 „Persönliches über Arthur Schnitzler. Aus meinen Erinnerungen“
- 2.5.2 „Die Sekretärin Arthur Schnitzlers“
- Der Zeitraum nach 1945
- 3.1 Veröffentlichungsgeschichte
- 3.2 Theater
- 3.3 Zeitungen nach 1945
- 3.3.1 „Letzte Probe für \"Zwischenspiel`.
- 3.3.1 Schnitzler und die Nachwelt“
- 3.3.3 „Schnitzlers Wiederkunft“
- 3.4 Die,,Schnitzler-Renaissance“
- Schlussbemerkungen
- Quellennachweis
- Literaturverzeichnis
- Zeitungsquellen
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rezeption Arthur Schnitzlers im Nationalsozialismus. Sie beleuchtet, wie das Werk des Autors in der Zeit des Dritten Reichs wahrgenommen und rezipiert wurde. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Veröffentlichungen, Zeitungsartikeln und Literaturgeschichten, die sich mit Schnitzler auseinandersetzen.
- Die Rezeption Arthur Schnitzlers im Kontext des Nationalsozialismus.
- Die Darstellung des Umgangs mit Kultur und Literatur im Nationalsozialismus.
- Die Analyse der Rezeption Schnitzlers in Literaturgeschichten der Zeit.
- Die Betrachtung von Zeitungsartikeln, die sich mit Schnitzler und seinem Werk auseinandersetzen.
- Die Rolle des "Anschlusses" Österreichs an das Deutsche Reich für die Rezeption Schnitzlers.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den Zeitraum vor 1933 und setzt sich mit Schnitzlers Familie, seiner Zeitgeschichte, seiner Lebenssituation sowie seinen Ruhm und Kritik auseinander. Zudem wird die Veröffentlichungsgeschichte vor 1933 beleuchtet. Das zweite Kapitel widmet sich dem Zeitraum von 1933 bis 1945. Hier werden die Kunst und Kultur ab 1933, der Umgang mit Kultur im Nationalsozialismus, Literaturgeschichten im Nationalsozialismus sowie Veröffentlichungen über Arthur Schnitzler und sein Werk von 1933 bis 1950 analysiert. Außerdem werden Zeitungsartikel über Schnitzler im Nationalsozialismus untersucht. Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Zeitraum nach 1945 und analysiert die Veröffentlichungsgeschichte, das Theater, Zeitungen nach 1945 sowie die "Schnitzler-Renaissance".
Schlüsselwörter
Arthur Schnitzler, Nationalsozialismus, Rezeption, Literatur, Theater, Zeitgeschichte, Österreich, Deutschland, Veröffentlichungen, Zeitungsartikel, Literaturgeschichten, "Anschluss", Judentum.
- Quote paper
- Britta Worbs (Author), 2005, Arthur Schnitzler im Nationalsozialismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66906